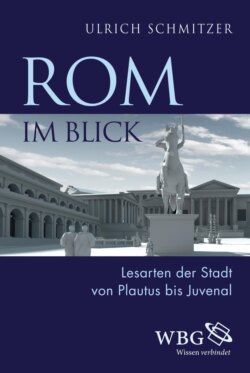Читать книгу Rom im Blick - Ulrich Schmitzer - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3 Die Stadt aus nicht-monumentaler Perspektive lesen
ОглавлениеAll diese Aspekte bilden den Hintergrund für unsere Untersuchung. Es geht nicht um eine Geschichte des Städtebaus oder einzelner Gebäude, sondern um eine Geschichte der Stadtwahrnehmung und Stadtaneignung nicht aus der Sicht der Planer, vielmehr aus der Sicht der in der Stadt Lebenden und von den Planungen Betroffenen. Diese Personen eignen sich |30|die Stadt auf ihre eigene Weise an, indem sie eigene Akzente setzen und bestimmte Aspekte hervorheben, andere dafür in den Hintergrund schieben oder ganz ausblenden.56
Zur Stadtwahrnehmung gehört auch die Einbettung in planerisch-geometrische Zusammenhänge. Doch anders als in neuzeitlichen Auffassungen, die von der ubiquitären Erfahrung der Stadtpläne und deren geometrischer Exaktheit geprägt ist,57 wird die römische Raumwahrnehmung nicht von einer abstrahierenden Vogelperspektive bestimmt, auch wenn sich aus ästhetischen Gründen immer wieder bei Stadtdarstellungen der Blick von oben vorfinden lässt, z.B. in der sog. wohl in flavische Zeit zu datierenden „città dipinta“, einem (allerdings schlecht erhaltenen) Fresko aus dem Bereich der Traiansthemen58, aber auch bisweilen auf Münzdarstellungen.59 Auch die antiken Stadtpläne, am bekanntesten die Forma Urbis, sind genauso wenig ein Mittel, um sich in der Stadt oder einem bestimmten Quartier zurechtzufinden, sondern dienen der Verwaltung (als eine Art Kataster) oder auch der Repräsentation.60 Ansonsten ist auch das römische mikrogeographische Wissen61 nicht nach modernen Gewohnheiten organisiert. Die für die antike Erfassung des Groß- und Mittelraums prägende Orientierung an routes (z.B. [Fern-]Handelswegen)62 lässt sich bisweilen sogar für die mentale Organisation der Stadt Rom feststellen, wie im frühmittelalterlichen Einsiedler Pilgerführer63, der sich anhand |31|von Prozessionswegen ausrichtet und das Wissen über Rom anhand von Routen durch die Stadt und den dabei berührten christlichen Gedächtnisstätten vermittelt.64 Das gilt aber auch schon für das antike Rom, wo die Wege durch die Stadt die Wahrnehmung lenken und bestimmen. Die Alternative dazu ist die anhand von markanten Punkten vermittelte Orientierung, sei es an berühmten Orten der memoria, sei es an anderen zum jeweiligen Zeitpunkt und im jeweiligen Kontext signifikanten Orten, wie sie für die Vereinbarung von Gerichtsterminen wichtig und üblich waren, ohne dass daraus eine Art von Itinerar entstünde.65
Im Grunde genommen weiß die Klassische Philologie schon immer, dass Literatur, Raum und handelnde Personen eine untrennbare Einheit bilden. Bereits beim spätantiken Vergilkommentator Servius liest man (ecl. 1,19): quaeritur, cur de Caesare interrogatus, Romam describat … aut certe quia nullus, qui continetur, est sine ea re, quae continet, nec … potest ulla persona esse sine loco: unde necesse habuit interrogatus de Caesare locum describere, in quo eum viderat („Man fragt, warum die Frage nach Caesar mit der Beschreibung Roms beantwortet wird: … gewiss, weil keiner, der enthalten ist, ohne die Sache, die ihn enthält, ist und keine Person ohne ihren Ort sein kann: Deshalb war es für Tityrus notwendig, dass er auf die Frage nach Caesar den Ort beschrieb, an dem er ihn gesehen hatte“).
Dennoch ging das Wissen über diesen engen Nexus verloren, nicht zuletzt deshalb, weil seit der Spätantike und verstärkt mit dem Zerfall des römischen Reiches die klassischen lateinischen Texte aus ihrer Situierung in der Stadt Rom zwangsläufig gelöst wurden, zudem schwand auch die Kenntnis der konkreten Stadttopographie in antiker Zeit. Dieses Defizit blieb prinzipiell für die Beziehung zwischen Text und Raum bestimmend. Die im 19. Jahrhundert wurzelnde positivistische Tradition zählte auch die Lokalisierung der Texte in das große Feld der „Realien“, die zwar zum formalen Textverständnis nötig waren, aber keine große interpretatorische Relevanz besaßen. Die Kommentare erklären die sachliche Basis der Texte mit positivistischem Zugriff.66 Die Alternative sind katalog- oder anthologieartige Zusammenstellungen von Belegstellen, die entweder aneinander gereiht oder durch erläuternde Texte zusammengehalten werden, wobei bisweilen stillschweigend Lücken in den Texten durch andere Texte und Paraphrasen gestopft werden, ohne zu fragen, ob es nicht auch sachliche, |32|politische oder gattungsbedingte Gründe für solche Leerstellen gibt, die für die Deutung fruchtbar zu machen wären.67
Gewiss war schon immer bei einer erheblichen Zahl von Texten nicht zu übersehen, dass Rom eine tragende Rolle spielt, etwa im 8. Buch von Vergils Aeneis68, in der Ars amatoria Ovids oder in den Epigrammen Martials. Die übliche Herangehensweise war aber bis weit ins 20., wenn nicht 21. Jahrhundert vor allem in der deutschen Philologie, die in den Texten genannten Monumente zu identifizieren und ggf. in ihrer Relevanz für das ideologische Umfeld (z.B. Augustus, Domitian) zu verorten. Auch in dieser Hinsicht leistete die Forschung also primär einen Beitrag zur Realienkunde in Rom.69 Dasselbe gilt für vor allem anhand der Epigramme und Elegien unternommene philologische Versuche, den „Alltag im alten Rom“ zu rekonstruieren und ebenfalls die Texte als Steinbrüche für Sachinformationen zu nutzen.
Wichtige Anregungen für unseren Zugang kommen aus dem angelsächsischen Sprachraum, besonders von Catherine EDWARDS70, Andrew WALLACE-HADRILL71 oder Nicholas HORSFALL72 mit seinem Kommentar zum 6. Buch der Aeneis, doch ist all das von einem systematischen Zugriff noch weit entfernt.73 Vielmehr bedarf es eines wirklich interdisziplinären und damit umfassenden Ansatzes.74 Dazu gehört auch der Dialog zwischen Altertumswissenschaft und moderner urbanistischer Forschung. Es ist aber zugleich festzuhalten, dass trotz des gemeinsamen Interesses am Thema „Stadt“ die Zugangsweisen sich erheblich unterscheiden. Weite Teile der modernen Urbanistik verstehen sich als handlungsorientiert75, nicht an systematischer Beschreibung orientiert.
|33|Sind also die Erkenntnisse der modernen Stadtsoziologie generell nur cum grano salis auf Rom anwendbar, so zeigt sich zumindest in einem Punkt eine mögliche Konvergenz: Eine Stadt ist in Wahrheit nicht eine einzige, sondern mehrere Städte. „Stadt“ erklärt sich nicht nur räumlich76, als Stadtagglomeration, sondern durch die Wahrnehmungsdifferenz der unterschiedlichen Milieus, die den Stadtraum in je anderer Weise auffassen, in Besitz nehmen und ihn nach ihren jeweiligen Bedürfnissen funktionalisieren.
Wie die modernen Großstädte, die „europäische Stadt“77, ist das antike Rom eine Stadt im steten Wandel, die sich im Wechsel der an sie gestellten Anforderungen neu definieren und neu erfinden muss. In der Zeit der Republik und der Frühen Kaiserzeit ist auch das Verhältnis von öffentlicher und privater Initiative78 stets neu auszuhandeln. Allerdings sind die Kategorien „öffentlich“ und „privat“ weniger trennscharf, als sie in der Retrospektion erscheinen.79 Sind die Baumaßnahmen der Magistrate eher von Staats wegen oder im Interesse der Steigerung des symbolischen Kapitals ihre Familien zu verstehen? Handelt der Princeps als privater primus inter pares oder gilt Ovids Dictum (trist. 4,4,15) res est publica Caesar? Ein Spezialfall ist gar das Verhältnis von Plätzen für die Öffentlichkeit und privaten Bauensembles.80
Rom ist diejenige antike Stadt, die auch für die dort lebenden Zeitgenossen in besonders herausgehobener Weise als Großstadt, ja als übervolle Stadt erscheint.81 Sie ist damit der Prototyp der neuzeitlichen Großstadt. Zugleich teilt Rom auf diese Weise mehr als andere Metropolen der Antike mit der europäischen Stadt der Moderne Fragestellungen und Probleme: Die ethnische und soziale Differenzierung in der Stadt korrespondiert mit der stadttopographischen Distribution und ist hier genauso zu nennen wie das Phänomen einer zum Problem werdenden städtischen Dichte und Verdichtung. Was Hartmut HÄUSSERMANN über die neuzeitliche europäische Stadt formuliert, lässt sich problemlos auf Rom übertragen und entspricht nicht zuletzt auch antiker Selbstwahrnehmung:82
|34|Hektisches Aktivitätsniveau, Geschwindigkeits- und Konsumrausch, das Nebeneinander des Fremden, ja Exotischen, Sensationen aller Art auf engem Raum – so wird bis heute die moderne Großstadt am Beginn dieses Jahrhunderts gerne beschrieben. Aber die Überfülle der Eindrücke, die extreme Differenz der Lebensstile, die unausweichliche Konfrontation unterschiedlicher Kulturen und die erzwungene ständige Begegnung mit dem Unbekannten, mit dem Fremden stellen auch eine hohe Anforderung, ja eine Überforderung dar, gegen die sich der Großstädter durch Rückzug, durch Abwehr, durch Blasiertheit und Indifferenz, durch Entpersönlichung der zufälligen Kontakte und Eindrücke wehren muss … Aus der Überbeanspruchung der Sinne und der langsameren Verarbeitung eines schnellen äußeren Wandels ergibt sich der städtische Sozialcharakter: man nimmt Distanz zu ungewollten, aber räumlich präsenten sozialen Beziehungen, man filtert seine Wahrnehmung, man distanziert sich innerlich vom äußerlich Nahen, man individualisiert seinen Lebensstil.
Andererseits ist Rom als die konkurrenzlos beherrschende Kapitale des Mediterraneum (vom 1. Jahrhundert v. Chr. bis zum Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr.) von der Rivalität mit prinzipiell gleichrangigen Städten befreit. Rom benötigt keine „Eigenlogik“83 zur Selbstdefinition, da es nicht auf einer Ebene mit den anderen Städten des Imperium agiert. Dass es just aus dieser kategorialen Andersartigkeit doch wieder Eigenlogik generiert, ist paradoxerweise die untrennbar zugehörige andere Seite dieser Medaille.
1 Zur Terminologie siehe CLASSEN 1986, 129–130, der darauf hinweist, dass Begriffe wie urbs, civitas, πόλις oder ἄστυ in der antiken Praxis nicht scharf voneinander unterschieden wurden.
2 Vgl. Walter EDER/Holger SONNABEND, Neuer Pauly 11 (2001) 890–891, s. v. Stadt. Solche rituelle Szenen sind auch bildlich dargestellt, z.B. auf einem an der Via Salaria gefundenen Relief einer Sella Curulis aus antoninischer Zeit, die mit dem Akt des Pflügens bei einer Stadt(wieder)gründung geschmückt ist (Rom, Terme di Diocleziano; FRIGGERI/MAGNANI CIANETTI 2014, 131; Abb. 1), oder auf einem Aureus von 13 v. Chr. (RIC Augustus 402) mit Augustus als Pontifex Maximus, der vor einer Stadt mit einem Gespann pflügt.
3 Vgl. MOMMSEN 1893, 56–65.
4 Vgl. RÜPKE 1990, bes. 30–36.
5 Zur Bedeutung der domi foris-Unterscheidung in der römischen Geschichtsschreibung siehe RIGGSBY 2009, 162–164; außerdem Hartmut GALSTERER, Neuer Pauly 10 (2001) 86–87, s. v. pomerium; COARELLI 2012, 15–29.
6 Vgl. auch Plut. Quaest. Rom. 217A (mit explizitem Bezug auf Varro) über die Frage, warum die Mauern, aber nicht die Tore einer Stadt sakrosankt seien (SCHEID 2012 ad loc.).
7 Serv. Aen. 1,12: urbs dicta ab orbe, quod antiquae civitates in orbem fiebant; vel ab urvo, parte aratri, quo muri designabantur („Die Stadt [urbs] ist nach dem Kreis [orbis] benannt, weil die Städte in alter Zeit in Gestalt eines Kreises geschaffen wurden, oder von der Krümmung des Pflugs [urvus], dem Teil des Pflugs, mit dem die Mauern bezeichnet wurden“).
8 Die römische Historiographie und verwandte literarische Gattungen verlängern diese Vorstellung rückwärts auf die Stadtgründungserzählung, wonach Remus zu Tode kommt, weil er die zwar noch niedrigen, aber sakral geschützten Mauern Roms überspringt (und nicht durch ein Tor geht) und deshalb vom Stadtgründer Romulus oder von einem von dessen Männern getötet wird.
9 Siehe die Belege in Thes. ling. Lat. 9,2,906–920, s. v. orbis.
10 Vgl. EDWARDS/WOOLF 2003, bes. 1–20 („Cosmopolis: Rome as World City“); SPROLL 2011, 329–333; vgl. MORLEY 1996, 1–12 über Rom als metropolis.
11 Eine Nachwirkung solcher Vorstellung des Zusammenfallens von Kosmos und Stadt findet sich noch im Mittelalter, etwa in dem bekannten Dictum des Beda Venerabilis (10. Jh. n. Chr.; MIGNE PL 94,543B): quamdiu stat Colisaeus, stat et Roma; quando cadet Colisaeus, cadet et Roma; quando cadet Roma, cadet mundus („Solange das Colosseum/der Koloss steht, steht auch Rom; sobald das Colosseum/der Koloss fällt, wird auch Rom fallen; sobald Rom fällt, wird auch der Kosmos fallen“).
12 Vgl. MEHL 1990 über die prinzipielle Unabgeschlossenheit und Grenzenlosigkeit des Imperium Romanum zur Zeit des Augustus; EIGLER 2008.
13 Vgl. CECAMORE 2002, 32–41.
14 Vitr. 3,1–4, hier 3,1,3: … non minus quemadmodum schema rotundationis in corpore efficitiur, item quadrata designatio in eo invenietur („nicht weniger wie im Körper die Form des Kreises bewirkt wird, findet man in ihm eine quadratische Bestimmung“).
15 KOLB 2002, 76. Fest. p. 310,35–312,3: Quadrata Roma in Palatio ante templum Apollinis dicitur, ubi reposita sunt, quae solent boni ominis gratia in urbe condenda adhiberi … („Die Roma quadrata soll auf dem Palatin vor dem Tempel des Apollo sein, wo die Dinge vergraben sind, die üblicherweise um guter Vorzeichen willen bei einer Stadtgründung angewendet werden …“). Vgl. die Zeugnisse und die Deutung bei CECAMORE 2002, 15–21; COARELLI 2012, 145–165.
16 Vgl. Christoph HÖCKER, Neuer Pauly 5 (1998) 582–583, s. v. Hippodamos von Milet.
17 Vgl. BURNS 1976.
18 Vgl. RÜPKE 1990, 165–171 („Altera Roma: Castra“).
19 Siehe die sehr instruktive Zusammenstellung anhand von MUMFORD bei LAURENCE 1997. Von grundsätzlicher Bedeutung ist seine Beobachtung, wie in neuzeitlichen Darstellungen punktuelle Bemerkungen antiker Autoren generalisiert werden und durch reflexhaftes Einbeziehen von archäologischen Ergebnissen aus anderen Kontexten zum allgemeinen Befund über die Realität des antiken Rom erhoben werden.
20 Vgl. ALBERS 2013, 42–44.
21 Vgl. Hartmut GALSTERER, Neuer Pauly 10 (2001) 86–87, s. v. pomerium; RÜPKE 1990, 35.
22 Vgl. COARELLI 1997, 3; 131–134.
23 Vgl. SCHMITZER 2010, 57–58 mit weiterer Literatur.
24 Zu der auf Max WEBER zurückgehenden Vorstellung von der nachantiken Stadt siehe SIEBEL 2004, 11–12 (13–18 werden diese Kriterien für das 21. Jahrhundert fortentwickelt). Daraus lässt sich als Gemeinsamkeit von Antike und Nachantike letztlich nur der Stadt-Land-Gegensatz gewinnen: Z. B. besaß Rom mit Ausnahme des praefectus urbi keine eigene städtische Gesamtselbstverwaltung unterhalb der für das gesamte Reich zuständigen Magistraten, vielmehr wurden die ursprünglich für die Stadt Rom konzipierten Verwaltungsformen auf die hinzugewonnenen Gebiete ausgedehnt. Vgl. prinzipiell MORLEY 1996.
25 Zur „Stadt ohne Mauern“ siehe HASELBERGER 2007, 231–237.
26 Siehe dazu HÄUBERMANN 2011, 23; HEIGL 2008, 79 definiert die antike Stadt nach WEBER durch hohe topographische Geschlossenheit, relativ hohe Bevölkerung, ausgeprägte Arbeitsteilung, soziale Differenzierung, gehobene Bausubstanz, urbanen Lebensstil und Funktion als Zentralort des agrarischen Umlands – allesamt moderne, nicht antike Kategorien.
27 Vgl. Frank KOLB, Neuer Pauly 11 (2001), 894–899, s. v. Stadt; vgl. auch den Überblick von GATES 2011, bes. 203–285.
28 Für heuristische und kontrastive Zwecke ist der bei KOLB 1984, 15 besonders aus WEBER entwickelte Kriterienkatalog nützlich: 1. topographische und administrative Geschlossenheit der Siedlung; 2. Bevölkerungszahl von mehreren tausend Einwohnern als Voraussetzung für 3. ausgeprägte Arbeitsteilung und soziale Differenzierung; 4. Mannigfaltigkeit der Bausubstanz; 5. urbaner Lebensstil; 6. Funktion der Siedlung als Zentralort für ein Umland, wobei Nr. 1–4 als essenziell betrachtet werden.
29 Vgl. KUNST 2006, 12–15.
30 Vgl. KOLB 2002, 409–425.
31 COATES-STEPHENS 2012; GOODMAN 2007, 42–46.
32 Siehe KRAUTHEIMER 1996, 263–286.
33 Vgl. z.B. den Anfang der ältesten Fassung der Mirabilia Urbis Romae aus dem 12. Jahrhundert (VALENTINI/ZUCCHETTI 1946, 17): murus civitatis Romae habet turres. CCCLXI., turres castella. XLVIIII., propugnacula. VI.DCCCC., portas. XII. sine Transtiberim, posterulas. V. in circuitu vero eius sunt miliaria. XXII., excepto Transtiberim et civitas Leoniana – „Die Mauer der Stadt Rom hat 361 Türme, 49 Türme mit Bastionen, 894 Vorwerke, 12 Tore ohne Trastevere, 5 Schlupftüren. Ihr Umfang beträgt 22 Meilen ohne Trastevere und die Civitas Leoniana“. Leon Baptista Alberti beginnt Mitte des 15. Jahrhunderts seine mathematischgeometrische Anleitung zur Erstellung einer Stadtbeschreibung mit den Worten (Descriptio Urbis Romae, ALBERTI 2005, 73): murorum Urbis Romae et fluminis et viarum ductus … ex mathematicis instrumentis quam diligentissime adnotavi – „Den Verlauf der Mauern der Stadt Rom, des Flusses und der Straßen … habe ich mit mathematischen Instrumenten so sorgfältig wie möglich bezeichnet“.
34 Weitere secessiones führten auf den Aventin und das Ianiculum: Jürgen VON UNGERN-STERNBERG, Neuer Pauly 11 (2001) 314–315, s. v. secessio.
35 MÜLLER 2004.
36 Vgl. HASELBERGER 2007, 21.
37 Zu Rom als Dystopie siehe den Überblick von LAURENCE 1997, 11–14.
38 Siehe unten S. 229 zu Martial und besonders S. 255 Juvenal, wo sich die Perspektiven dann verändern.
39 Vgl. SCHMITZER 2001.
40 Vgl. HEIGL 2008, 10–13.
41 Siehe ZETZEL 1995 zu 2,5–9 und 2,10–11 mit Hinweis auf die philosophische Tradition (Platon, Aristoteles) dieser Diskussion über den idealen Standort und auf Rom als Inkarnation einer solchen idealen Gründung sowie über das Weiterwirken dieser Vorstellungen bei Livius (5,54,4: Rede des Camillus, die eng nach Cicero gestaltet ist).
42 Vgl. FAVRO 1996, 24–78 über Rom in spätrepublikanischer Zeit und die auf den Prinzipat vorausweisenden Maßnahmen des Julius Caesar.
43 FAVRO 2005, 234–235; ZIMMERMANN 2010, 19–20; zur römischen Stadtplanung siehe auch KUNST 2006, 15–23.
44 FAVRO 2005, 261.
45 Vgl. HASELBERGER 2007, 27–28.
46 Vgl. das Material bei CLASSEN 1986.
47 KLEIN 1981.
48 Vgl. GOODMAN 2007.
49 Dabei spielt auch eine Rolle, dass es zwar Texte gibt, die das Landleben loben, dass aber das Leben in der Stadt in der Antike üblicherweise als höherwertig eingeschätzt wurde und etwa rusticus ein abwertender Begriff blieb (vergleichbar dem deutschen „Tölpel“ [= „Dörfler“]); vgl. CLASSEN 1986, 13.
50 Vgl. KOLB 1984, 141.
51 Siehe als jüngstes Beispiel von vielen Sarah BELL/James PASKINS (Hrsgg.), Imagining the Future City: London 2062, London 2013 (http://www.ubiquitypress.com/files/006-london2062.pdf).
52 Im griechischen Bereich galten etwa Milet (für die Hippodamos sein Konzept entwickelt hatte) und die unteritalische Kolonie Thurioi als Idealstädte.
53 Vgl. dazu knapp SCHMITZER 2001.
54 „Eppure io ho costruito nella mia mente un modello di città da cui dedurre tutte le città possibili, – disse Kublai. – Esso racchiude tutto quello che risponde alla norma. Siccome le città che esistono s’allontanano in vario grado dalla norma, mi basta prevedere le eccezioni alla norma e calcolarne le combinazioni più probabili.“
55 „Anch’io ho pensato un modello di città da cui deduco tutte le altre, – rispose Marco. È una città fatta solo d’eccezioni, preclusioni, contraddizioni, incongruenze, controsensi. Se una città così è quanto c’è di più improbabile, diminuendo il numero degli elementi abnormi si accrescono le probabilità che la città ci sia veramente. Dunque basta che io sottragga eccezioni al mio modello, e in qualsiasi ordine proceda arriverò a trovarmi davanti una delle città che, pur sempre in via d’eccezione, esistono. Ma non posso spingere la mia operazione oltre un certo limite: otterrei delle città troppo verosimili per essere vere.“
56 Soweit ich sehe, gibt es in der römischen Antike niemals, nicht einmal bei Nero ein wirkliches urbanistisches Gesamtkonzept (vgl. auch KOLB 1984, 153–154), das nicht nur einzelne Repräsentations- und Sakralbauten (bzw. Bauensembles) oder die Planung von infrastrukturellen Maßnahmen (wie Wasserleitungen) umfasste, sondern die Stadtanlage insgesamt ins Auge nahm, etwa wie Papst Sixtus V. die Stadt Rom architektonisch endgültig in die Renaissance führte (vgl. zugespitzt ANKER 1996). Womöglich ist diese Absenz aber partiell auch auf ein Quellenproblem zurückzuführen, denn immerhin lässt sich bei der Gestaltung des Marsfelds zur Zeit des Hadrian auch bei der Anlage der Wohngebäude ein gesamtplanerisches Eingreifen feststellen (BOATWRIGHT 1987, 63–64), doch scheint das bei weitem die Ausnahme gewesen zu sein (vgl. etwa den Negativbefund bei KNELL 2004).
57 Siehe SCHLÖGEL 2007, 81–265.
58 VOLPE/CARUSO 2001, 93 mit Taf. XXII/2.
59 Z. B. RIC Augustus 9a (= BMCRE Augustus 289): Denar von 25–23 v. Chr. mit einer von einer Mauer umgebenen, aus der Vogelperspektive dargestellten Stadt (wohl Emerita in Spanien).
60 Vgl. BAUER 2011, bes. 96–103; zur kartographischen Tradition siehe auch BEVILACQUA/FAGIOLO 2012, bes. 23–28; außerdem BOGEN/THÜRLEMANN 2009, bes. 17–21.
61 BRODERSEN 1995, 236: Selbst kartenähnliche antike Darstellungen des Kleinraums sind nicht maßstäblich, das gilt auch für Stadtpläne und ähnliche graphische Umsetzungen von flächigen Verhältnissen; etwas optimistischer ist WALLACE-HADRILL 2005, 77; generell jetzt KOLB 2013.
62 BRODERSEN 1995, 54–66; BRODERSEN 2013, bes. 191–193.
63 Vgl. BAUER 2011, 105–109.
64 Vgl. SCHMITZER 2007, 20.
65 Siehe SCHMITZER 2012, 79–80.
66 Z. B. KIESSLING/HEINZE 1957; BÖMER 1957/1958, um zwei besonders verdienstvolle, in der positivistischen Tradition stehende Kommentare zu nennen.
67 Zwei Beispiele: BOYLE 2003 als Katalog der im Gesamtwerk von Ovid verteilten Rom-Bezüge; HÖNN als Paraphrase der Rom-Stellen bei Horaz. Generell herrscht selbst bei sonst strengen Philologen gerade beim Thema Literatur und Rom ein gewisser Hang zu Schöngeistigkeit vor (z.B. DÖPP 2002).
68 Siehe BINDER 1971.
69 Vgl. z.B. BÖMER 1944, 333: „So vergeht denn dieser Tag, an dem Aeneas zwar manches Wissenswerte über den Kinderdieb Cacus, die Ara maxima und die Örtlichkeit des alten Rom erfahren hat, aber in den Dingen, die ihm am Herzen lagen, auch keinen Schritt weitergekommen ist. Der episodische Charakter ist vollkommen. Ein Dichter, dem es ausschließlich auf die Führung einer straffen Linie ankam, hätte hier ganz anders verfahren oder zumindest nachher kräftig eingreifen müssen, um seinen Grundsätzen treu zu bleiben.“
70 EDWARDS 1996; EDWARDS/WOOLF 2003.
71 WALLACE-HADRILL 2008.
72 HORSFALL 2013.
73 Siehe auch BARCHIESI 1994/97 und jetzt die Beiträge in NELIS/ROYO 2014.
74 Siehe die im Rahmen von Topoi entstandenen Beiträge in FUHRER 2011 und MUNDT 2012; außerdem FUHRER/MUNDT/STENGER 2015.
75 Vgl. z.B. FREY/KOCH 2011a.
76 Zur modernen innerurbanen Segregation vgl. FREY/KOCH 2011, 13–14.
77 FREY/KOCH 2011; noch immer unersetzt ist der materialreiche Überblick von BENEVOLO 1991, der allerdings sein Augenmerk auf die Beschreibung, nicht auf die Analyse richtet.
78 Zur Neuzeit siehe FREY/KOCH 2011, 12.
79 Vgl. FREY/KOCH 2011, 14–15.
80 Vgl. für die Antike ZANKER 1997.
81 Vgl. PALOMBI 2013, 28–30.
82 HÄUSSERMANN 2011, 25.
83 Zum Begriff der „Eigenlogik“ als Mittel der Selbstdefinition moderner Städte siehe LÖW 2008, 73–86 und passim.