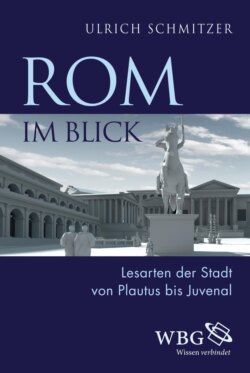Читать книгу Rom im Blick - Ulrich Schmitzer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|10|1 Die Stadt, ihr Text und ihre Lesarten
Оглавление„Keiner weiß besser als du, weiser Kublai, dass man die Stadt niemals mit der Rede verwechseln darf, die sie beschreibt.“ Italo CALVINO benennt mit diesen Worten aphoristisch knapp und zugleich treffsicher, dass eine Stadt in ihrer Totalität keinesfalls mit den Mitteln der Sprache erfasst werden kann, dass jeder vermeintlich umfassende Zugriff tatsächlich nur eine Annäherung und ein partikulares Verstehen ist.1 „Und doch“, so fährt er in „Die unsichtbaren Städte“2 fort, „gibt es zwischen der einen und der anderen eine Beziehung.“3 Die Rede von der Stadt ist also weder beliebig noch vergeblich. Man kann die Stadt in Erzählung überführen, aber dieser sich so ergebende Text als Summe narrativer und analytischer Einzeltexte ist nicht die Stadt. Ein solcher Text ist auch prinzipiell niemals dazu in der Lage, die Stadt in ihrer Vielfalt zu repräsentieren.
Genauso wenig wie den Text über die Stadt gibt es die Stadt – auch nicht die antike Stadt4 – als kollektiven Singular: Zwischen Antiochia im Osten und Emerita Augusta im spanischen Westen bestanden himmelweite Unterschiede, nicht anders als zwischen den weniger exzentrisch gelegenen Metropolen wie Alexandria, dem spätantiken Konstantinopel oder Rom selbst, mochten sie sich auch allesamt auf dem Boden des Imperium Romanum befinden und in dessen administrative wie kulturelle Welt gehören. Die meisten dieser Städte sind nur mit Mühe über die Zeiten hinweg differenziert zu erfassen, selbst für die urbane Gestalt von Alexandria oder Antiochia gibt es nicht in allen Epochen genügend archäologisches oder gar literarisches Material, um eine annähernd lückenlose Stadtgeschichte zu schreiben. Besser sieht es nur für Athen aus – und vor allen anderen für Rom.
Die privilegierte Stellung Roms bietet die ideale Gelegenheit, um zu untersuchen, wie sich eine Stadt im polaren Feld von Literatur und materieller Stadtgestalt positioniert und je nach Perspektive unterschiedlich darstellt. Denn wenn mit Walter JENS die antike Literatur „topisch, |11|die moderne u-topisch“ ist5, dann ist Rom dafür das exemplum schlechthin. Bis zur Spätantike ist der Ort, an dem die lateinische Literatur ihren Platz hat, selbstverständlich und exklusiv Rom, ob das nun jeweils thematisiert wird oder nicht.
Obwohl die Quellen zu Rom manchmal sogar über das verwertbare Maß hinaus fließen, repräsentieren sie einen spezifischen Ausschnitt, nämlich vor allem die Perspektive der materiell und bildungsmäßig privilegierten Schichten. Dieses Rom ist ein monumentales Rom, die Bauten und die ganze Stadtanlage entsprechen dem Rang als zentralem Ort des Imperium Romanum; die einfachen Menschen sind Publikum in dieser Stadt, nicht eigentliche Träger von Handlung. Ihre Zustimmung und ihr Applaus kosten die Herrschenden panem et circenses, aber keine wirkliche Partizipation. Auch bewegen sich diese minder privilegierten Schichten in einer anderen Welt, von der nur in verschwindendem Maß Zeugnisse aus erster Hand existieren. Eines der raren Gegenbeispiele, das tatsächlich nicht den Blickwinkel von oben repräsentiert, ist eine Erzählung aus der Regierungszeit Neros, als ein Mann nach Rom gebracht wurde, der zwar sehr gebildet war, aber einer sozial deklassierten Gruppe angehörte, den Christen. Der Apostel Paulus von Tarsus6 musste in Rom seinen Prozess erwarten. Die zwei Jahre dieser Wartezeit verbrachte er in einer Art von Hausarrest, der ihn aber nicht von der Kommunikation mit Besuchern abschnitt (Apg. 28,16u. 30–31; Einheitsübersetzung):
ὁτε δὲ εἰσήλθομεν εἰς ‘ρώμην, ἐπετράπη τῷ Παύλῳ μένειν καθ’ ἑαυτòν σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτòν στρατιώτη … ένέμεινεν δὲ διετίαν ὅλην ἐν ίδίῳ μισθώματι, καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρòς αὐτόν, κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοὐ θεοὐ καì διδάσκων τὰ περì τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως.
Nach unserer Ankunft in Rom erhielt Paulus die Erlaubnis, für sich allein zu wohnen, zusammen mit dem Soldaten, der ihn bewachte … Er blieb zwei volle Jahre in seiner Mietwohnung und empfing alle, die zu ihm kamen. Er verkündete das Reich Gottes und trug ungehindert und mit allem Freimut die Lehre über Jesus Christus, den Herrn, vor.
Es gibt also Menschen und Menschengruppen, die sich zwar in Rom befinden – sei es freiwillig, sei es gezwungen –, die aber von der Monumentalität der Stadt und ihrer Prägung durch den Herrscher nichts mitbekommen und auch nichts mitbekommen wollen. Das monumentale Rom, die |12|aurea Roma, wie sich die Stadt spätestens seit augusteischer Zeit in der Selbstwahrnehmung der Eliten darstellt, ist eben nur ein Teil der gesamten städtischen Realität. Die bei weitem überwiegende Mehrheit der Bewohner Roms hat sich im Alltag um ganz andere und für sie wichtigere Dinge zu sorgen, als bewundernd vor den Bauwerken zu stehen. Ihr Rom ist von Alltagserfahrungen, vom materiellen und bisweilen ganz handfest körperlichen Überlebenskampf, vom Umgang mit der engeren Nachbarschaft, aber auch von eigenen religiösen Bedürfnissen geprägt. Die „große“ Politik, der staatliche Kult und die Architektur sind für diese Menschen – Freie, Freigelassene und Unfreie – vor allem dann bedeutsam, wenn sie den Rahmen für Triumphe, Spiele und Feste bilden, die das tägliche Brot um (Opfer-)Fleisch und Unterhaltung bereichern.
Diese Menschen haben keine eigenen Texte hinterlassen7, wenn man einmal von den wenigen Graffiti und ähnlichen epigraphischen Zeugnissen absieht.8 Um diese Welt halbwegs aus erster Hand und mit authentischer Stimme zu erfassen, müsste man die verstreuten, teils mikroskopisch kleinen Zeugnisse zusammenstellen, die Graffiti, die Angaben in Dokumenten wie den Tabulae Herculanenses und Pompeianae9, die archäologischen Kleinfunde etwa aus Heiligtümern niedriger Gottheiten10 und die Baubefunde von Wohnhäusern aus einfachen Stadtvierteln – das Wissen über die republikanische Zeit und die frühe Kaiserzeit bliebe aufgrund der Überlieferungslage dennoch prinzipiell fragmentarisch11; die Rolle der literarischen Texte wäre bestenfalls marginal.
Umgekehrt haben diejenigen, die Texte mit literarischem Anspruch verfasst haben, auch kein genuines Interesse an den Menschen am unteren Rand der Gesellschaft.12 Wenn solche Personen in den Texten vorkommen, handelt es sich (selbst bei Martial) nicht um naturalistische Protokolle der Realität, sondern um literarische Inszenierungen, die von höherer |13|Warte aus vorgenommen werden. Diese literarische Superiorität, die gewiss mit materieller Superiorität einherging, führte aber nicht dazu, dass die (erhaltene) antike lateinische Rom-Literatur sich distanzlos dem Lob der Stadt, in der sie existierte, verschrieben hätte. Nur zu einem sehr geringen Teil ist sie dem panegyrischen Zugriff zuzuschlagen, dem Lob der Stadt oder des Stadtgestalters. Es wird sich zeigen, dass in vielen Texten ein verfremdetes Bild der Stadt zum Ausdruck kommt, in dem die aurea Roma als ein entrückter, gefahrvoller, erotisch aufgeladener, am guten Leben hindernder – kurz: als ein alternativer Ort erscheint. „Alternativ“ meint hierbei eine Perspektive, die der materiell gegebenen Stadtlandschaft durch den spezifischen literarischen Zugriff Aspekte abgewinnt, die sich nicht mit den Intentionen derjenigen decken, die für den Bau, die Ausgestaltung und die offizielle Nutzung Roms zuständig sind: Es geht also nicht primär um die republikanischen Eliten und die Herrscher der Prinzipatszeit mitsamt den ihnen Zugehörigen.
Der spezifische Beitrag der latinistischen Literaturwissenschaft zu einem Verständnis der Stadt13 besteht primär in der Interpretation von Texten, die eine nicht-monumentale Perspektive auf die Stadt einnehmen und so eine alternative Blickrichtung generieren. Demgemäß steht in der hier vorgelegten Untersuchung die Interpretation der Texte als Texte und damit der literaturwissenschaftliche Zugriff im Vordergrund und bestimmt das Vorgehen. Das Ziel ist also nicht (zumindest nicht vordergründig) die Erhellung historischer oder archäologischer Sachverhalte14, sondern aufzuzeigen, wie die Integration von Stadt, Stadtlandschaft und städtischem Geschehen in die lateinische Literatur von der Republik bis zum Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr. vonstattengeht. Die Texte werden also nicht als Fußnotenmaterial für Sachfragen verwendet, sondern in ihrer Aneignungs- und auch Konstruktionsleistung ernst genommen: Sie schaffen ein ganz eigenes Rom mit Worten, das neben dem gebauten Rom und dem Rom als Schauplatz (welt)historischer Ereignisse voll und ganz bestehen kann.15
|14|Die für diesen Zugriff relevanten literarischen Gattungen stehen nach antiker Auffassung unter den hohen genera16, dem Epos und dem Lehrgedicht.17 Es handelt sich vor allem um die Satire, die Liebeselegie und das Epigramm, aber auch um die bukolische Dichtung. Ihre Autoren charakterisieren sich selbst nicht selten als pauper, also als nicht den vermögenden Schichten zugehörig.18 Diese selbst zugeschriebene paupertas hat auch Auswirkungen auf das Bild von der Stadt in diesen Texten: Es ist – verkürzt und pauschal gesagt – das nicht-monumentale Rom, das in ihnen literarisch gestaltet wird, doch auch nicht das Rom der sozial Deklassierten oder gar des „Lumpenproletariats“. 19 Die Texte konstituieren ein eigenes, nämlich ein satirisches, elegisches oder epigrammatisches Rom, das von bewusster Ausblendung und Zuspitzung geprägt ist. Auf diese Weise entsteht ein jeweils spezifisches Rom, das sich aus der Aneignungs- und Gestaltungsleistung dieser Literaturformen herleitet. Diese Städte existieren allesamt auf dem Territorium der urbs Roma, sie teilen miteinander den physischen Raum, bespielen ihn aber jeweils unterschiedlich.20
Diese Städte in einer Stadt haben ihre je eigene Erzählung, die sich aus den zugrundeliegenden Einzeltexten formt. Sie sind damit auch Teil der großen Erzählung von der Stadt, die ihren Lesern ein alles andere als uniformes, sondern vielgestaltiges und vielfältiges Bild liefert. Innerhalb dieser großen Erzählung sind die Einzelerzählungen miteinander untrennbar verbunden, aber bisweilen auch so diskret, dass es ein so feines Gespür wie das des Italo CALVINO braucht, um das wirklich zu vernehmen:
|15|Wenn ich dir Olivia beschreibe, eine Stadt reich an Produkten und Gewinnen, habe ich keine andere Möglichkeit zur Erläuterung ihres Wohlstandes, als von den Filigranpalästen zu sprechen mit den befransten Kissen auf den Simsen der zweibogigen Fenster; hinter dem Gitter eines Patio netzt ein Kranz von Wasserstrahlen einen Rasen, auf dem ein weißer Pfau sein Rad schlägt. Aber aus dieser Rede verstehst du sogleich, dass Olivia in eine Wolke von Ruß und Schmiere gehüllt ist, die sich an die Hauswände klebt; dass im Straßengedränge die rangierenden Lastzüge die Menschen an die Mauern quetschen.21
Liest man die Stadt mit CALVINO also „richtig“, hört man die Untertöne und Zwischentöne ihres Textes aufmerksam, dann liefert sogar die affirmative und monumentale Erzählung zugleich den komplementären, alternativen Text, der der Perspektive von oben das notwendige Pendant von unten entgegensetzt und die Möglichkeit zu umfassendem Verstehen eröffnet.
1 Siehe dazu grundsätzlich FUHRER/MUNDT/STENGER 2015, 1–18 („Introduction“).
2 Italo CALVINO, Le città invisibili, Torino 1972; vgl. zuletzt RIVOLETTI 2015.
3 „Nessuno sa meglio di te, saggio Kublai, che non si deve mai confondere la città col discorso che la descrive. Eppure tra l’una e l’altro c’è un rapporto.“
4 Vgl. KOLB 1984.
5 JENS 1998, 91 über den Unterschied von griechischem und modernem Drama. Der Befund kann mit guten Gründen verallgemeinert werden.
6 NIPPEL 2003; RIESNER 2011, bes. 153–157.
7 Zum vorliterarischen Rom vgl. WISEMAN 2008, 1–23.
8 Zu den komplementären Problemen, antike „Kunst von unten“ aus archäologischer Warte zu fassen und zu klassifizieren, vgl. DI ANGELIS et al. 2013, passim.
9 Vgl. SCHMITZER 2012, 79–80 mit weiterer Literatur.
10 Zum vor allem von Menschen einfacher Herkunft besuchten Heiligtum der Anna Perenna nahe der Via Flaminia im Norden Roms und zu den dort gemachten Funden siehe PIRANOMONTE 2010.
11 In Verbindung mit literarischen Texten ergibt sich daraus im glücklichen Fall eine Gesamtinterpretation, wie von CANCIK 1971 vorgeführt und wie (weitgehend außerhalb der Antike) im New Historicism theoretisch ausgearbeitet.
12 Ein instruktives Beispiel ist Tac. ann. 15,44, wo von den merkwürdigen Gebräuchen der (den unteren sozialen Schichten angehörigen) Christen die Rede ist, aber nicht um ihrer selbst willen, sondern weil anhand ihres Schicksals das Vorgehen Neros illustriert und gebrandmarkt werden soll (SCHMITT 2011).
13 Für einen interdisziplinären Zugang siehe FUHRER/MUNDT/STENGER 2015.
14 Das schafft zugleich ein Gegengewicht zu den vorliegenden fundamentalen Darstellungen mit archäologisch-historischem Fokus (von GREGOROVIUS bis KOLB [2002], um von KRAUTHEIMERS [1996] von der Spätantike ausgehendem Weg ganz zu schweigen).
15 Der hier gewählte Zugang stellt nicht einfach Fußnoten zu einem Katalog der antik-römischen Topographie bereit, ist auch kein Supplement zu LUGLI 1952–1958, sondern fragt nach der spezifischen Aneignungsleistung der Literatur unter unterschiedlichen politischhistorischen Rahmenbedingungen und Gattungsspezifika, also nach der literarischen Konstruktion Roms, die ebenfalls höchst divergent ausfallen kann. Es geht andererseits auch nicht um das Rom-Bild in einem eher generellen Sinn (so z.B. zuletzt im Sammelband von BEHRWALD/WITSCHEL 2012), schon gar nicht um die „Rom-Idee“ (vgl. etwa KYTZLER 1993), sondern um den Umgang mit konkreten Monumenten und urbanen Gegebenheiten im Rahmen der Literatur, genauer gesagt: derjenigen Teile der antiken Literatur, die sich der Stadt Rom nicht aus der Perspektive der Eliten oder des Herrschers nähern, sondern einen nicht-elitären Blickwinkel einnehmen bzw. simulieren.
16 Vgl. CITRONI 2006 und zuletzt LORENZ 2014.
17 In der Prosa nehmen die Geschichtsschreibung (etwa im Vergleich zur Biographie und Memoirenliteratur) und die öffentliche Rede einen ähnlich hohen Rang ein, doch ist das für unsere Untersuchung von geringerer Bedeutung.
18 Vgl. Thes. ling. Lat. 10,1, c. 842–849, s. v. pauper, bes. den Abschnitt de notione 843, 36–46, wo Claud. Don. Aen. 8,365p. 167,23 zitiert ist: -r est …, cui deest maior copia familiaris rei et tamen aliquantae substantiae est, ‚egenus‘ … miserias exprimit et mendicitatem plenam („pauper ist, wem im größeren Umfang Vermögen fehlt und wer dennoch ein gewisses Maß an Hab und Gut hat, egenus … bezeichnet Elend und völlig bettelarm zu sein“). – Diese Selbstzuschreibung muss nicht den tatsächlichen sozialen Status widerspiegeln: Horaz, die Elegiker und auch Vergil z.B. zählten zum (durch sein hohes Vermögen definierten) Ritterstand.
19 Vgl. auch KLEINER 2005, 198; WOOLF 2003, 212–215 über Möglichkeiten und Grenzen der Rekonstruktion des „unliterary Rome“.
20 Eine für unsere Zwecke sehr hilfreiche Darstellung des Verhältnisses von space und place, „Raum“ und „Ort“, gibt RIGGSBY 2009, 152–154; wichtig ist auch grundsätzlich DOMS 2013.
21 „Se ti descrivo Olivia, città ricca di prodotti e guadagni, per significare la sua prosperità non ho altro mezzo che parlare di palazzi di filigrana con cuscini frangiati ai davanzali delle bifore; oltre la grata d’un patio una girandola di zampilli innaffia un prato dove un pavone bianco fa la ruota. Ma da questo discorso tu subito comprendi come Olivia è avvolta in una nuvola di fuliggine e d’unto che s’attacca alle pareti delle case; che nella ressa delle vie i rimorchi in manovra schiacciano i pedoni contro i muri.“