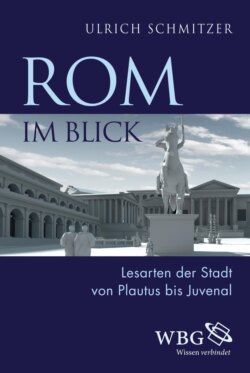Читать книгу Rom im Blick - Ulrich Schmitzer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Rom: die schöne und die nützliche Stadt
ОглавлениеWie sich im römischen Denken mit Rom die Urform einer Stadtgründung verbindet, so ist die Stadt Rom für Römer und für die römische Literatur auch die Stadt schlechthin (Quint. inst. 6,3,103):36 … postquam urbis appellatione, etiam si nomen proprium non adiceretur, Roma tamen accipi sit receptum … („… nachdem es Konvention geworden ist, in der Bezeichnung ‚Stadt‘, auch wenn der Eigenname nicht hinzugefügt ist, dennoch ‚Rom‘ als gemeint anzunehmen …“). Eine solche universale Stadt ist entweder ein Moloch37 oder die Inkarnation von Idealität und Schönheit, ein irdisches Gegenbild zum Babylon oder zum Jerusalem der Johannesapokalypse. Bis weit in die Kaiserzeit38 hinein finden wir keine Kritik am alles verschlingenden Rom, wohl aber die Identifikation mit dem Konzept der nützlichen und der schönen Stadt. Damit reiht sich die reale Stadt Rom in einen Diskurs ein, der in der griechischen Antike von imaginären Städten seinen Ausgang nahm: von der Beschreibung der Phäakenstadt in Homers Odyssee39, der Beschreibung von Atlantis in Platons Timaios und Kritias |24|oder der Erörterung des Sokrates in der Politeia über die Sinnhaftigkeit städtischen Zusammenlebens zum Wohle der Menschen.40
In die lateinische Literatur mündet diese Traditionslinie mit der Erörterung, die Cicero im 2. Buch von De re publica dem Scipio Africanus in den Mund legt. Dessen historischer Überblick über die römische Königszeit wird durch die Einbettung in den Raum der Stadt fundiert (Cic. rep. 2,10):41
qui potuit igitur divinius et utilitates conplecti maritimas Romulus et vitia vitare, quam quod urbem perennis amnis et aequabilis et in mare late influentis posuit in ripa? quo posset urbs et accipere a mari, quo egeret, et reddere, quo redundaret, eodemque ut flumine res ad victum cultumque maxime necessarias non solum mari absorberet, sed etiam invectas acciperet ex terra.
Wie hätte also Romulus göttlicher sowohl die Vorteile einer Lage am Meer umfassen als auch zugleich deren Nachteile vermeiden können, als dadurch, dass er die Stadt am Ufer eines dauernden und gleichmäßigen Stromes, der breit ins Meer floss, errichtete? Damit auf diese Weise die Stadt vom Meer erhalten konnte, was sie brauchte, und zurückgeben, woran sie Überfluss hatte, so dass sie auf ein und demselben Fluss nicht nur die zum Leben und zur verfeinerten Lebensführung am meisten notwendigen Dinge vom Meer aufnehmen konnte, sondern auch die vom Land herbeigeschafften erhalten.
Die Leistung des Romulus wird durch die Charakterisierung als divinius mit den Leistungen der göttlichen oder vergöttlichten griechischen Stadtgründer nicht nur verglichen, sondern sogar über sie gestellt. Romulus’ Verdienst besteht vor allem in der Auswahl eines in jeder Hinsicht idealen Ortes, der die unzuträglichen Extreme vermeidet und von Festland und Meer sich die jeweiligen Vorteile sichert. Auf diese Weise, so fährt Scipio fort, hat Romulus die künftige dominierende Rolle seiner Stadt schon prädestiniert, da an keinem anderen Platz in Italien die Voraussetzungen für den künftigen Aufstieg so günstig waren. Diese ideale Lage zeigt sich aber nicht nur an der geographischen Position in Italien, sondern auch an den stadtrömischen Bedingungen im engeren Sinn (Cic. rep. 2,11):
|25|urbis autem ipsius nativa praesidia quis est tam neglegens qui non habeat animo notata planeque cognita? cuius is est tractus ductusque muri cum Romuli, tum etiam reliquorum regum sapientia definitus ex omni parte arduis praeruptisque montibus, ut unus aditus, qui esset inter Esquilinum Quirinalemque montem, maximo aggere obiecto fossa cingeretur vastissima, atque ut ita munita arx circuitu arduo et quasi circumciso saxo niteretur, ut etiam in illa tempestate horribili Gallici adventus incolumis atque intacta permanserit. locumque delegit et fontibus abundantem et in regione pestilenti salubrem; colles enim sunt, qui cum perflantur ipsi, tum adferunt umbram vallibus. Den natürlichen Schutz der Stadt, wer ist so nachlässig, dass er ihn nicht in seinem Geist bemerkt und vollkommen erkannt hat? Der Verlauf und Gang dieser Mauer ist sowohl durch die Weisheit des Romulus als auch besonders die der übrigen Könige auf allen Seiten durch steile und jäh abfallende Berge bestimmt, so dass der einzige Zugang, der zwischen dem Esquilin und dem Quirinal war, durch einen davor aufgeschütteten riesigen Wall und einen breiten Graben begrenzt war und dass die so befestigte Burg sich auf eine steile Umfassung und einen gleichsam ringsum abgeschnittenen Felsen stützen konnte, so dass sie sogar in jener schrecklichen stürmischen Zeit des Galliersturmes unversehrt und unberührt blieb. Er wählte einen Platz aus, der überreich an Quellen war und zugleich mitten in einer verseuchten Gegend gesund; es sind nämlich die Hügel, die sowohl selbst durchweht werden als auch besonders den Tälern Schatten bringen.
Diese Passage zeigt, wie sehr das Rom-Thema in spätrepublikanischer Zeit an Relevanz gewonnen hatte und nun den Diskurs über die Stadt generell prägte.42 Dieses Selbstbild von der eigenen Stadt, das Cicero seinen Scipio entwerfen lässt, spiegelt nicht zuletzt den Aufschwung wider, den Rom in den Jahrhunderten zuvor genommen hatte. Das mittelrepublikanische Rom hätte noch keineswegs mit den hellenistischen Residenzstädten mithalten können43, wie die Römer sich selbstkritisch eingestehen mussten. Doch die Stadt holte mit hohem Tempo auf, spätestens in augusteischer Zeit hatte Rom die Königsstädte des Ostens weit hinter sich gelassen. Selbst Nostalgiker konnten sich die früheren städtebaulichen Verhältnisse nicht zurückwünschen, vielmehr ergriff der Stolz auf das Erreichte und der optimistische Ausblick auf die Zukunft |26|weiteste Kreise.44 Ein besonders instruktives Beispiel für dieses Selbstbewusstsein findet sich bei Vitruv.45 Am Beginn seines an Augustus gerichteten architekturtheoretischen, also prinzipiell auf sachliche Erörterung angelegtes Werks De architectura steht das Lob Roms (1 praef. 2):
cum vero attenderem te non solum de vita communi omnium curam publicaeque rei constitutione habere sed etiam de opportunitate publicorum aedificiorum, ut civitas per te non solum provinciis esset aucta, verum etiam ut maiestas imperii publicorum aedificiorum egregias haberet auctoritates, non putavi praetermittendum, quin primo quoque tempore de his rebus ea tibi ederem, ideo quod primum parenti tuo fueram notus et eius virtutis studiosus.
Da ich aber meinen Sinn darauf richtete, dass du nicht nur Sorge trägst um das gemeinsame Leben aller und die Einrichtung des Gemeinwesens, sondern auch um die zweckmäßige Anlage der öffentlichen Gebäude, so dass der Staat durch dich nicht nur durch Provinzen vermehrt wurde, sondern auch die Erhabenheit des Reiches das hervorragende Prestige von öffentlichen Gebäuden hat, da glaubte ich, nicht versäumen zu dürfen, dass ich jeweils zu Beginn das über diese Dinge dir schriebe, deshalb weil ich zuerst deinem Vater bekannt war und mich eifrig um seine guten Taten kümmerte.
Die Schönheit der Stadt, für die Augustus sorgt, inspiriert demnach Vitruv dazu, den Begleittext zu diesen urbanen Entwicklungen zu verfassen. Im spät- und nachantiken Städtelob46 verlor dann die Rede über die urbs die empirische Fundierung und löste sich spätestens seit dem 2. Jahrhundert, etwa seit der Romrede des Aelius Aristides47, immer mehr von der realen Stadttopographie.
In der späten Republik und der frühen Kaiserzeit verdichtet sich also die literarische Reflexion über Rom, wie es vorher und nachher nicht der Fall war. Wer die Stadt rühmt, rühmt die tatsächlich erkennbare bauliche Struktur und stellt sie in größere Zusammenhänge. So ist es zwei literarische Generationen nach Vitruv Plinius dem Älteren möglich, die Weltwunder nicht in fernen Zeiten und Ländern, sondern im räumlich und chronologisch definierten Rom anzusiedeln (im Buch der Steine, nat. 36, 101–102):
|27|verum et ad urbis nostrae miracula transire conveniat DCCCque annorum dociles scrutari vires et sic quoque terrarum orbem victum ostendere. quod accidisse totiens paene, quot referentur miracula, apparebit; universitate vero acervata et in quendam unum cumulum coiecta non alia magnitudo exurget quam si mundus alius quidam in uno loco narretur. nec ut circum maximum a Caesare dictatore exstructum longitudine stadiorum trium, latitudine unius, sed cum aedificiis iugerum quaternum, ad sedem CCL, inter magna opera dicamus: non inter magnifica basilicam Pauli columnis e Phrygibus mirabilem forumque divi Augusti et templum Pacis Vespasiani Imp. Aug., pulcherrima operum, quae umquam vidit orbis? eqs.
Freilich soll es angemessen sein, auch zu den wunderbaren Dingen unserer Stadt überzugehen und die gelehrigen Kräfte von achthundert Jahren genau zu durchsuchen und zu zeigen, dass auch auf diesem Gebiet der Erdkreis besiegt wurde. Dass dies beinahe so oft geschehen ist, wie Wunderbares aufgezählt wird, wird deutlich werden. Wenn man alles zusammenträgt und gewissermaßen auf einen einzigen Haufen zusammenfügt, dann wird keine andere Größe entstehen, als wenn eine bestimmte andere Welt an einer Stelle erzählt würde. Wollen wir zum Beispiel nicht den vom Diktator Caesar errichteten Circus Maximus mit seiner Länge von drei Stadien, der Breite von einem Stadium, aber mit Gebäuden mit einer Fläche von je einem Hektar, mit etwa 250.000 Sitzplätzen als große Werke bezeichnen? Wollen wir nicht unter diese staunenswerten Dinge die Basilica des Paulus (scil. die Basilica Aemilia), die durch ihre Säuen aus phrygischem Marmor bewundernswert ist, das Forum des vergöttlichten Augustus und den Friedenstempel des Kaisers Vespasian dazu rechnen, die schönsten Bauwerke, die jemals der Erdkreis gesehen hat? etc.
Eigentlich könnten solche Vorstellungen konsequenterweise zur Selbstdefinition Roms über den Vergleich mit anderen Städten führen, doch hindert daran die Vorstellung von der Singularität der eigenen Stadt. Denn dass sich eine Stadt in der Differenz zu (und Gemeinsamkeit mit) anderen Städten definiert, setzt eine prinzipielle Gleichartigkeit und potenzielle Gleichwertigkeit dieser Städte voraus.48 Im Gegensatz dazu ist das antike Rom durch seine Einzigartigkeit und Unvergleichbarkeit definiert. Der Tityrus der 1. Ekloge Vergils muss feststellen, dass sich Rom gerade allen Maßstäben entzieht, die aus anderen Siedlungen und Städten zu gewinnen wären (s.u. S. 108).49 An keiner einzigen Stelle der lateinischen |28|Literatur seit augusteischer Zeit wird Rom überhaupt mit anderen Städten wirklich verglichen, im Gegensatz zur zeitgenössischen griechischen Literatur – man denke an so unterschiedliche Autoren wie Strabon und Dionys von Halikarnass –, die allerdings ein durchsichtiges Ziel verfolgt, nämlich Rom in die griechischen Kategorien einzufügen und gar zu einer griechischen Stadt werden zu lassen.50 Damit wird die Differenz der römischen Selbstwahrnehmung auch im synchronen Vergleich deutlich.
Aus dieser einzigartigen Stellung Roms erklärt sich nicht zuletzt, warum es in der klassischen lateinischen Literatur so gut wie keine Diskussion um utopische Idealstadtentwürfe gibt; denn Rom ist ja selbst so etwas wie die Inkarnation der Idealstadt. Das führt auch zum Verzicht auf ein Pendant zur modernen Diskussion über die Stadt51 mit intensiver und systematischer Erörterung über die Zukunft der Stadtgestaltung und des Wohnens. Und gar gebaute Zukunftsentwürfe wie Pienza in der Toskana (durch Enea Silvio Piccolomini im 15. Jh.), die venezianische Festungsstadt Palmanova (im 16. Jh.) oder Brasilia (1956) existieren für die römische Antike nicht.52 Wenn in der Antike ideale Städte entworfen wurden, wie die Stadt der Phäaken in Homers Odyssee oder das Atlantis aus Platons Timaios und Kritias53, dann waren diese nicht zur konkreten Umsetzung bestimmt. Und inwieweit sich aus Vitruvs idealtypischen städtebaulichen Ansichten Handlungsanweisungen für die Praxis ableiten lassen, muss offen bleiben.
Die Imagination der Stadt ist vielmehr die Domäne der Neuzeit. Dass eine Stadt gar nur in Gedanken und in der Erzählung entstehen kann, das zeigen noch einmal die „unsichtbaren Städte“ des Italo CALVINO:
„Und doch habe ich in meinem Geiste ein Stadtmodell, von dem sämtliche möglichen Städte abzuleiten sind,“ sagte Kublai. „Dieses enthält alles, was der Regel entspricht. Da die existenten Städte sich in unterschiedlichem Maße von der Regel entfernen, brauche ich nur die Ausnahmen von der Regel in Betracht zu ziehen und die wahrscheinlichsten Kombinationen zu errechnen.“54
|29|Es gibt demnach eine gedankliche Möglichkeit, die Stadt an sich zu entwickeln und die realen Städte zu dieser mentalen Planstadt in Relation setzen. Dieser Wunsch nach Idealität und Abstraktion trifft sich mit dem Streben nach solchen architektonischen Utopien, die nicht selten auch Maßstäbe für die konkrete Fortentwicklung des Städtebaus setzen sollten. Das antike Rom ist zwar für die Römer eine ideale Stadt, aber keine Idealstadt, deren Stadtbild und Stadtplan sich einem großen Plan verdanken würde. Sie entspricht in der Realität viel mehr dem Gegenbild, mit dem CALVINOS Marco Polo den Vorstellungen des Kublai antwortet:
„Auch ich habe mir das Modell einer Stadt ausgedacht, von dem ich alles ableite“, antwortete Marco. „Es ist eine Stadt, die nur aus Ausnahmen, Ausschließungen, Gegensätzlichkeiten, Widersinnigkeiten besteht. Wenn eine solche Stadt das Unwahrscheinlichste ist, was es gibt, so erhöhen sich bei zahlenmäßiger Verringerung der abnormen Elemente die Wahrscheinlichkeiten, dass die Stadt wirklich besteht. Ich brauche also bei meinem Modell nur Ausnahmen zu subtrahieren und habe dann, gleichgültig nach welcher Reihenfolge ich vorgehe, eine von den Städten vor mir, die, wenn auch stets als Ausnahmeerscheinungen, existieren. Doch kann ich mein Unterfangen nicht über eine bestimmte Grenze vorantreiben: Ich würde Städte erhalten, die zu wahrscheinlich sind, um wahr zu sein.“55