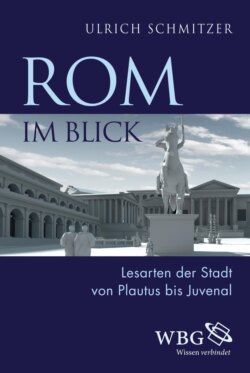Читать книгу Rom im Blick - Ulrich Schmitzer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|7|0 Vorwort
ОглавлениеHoc erat in votis: ein Buch, das die Begeisterung für die lateinische Literatur mit der Begeisterung für ihre Stadt, für Rom, zusammenführt. Die grundlegende Fragestellung, was die Literatur mit der urbanen Topographie und Architektur anstellt, wie sie diese aufgreift, von ihr geprägt wird, ihrerseits umschreibt und verändert, begleitet mich seit meiner Dissertation. Ich habe mich ihr in vielfacher Weise gewidmet, wie die im Literaturverzeichnis aufgeführten Publikationen belegen: Dieses Buch ist keine creatio ex nihilo, vielmehr die Synthese und Fortschreibung dieser jahrelangen Forschungen – nun ist ein vorläufiges Ende erreicht.
Dass aus diesen Vorarbeiten tatsächlich ein Buch werden konnte, hängt wesentlich mit dem Berliner Exzellenzcluster „Topoi – The Formation and Transformation of Space and Knowledge in Ancient Civilizations“ zusammen. Topoi gewährte mir durch Forschungssemester den zeitlichen Freiraum, der unter den aktuellen universitären Rahmenbedingungen für das Gelingen eines solchen Projekts unverzichtbar ist. Die Forschergruppen C IV „Ancient City Spaces“ (2007–2012; Sprecherin: Therese FUHRER) und C 6 „Cityscaping“ (seit 2012; Sprecherinnen: Susanne MUTH und Claudia TIERSCH) boten ein nicht hoch genug zu schätzendes Forum für die intensive Diskussion von Grundsatzfragen ebenso wie von archäologischen und althistorischen Einzelproblemen. Dass die dort erörterten Zugänge der modernen Stadtforschung nicht in größerem Umfang ausdrücklich in den Text eingeflossen sind, liegt an der Tatsache, dass sich sowohl bei der Lektüre als auch im persönlichen Kontakt zeigte, wie tief die Unterschiede zwischen antiken und nachantiken Städten sind, so dass sich die Ergebnisse der Urbanistik kaum deckungsgleich auf das antike Rom übertragen lassen. Als Hintergrund und Basis (sowie nicht zuletzt als Kontrastfolie) aber ist die Forschung über die moderne Stadt auch für diese Buch unverzichtbar.
Die Darstellung ist prinzipiell chronologisch angelegt. Innerhalb der historischen Epochengliederung wird nach literarischen Gattungen unterschieden. Primär werden Texte1 aus dem Bereich der Poesie behandelt, so dass auch die |8|inhaltliche Kohärenz gewahrt ist. Es wird sich nämlich zeigen, dass diese poetischen Zugriffe bei aller Divergenz doch auf einer vergleichbaren Basis operieren und sich darin von historiographischen und rhetorischen Formen der Stadtaneignung unterscheiden. Das wird exemplarisch anhand der präsallustischen Geschichtsschreibung entwickelt, um zum einen diesen Kontrast deutlich werden zu lassen und um zum anderen die gerade in der frühen Zeit schmale Materialbasis zu verbreitern.2 Ebenfalls zur Schärfung des Kontrasts dient die Einbeziehung von nach antikem Gattungsverständnis hoch stehenden Texten wie vor allem Vergils Aeneis, die einen höchst eigenständigen und eigenwilligen Zugriff auf die Stadt zeigt.3
Viele Einzelaspekte habe ich über die Jahre hinweg im Topoi-Kreis, bei Vorträgen im In- und Ausland (sogar in Rom selbst) und nicht zuletzt in Lehrveranstaltungen auf den Prüfstand stellen können. Allen, die durch Diskussionsbeiträge, kritische Anmerkungen, Fragen und Ergänzungen berichtigend gewirkt und zur Ausgestaltung beigetragen haben, sei dafür gedankt.
Julia RIETSCH von der WBG hat mein Projekt zu ihrem gemacht, mir aber dabei größtmögliche Freiheit gelassen. Das Digitale Forum Romanum hat in der Tradition bester nachbarschaftlicher Beziehungen die Illustrationen zur Verfügung gestellt, die den Wandel im urbanen Zentrum Roms über die Jahrhunderte belegen. Alle anderen – sparsam eingesetzten – Bilder stammen von mir.
|9|Die Literatur beschafft und den Text in seinem finalen Stadium kritisch gelesen haben Sandra DOBRITZ und Christin HARTWIG sowie Katharina MAREK. Besonders genau hingesehen hat Ulrike STEPHAN, viele Irrtümer korrigiert und eigene Beobachtungen beigetragen, so dass aus dem, was über die Jahre hinweg entstanden ist, ein konsistentes Ganzes werden konnte. Für die aufgewendete Mühe und die Sorgfalt sei ihnen allen von Herzen Dank gesagt. Wenn Unstimmigkeiten stehen geblieben sind, manche Aspekte noch nicht zu Ende gedacht erscheinen, vielleicht auch Wichtiges fehlt, dann trage ich dafür alleine die Verantwortung.
Gewidmet ist das Buch Elisabeth, Julius und Michael, mit denen ich hoffentlich noch oft Rom durchstreifen werde.
| Berlin, im Januar 2016 | Ulrich Schmitzer |
1 Sogar in der Klassischen Philologie hat sich in jüngerer Zeit die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Autor als reale historische Persönlichkeit und der Ich-Sprecher bzw. Ich-Er zähler eines Textes nicht identisch sind. Wenn ich also einfach von „Horaz“, „Ovid“, „Martial“ etc. spreche, dann meine ich natürlich die jeweilige literarische Rolle, die sei einnehmen, nicht unmittelbare Herzensergießungen eines Poeten. Ohne in alte biographistische Konzepte zurückzufallen, hoffe ich, damit der Lesbarkeit gedient zu haben (in einigen Fällen, in denen es besonders darauf ankommt, habe ich das dennoch explizit gemacht).
2 Friederike SENKBEIL wird in ihrer im Rahmen von Topoi entstehenden Dissertation das Forum Romanum in der kaiserzeitlichen Literatur untersuchen und auf diese Weise die hier gegebenen Analysen wesentlich ergänzen.
3 Es werden die üblichen Abkürzungen verwendet: für lateinische Autoren des Thesaurus linguae Latinae (prinzipiell sind auch die dort genannten Standardausgaben zugrunde gelegt, wobei die Schreibweise vereinheitlicht wurde), für griechische Autoren des Neuen Pauly, für Zeitschriften und Reihen der Année philologique. Soweit online-Literatur verwendet wurde, sind die Links allesamt 2015 überprüft worden und haben zu diesem Zeitpunkt funktioniert. Abschnitte im Petitdruck dienen der Information für Leser, die nicht aus dem engeren fachwissenschaftlichen Umfeld kommen, legen aber gleichzeitig die der Interpretation zugrunde liegenden Prämissen offen. Die Übersetzungen sind, soweit nicht anders angegeben, von mir eigens für diese Untersuchung angefertigt und stehen im Dienst der hier vertretenen Interpretation, nähern sich nötigenfalls deshalb Paraphrasen und erheben ganz und gar nicht definitiven oder gar literarischen Anspruch. Dass schließlich die Bibliographie – so umfangreich sie geworden ist – nur einen Bruchteil der Forschung über die hier behandelten Autoren und die Stadt Rom repräsentieren kann, versteht sich von selbst.