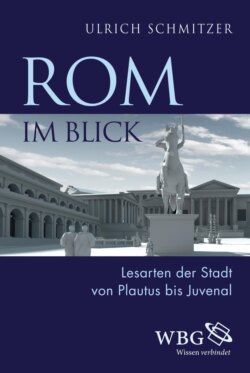Читать книгу Rom im Blick - Ulrich Schmitzer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|16|2 Die Stadt und ihre Städte: Grundlegungen 2.1 Kreis, Quadrat und Körper: Die Stadt wird zum Konzept
ОглавлениеEine Stadt1 ist eine Stadt, wenn sie nach dem vollständig beachteten religiösen Ritus einer Stadtgründung gegründet ist (Abb. 1).2 Das ist die Quintessenz dessen, was die römische Gelehrsamkeit über das Wesen der Stadt zusammengetragen hat. So schreibt Cato Censorius im 2. Jahrhundert v. Chr. so knapp wie bündig und ohne die Möglichkeit einer Alternative oder gar eines Widerspruchs zu eröffnen (orig. 1,18):
qui urbem novam condet, tauro et vacca aret; ubi araverit, murum faciat; ubi portam vult esse, aratrum sustollat et portet et portam vocet. Wer eine neue Stadt gründet, der soll mit einem Stier und einer Kuh pflügen. Wo er gepflügt hat, soll er die Mauer errichten; wo er ein Tor haben möchte, soll er den Pflug hochheben und tragen und dies „Tor“ (d.h. porta von portare) nennen.
Gut ein Jahrhundert nach Cato führt der Universalgelehrte Varro diese Bemerkungen weiter aus. Der zum System ausgebaute etymologische Rahmen bringt gemäß dem vom Hellenismus inspirierten aktuellen Wissenschaftsverständnis die bezeichnete Sache und deren lautliche Gestalt zusammen und liefert die tiefere Begründung für die sichtbaren Ereignisse (l.l. 5,143):
|17|Abb. 1: Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano: Sella Curulis aus antoninischer Zeit mit Stadtgründungsszene
oppida condebant in Latio Etrusco ritu multi, id est iunctis bobus, tauro et vacca, interiore aratro circumagebant sulcum (hoc faciebant religionis causa die auspicato), ut fossa et muro essent muniti. terram unde exculpserant, fossam vocabant et introrsum iactam murum. post ea qui fiebat orbis, urbis principium; qui quod erat post murum, postmoerium dictum, †eius† que auspicia urbana finiuntur. cippi pomeri stant et circum Ariciam et circ[o]um Romam. quare et oppida quae prius erant circumducta aratro ab orbe et urvo urbes; ideo coloniae nostrae omnes in litteris antiquis scribuntur urbis, quod item conditae ut Roma, et ideo coloniae et urbes conduntur, quod intra pomerium ponuntur.
Städte gründeten in Latium viele nach etruskischem Ritus, das heißt mit zusammengespannten Rindern, einem Stier und einer Kuh, zogen sie mit der inneren Pflugschar eine Furche (das taten sie wegen der Beachtung der religiösen Vorschriften an einem durch Vogelschau begründeten Tag), so dass sie mit einem Graben und einer Mauer beschützt waren. Von wo sie die Erde ausgegraben hatten, das nannten sie „Graben“ (d.h. fossa von fodere) und die nach innen geworfene Erde (nannten sie) „Mauer“. Danach war der Kreis, der dabei entstand, der Anfang der Stadt, der, weil er hinter der Mauer (murus) war, postmoerium genannt wurde, und (so wurde) die Einholung der zur Stadt |18|gehörigen Vorzeichen beendet. Die Grenzsteine des Pomeriums stehen rings um Aricia und rings um Rom. Deshalb sind auch die Städte, die vorher mit dem Pflug umgrenzt worden waren, vom Kreis (orbis) und von der Krümmung des Pfluges (urvus) urbes genannt; deshalb werden auch alle unsere Kolonien in den alten Schriften urbes genannt, weil sie ebenso gegründet sind wie Rom, und deshalb werden Kolonien und urbes gegründet, weil sie in ein Pomerium gesetzt sind.
Eine Stadt, so also auch Varro, ist dann eine Stadt, wenn sie unter Beachtung der religiösen Riten ordnungsgemäß gegründet ist (das ist das in condere enthaltene Konzept), unabhängig von ihrer Größe – zwischen Rom und Aricia konnten die Unterschiede größer kaum sein – und von einem juristisch gegebenen Stadtrecht: Die römischen coloniae, von denen Varro spricht, waren eben nicht eigenständig, sondern befanden sich in einem komplexen Abhängigkeitsverhältnis von Rom,3 dennoch bezeichnet sie Varro als urbes. Mit diesem rituellen Gründungsakt untrennbar verbunden ist die Unterscheidung zwischen „drinnen“ (domi) und „draußen“ (foris/militiae)4 konstituiert: Was „drinnen“ ist, gehört zur Stadt, was „draußen“ ist, eben nicht5, selbst wenn es über die religiöse Stadtgrenze (pomerium) hinweg keinen architektonischen Bruch gibt. Dass etwa das gesamte Marsfeld außerhalb des Pomerium lag und damit nicht zur Stadt gehörte, spielte im Alltag keine Rolle, wohl aber bei rituellen Ereignissen wie dem Triumphzug.
Dieses formale, auf den Gründungsakt und dessen Ritus abhebende Verständnis von dem, was die Stadt zur Stadt macht, blieb trotz aller sachlichen Veränderungen die Kaiserzeit hindurch6 bis in die Spätantike bestehen. Noch um 400 n. Chr. kann der Vergilkommentator Servius seinen Lesern das Wesen der Stadt mit fast den gleichen Worten wie Cato und Varro nahe bringen, urbs, orbis sowie urvus zusammenstellen und daraus das Verständnis des Städtischen ableiten.7 All diese auf den ersten Blick tautologisch anmutenden Definitionen machen nachdrücklich deutlich, was |19|nach römischer Auffassung das Entscheidende für die Akzeptanz einer Siedlung als Stadt ausmacht, nämlich die Genese aus einem religiösen Ritual.8
Aber orbis bedeutet noch mehr, es steht auch für den „Erdkreis“, den Kosmos.9 Und die Stadt ist nicht nur in den Kreis eingeschrieben, sondern eben auch in den Kosmos, wie vor allem Ovid in konsequenter Weiterentwicklung republikanischer Konzepte formulierte. Rom wird sogar mit dem Weltkreis gleichgesetzt (ars 1,174): orbis in urbe heißt nun, dass die Stadt Rom den Kosmos in sich aufnimmt.10 In Rom ist alles repräsentiert, was es an Städtischem weltweit gibt11 (und weltweit heißt: soweit sich das Imperium Romanum erstreckt12). Umgekehrt wird es damit zum Abbild des Kosmos im Kleinen (Ov. fast. 2,684): Romanae spatium est urbis et orbis idem („Der Raum der Stadt Rom ist zugleich der Erdkreis“).
Die zum Kreis13 komplementäre geometrische Figur ist das Quadrat, wie sich paradigmatisch aus der berühmt gewordenen Beschreibung des homo bene figuratus bei Vitruv (3,1,1) ablesen lässt.14 Kreis und Quadrat spielen auch für die Vorstellung von der ursprünglichen Gestalt der Stadt eine einander ergänzende Rolle. Denn zum Konzept der kreisrunden Gründung Roms tritt das quadratische templum, die Roma quadrata, auf dem Palatin.15 Beide idealtypischen Formen schließen einander nicht aus, |20|wie zwei eng benachbarte Passagen aus Plutarchs Romulus-Vita belegen, wo es um die Gründungsgeschichte Roms geht (9,4 und 11,2):
‘Ρωμύλος μὲν οὖν την καλουμένην ‘ρώμην κουαδράταν (ὅπερ ἐστì τετράγωνον) ἔκτισε, καì ἐκεῖνον ἐβούλετο πολίζενν τòν τόπιν.
Romulus gründete also die so genannte Roma quadrata (also die viereckige), und er wollte jenen Ort besiedeln.
ὥσπερ κύκλον κέντρῳ περιέγραψαν τὴν πόλιν.
Wie einen Kreis mit Mittelpunkt umzeichneten sie die Stadt.
Die historische Erzählung Plutarchs nähert sich nämlich erstaunlich eng dem Bild einer idealen Stadt an, das mit geometrischer (und auch meteorologischer) Genauigkeit von Vitruv im ersten Buch von de architectura entwickelt wird. Das zeigt zugleich, dass auch die Erzählung von den konkreten Vorgängen der Stadtgründung abstrakten Vorstellungen darüber verpflichtet ist, wie eine Stadt auszusehen hat. Solche Ansätze reichen weit in die griechische Vergangenheit zurück, bis zur dem Hippodamos von Milet (5. Jahrhundert v. Chr.)16 zugeschriebenen Idealstadt.17 Vitruv arbeitet diese Ansätze theoretisch aus und führt das Konzept fort. Und ganz praktisch integrieren auf der anderen Seite sogar die römischen Militärlager18 – geprägt von decumanus und cardo – diese griechischen Vorstellungen in die römische Welt.
Solchen abstrahierten und ins Idealtypische gesteigerten Vorstellungen gegenüber ist schon bei einem flüchtigen Blick auf den Stadtplan des antiken Rom zu erkennen, dass die tatsächliche Gestalt der urbs Roma ganz und gar nicht von diesen geometrischen Figuren definiert ist. Dennoch ist die Vorstellung für das antike Denken prägend, aber auch für neuzeitliche Vorstellungen von Rom, wobei den Autoren meist die besonders aus Martial und Juvenal extrapolierte Realität des römischen Lebens als Gegenbild zum Ideal bewusst ist.19
Von diesen konzeptuellen Vorstellungen unterschiedlicher Provenienz hatte entsprechend den Strukturen römischen Denkens vor allem die religiöse Komponente tatsächliche Auswirkungen. Jede Veränderung |21|und Ausweitung des sakralen Stadtgebiets, des Pomerium20, bedurfte eines formalen religiösen Aktes, selbst als Rom in der Kaiserzeit eine Millionenstadt geworden war.21 Und große Teile der tatsächlich bebauten Struktur blieben auf Dauer aus der urbs ausgeschlossen; das Marsfeld22 oder Trastevere etwa waren in der Antike nicht in das Pomerium einbezogen.
Dass die urbs nicht nur ein symbolischer und sozialer Raum ist, sondern sich durch ihr Terrain definiert, zeigt sich konsequenterweise auch, wenn es um den Ausschluss von Menschen aus dem städtischen Verband und der damit verbundenen sakralen Gemeinschaft geht. Die Verbannung (exilium) ist ganz konkret die Entfernung von dem Grund und Boden, auf dem die Stadt gelegen ist (Cassiodor, orth. 1, p. 203,22):23
exilium cum ‚s‘ scribi debet (ex solo enim ire est exsolare), quasi exsolium, quod Graeci ἐξορνσμόν dicunt; antiqui exsoles dicebant, quos nos exsules dicimus.
Exilium schreibt man mit s (in der Mitte), es ist nämlich von ex solo ire abgeleitet, also gleichsam exsolium; was die Griechen ἐξορνσμόν nennen. In alter Zeit nannte man solche exsoles („außerhalb des Bodens Befindliche“), die wir exsules („Verbannte“) nennen.
Die Selbstdefinition über das Religiöse führt dazu, dass anders als im Mittelalter (und noch in der Neuzeit)24 die tatsächliche Stadtmauer in Rom nicht entscheidend ist.25 Auch nicht die Größe, nicht das Stadtrecht wie im Mittelalter, nicht die Erfüllung zentraler Aufgaben26, sondern eben die Beachtung ritueller Vorschriften bei der Gründung konstituieren die Stadt. Somit definiert sich Rom bis in die Spätantike hinein auch nicht |22|(wie die griechische πόλις) über den Personenverband27, der sich (zumindest potenziell) zur Beratung und Beschlussfassung an einem Versammlungsort traf. Die Teilnahme an den differenzierten Formen der politischen Versammlungen war zwar untrennbar mit der römischen civitas verknüpft, hatte aber nur losen Zusammenhang mit der urbs: Bürgerschaft sowie Bürgerrecht sind in der klassischen Zeit der Republik von der Stadt in ihrer konkreten räumlichen, eben religiös definierten Gestalt zu unterscheiden.28
Diese aus der Definition gewonnene normative Vorstellung der Gestalt der Stadt Rom steht in Kontrast zur baulichen Realität. Nachdem der republikanische Mauerring29 seine Bedeutung für die Sicherheit verloren hatte, da Rom zur ungefährdeten Zentralmacht in Italien aufgestiegen war, gab es nur praktische, nicht prinzipielle Beschränkungen für das Wachstum.30 So wurde im Lauf der Zeit der Campus Martius mit (gehobenen) Wohngebäuden gefüllt oder zur Zeit des Augustus der ehemalige Schindanger auf dem Esquilin saniert und zu einem luftigen und lichten Stadtquartier umgestaltet. Erst mit dem Bau der Aurelianischen Mauer31 am Ende des 3. Jahrhunderts begannen sich die Verhältnisse zu ändern. Sie war geplant als rasch ausführbare Verteidigungsmaßnahme in der heraufziehenden Völkerwanderungszeit und orientierte sich deshalb in ihrem Verlauf an pragmatischen Gegebenheiten, v.a. an vorhandenen Bauwerken wie der Cestiuspyramide oder der Aqua Claudia (an der Porta Maggiore). Doch entwickelte sich durch sie die bis in die Gegenwart reichende Scheidung von dentro und fuori le mura.32 Und so konnten auch in den mittelalterlichen Stadtbeschreibungen sowie im Städtelob die Mauern und Türme zu einem wichtigen, manchmal sogar zum wichtigsten Merkmal der Stadt Rom werden.33
|23|Ein letzter Aspekt: Die religiöse, ästhetische und geometrische Rationalität steht in spannungsvoller Relation zur Vorstellung von der Stadt als Körper, wie sie sich im Zusammenhang mit der secessio plebis auf den Mons Sacer34 zeigte, die der Überlieferung nach 494 v. Chr. stattfand. Die Rede des Menenius Agrippa (Liv. 2,32,8–12) über den als Körper gedachten Staat und die unterschiedlichen Aufgaben der Körperteile35 im metaphorischen Staatsganzen hätte zu einer solchen Denkfigur führen können, aber es blieb bei diesem einen, wenngleich prominenten Ansatz.