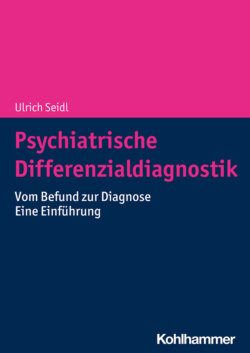Читать книгу Psychiatrische Differenzialdiagnostik - Ulrich Seidl - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Zum Begriff der Neurose
ОглавлениеDer historische Begriff der Neurose taucht in den modernen Klassifikationen noch immer gelegentlich auf, so im Kapitel ›Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen‹, als ›psychoneurotisch‹ unter den sonstigen spezifischen Persönlichkeitsstörungen der ICD-10 oder an derselben Stelle als ›Charakterneurose‹. Der Begriff impliziert einen bestimmten Zusammenhang zwischen beobachtbarer Symptomatik und deren Entstehung, nimmt also Bezug auf zugrunde liegende theoretische Annahmen. Im Laufe der Psychiatriegeschichte wurden unterschiedliche Gründe für die Entstehung neurotischer Symptome angenommen. Die Verwendung des Neurose-Begriffs kann auch heute noch angebracht sein, wenn explizit auf die psychogene Ursache von Beschwerden verwiesen werden soll – auch wenn die theoretischen Annahmen, die dem Begriff zugrunde liegen, uneinheitlich und teilweise überholt sind.
Wandel des Neurose-Begriffs
Ursprünglich wird der Neurose-Begriff 1776 von William Cullen (1710–1790) verwendet, der damit alle nichtentzündlichen Erkrankungen des Nervensystems bezeichnet und hierunter auch die psychischen Erkrankungen subsumiert. Als Neurosen gelten dann anatomisch-strukturelle Schäden mit einer Störung von Sensibilität und Motorik, später funktionell-physiologischen Störungen mit Irritabilität und Inhibition und schließlich Krankheitsbilder mit psychogenen Ursachen (Übersicht bei Berrios 1999). Interessanterweise bezeichnet der Begriff Psychose in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts subjektive Zustände als Begleiterscheinungen schwerer psychischer Krankheiten, während Neurose die zugrunde liegenden neurologischen Prozesse bezeichnete. Um 1900 herum kommt es zum Wechsel der Begrifflichkeiten. Psychose bezeichnete von nun an im weiteren Sinne organische Krankheiten, Neurose dagegen innerpsychische Vorgänge.
Psychoanalytische Auffassung
Die Auffassung einer psychogenen Grundlage von Neurosen bezieht sich auf Aspekte der kindlichen Entwicklung. Das neurotische Verhalten kann als Anpassungsleistung verstanden werden, die zum Zeitpunkt ihrer Entwicklung für den Betroffenen durchaus nützlich war, im späteren Leben jedoch unpassend und dysfunktional in Erscheinung tritt. Im psychoanalytischen Verständnis liegen den Neurosen demgemäß (unbewusste) kindliche Konflikte oder Erschütterungen zugrunde, die zunächst eine kompromisshafte Lösung erfahren, später jedoch störend in Erscheinung treten können. Ihrem Ursprung nach sind sie weiterhin in gewisser Weise sinnhaft, da sie einen innerpsychischen Lösungsversuch darstellen. Der sonst in diesem Zusammenhang gebräuchliche Trauma-Begriff wird hier bewusst vermieden, da dieser um der Klarheit willen für Situationen außergewöhnlicher Bedrohung reserviert bleiben und nicht inflationär gebraucht werden sollte.
Neurosenlehre und Psychosen
Die Ausdehnung der Neurosenlehre auf Psychosen greift zu weit und wird der komplexen Ätiologie von Psychosen, die auch organische Faktoren umfasst, nicht gerecht. Schon Sigmund Freud (1856–1939) musste erkennen, dass die psychoanalytische Herangehensweise bei psychotischen Patienten nicht zielführend ist, und hat sich entsprechend auf die Behandlung nicht-psychotischer Patienten konzentriert und ausgehend von diesen seine Theorien entwickelt. Eine unkritische Anwendung psychoanalytischer Modelle auf Psychosen einschließlich psychotischer Unterformen affektiver Störungen ist deshalb nicht sinnvoll.
Charakterneurose
Der Begriff Charakterneurose bezieht sich auf die Annahme, dass die Persönlichkeit durch neurotische Mechanismen in ihrer Entwicklung derart gestört und dadurch verformt wurde, dass dies zur Persönlichkeitsstörung geführt hat. Eine derartige Bezeichnung muss freilich als sehr theorielastig gelten. Sie impliziert, dass die Persönlichkeitsentwicklung nicht von multiplen Faktoren (Genetik, Umwelt, Erziehung, Beziehungserfahrungen etc.), sondern vor allem durch dysfunktionale (neurotische) Konfliktlösungen geprägt wurde. Da diese Sicht sehr einseitig ist, sollte der Begriff zugunsten beschreibender Ansätze in der Persönlichkeitsdiagnostik ( Kap. 4.8.1) vermieden werden.
Verwendung des Neurose-Begriffs
Der Begriff Neurose ist in der Alltagssprache etabliert und wird regelmäßig mit bestimmten Begriffen in Zusammenhang gebracht, was gelegentlich zur Verwirrung führt. Dies lässt sich gut anhand der »Zwangsneurose« illustrieren, eines Ausdrucks, der von Sigmund Freud geprägt wurde und allgemein mit Zwangsstörungen assoziiert wird. Freud führt unter anderem im klassischen Fallbeispiel vom »Rattenmann« die Zwangsgedanken eines Patienten ursächlich auf dessen kindliche sexuelle Wünsche in Verbindung mit der Furcht vor negativen Konsequenzen zurück. Nicht zuletzt durch die Theorien Freuds (und nicht nur unter medizinischen Laien) hält sich die klischeehafte Ansicht, dass Zwänge prinzipiell neurotisch seien, also ihre Ursache in frühen Konflikten haben, die es aufzulösen gilt. Tatsächlich jedoch sind Zwangsphänomene vielgestaltig und können unterschiedliche, auch organische, Ursachen haben. Die Behandlung erfolgt dementsprechend heutzutage nicht primär psychoanalytisch, sondern verhaltenstherapeutisch, gegebenenfalls unterstützt durch eine medikamentöse Therapie. Von einer Neurose sollte also nur dann noch gesprochen werden, wenn damit explizit auf das zugrunde liegende Störungsmodell Bezug genommen wird. Entsprechend ist nicht nur der Begriff Zwangsneurose allgemein durch Zwangsstörung ersetzt worden. Weitgehend obsolet geworden sind auch Begriffe wie Konversionsneurose (heute: dissoziative Störung) oder Angstneurose (heute: Angststörung).