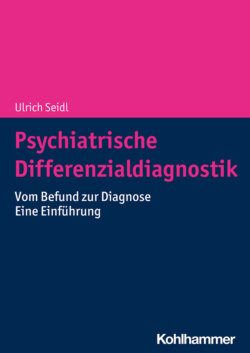Читать книгу Psychiatrische Differenzialdiagnostik - Ulrich Seidl - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.5 Krankheitsursachen
ОглавлениеWarum ist es sinnvoll, sich in der Psychiatrie mit der Ursache von Krankheiten zu beschäftigen? Würde es nicht genügen, wenn wir die Symptome in Querschnitt und Längsschnitt betrachten und daraus eine Diagnose ableiten? Ist es überhaupt möglich, klare Ursachen zu bestimmen? Und kann sich die Therapie am Ende nicht ganz einfach nach den Symptomen richten?
Gründe für die Beschäftigung mit Krankheitsursachen
Für die Beschäftigung mit Krankheitsursachen gibt es mehrere Gründe. Erstens ist es für ein grundlegendes Verständnis psychiatrischer Erkrankungen wichtig, sich prinzipiell damit auseinanderzusetzen, wie diese entstehen können. Ich beginne den Unterricht deshalb gerne mit diesem Thema, um den Einstieg in die komplexe Welt der Psychiatrie zu erleichtern. Zweitens verlangt die diagnostische Zuordnung im Rahmen der gängigen Klassifikationssysteme sehr wohl ätiologische Überlegungen. Und drittens beeinflusst eine Hypothese über Krankheitsursachen im Allgemeinen oder im speziellen Falle eines Patienten in wesentlichem Maße das therapeutische Vorgehen. Natürlich lässt sich nicht in allen Fällen eine eindeutige Ursache bestimmen, aber das sollte uns nicht davon abhalten, uns auf die Suche zu begeben. Auf diese Punkte wird im Folgenden etwas genauer eingegangen.
Dualismus von Soma und Psyche
Beginnen wir mit den grundlegenden Möglichkeiten, wie psychiatrischen Krankheiten entstehen können. Entsprechend dem Dualismus von Soma und Psyche zieht sich durch die Geschichte der Medizin die Überlegung, ob eine psychische Krankheit nun körperliche oder innerpsychische Ursachen hat ( Kap. 1.6). Selbst wenn äußere Einflüsse als zusätzlicher, außerhalb der Person liegender Faktor eingezogen werden, kann doch unterschieden werden, ob diese sich auf den Körper (z. B. Rauschmittel, Umweltgifte) oder auf die Psyche (z. B. soziale Konflikte, gesellschaftliche Rahmenbedingungen) auswirken. Auch wenn wir davon ausgehen, dass Soma und Psyche hinsichtlich Ursache und Wirkung untrennbar miteinander verbunden sind und sich wechselnd gegenseitig beeinflussen, bleibt doch die Frage nach dem Ausgangspunkt einer Krankheit.
Ursache und klinische Symptomatik
Gelegentlich wird vorgebracht, dass die klinische Symptomatik entscheidend und es demnach gleichgültig ist, wie sie entstanden ist. Es wird der Vergleich mit körperlichen Vorgängen gezogen und argumentiert, dass bei einer Fraktur der Unfallhergang sekundär und die Folgen entscheidend sind. Dieser Vergleich hat seine Tücken, denn er geht davon aus, dass psychische Erscheinungen unabhängig von der Ursache völlig gleichförmig seien. Dem ist allerdings nicht so. Die klinischen Bilder lassen sich je nach zugrunde liegender Ursache durchaus unterscheiden. Bedeutsam ist dies etwa beim depressiven Syndrom, das sich je nach Grundlage unterschiedlich präsentiert. Auch auf dem Gebiet der Denkstörungen lassen sich bei genauem Hinschauen verschiedene Qualitäten ausmachen, die mit der Ätiologie in Zusammenhang stehen.
Körperliche Ursachen
Die Erkenntnis, dass eine Symptomatik auf psychischem Gebiet auch körperliche Ursachen haben kann, setzt das Wissen um einen Zusammenhang zwischen beiden Bereichen voraus. Was uns heute selbstverständlich erscheint, ist jedoch ein großer Schritt in der Erkenntnis, der schon früh vollzogen wurde. Die in der Antike entwickelte und über Jahrhunderte hinweg vertretene Humoralpathologie ist hier beispielhaft zu nennen. Galenos von Pergamon (ca. 130–200 n. Chr.) ordnet dabei den vier Körpersäften Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim jeweils Charaktereigenschaften zu. Er stellt damit nicht nur einen Zusammenhang zwischen Soma und Psyche her, sondern bemüht sich auch um eine Ordnung und Differenzierung. Aus heutiger Sicht mögen uns die Annahmen naiv erscheinen, doch zugrunde liegt der (sehr moderne) Ansatz, verschiedene psychische Erscheinungen auf ihre jeweilige körperliche Grundlage zurückzuführen. Heutzutage ist die Suche nach neurobiologischen Korrelaten, etwa strukturellen oder funktionellen zerebralen Veränderungen, ein wesentlicher Teil der psychiatrischen Grundlagenforschung. Wenn wir nun davon ausgehen können, dass eine Krankheit auf eine klar zu benennende organische Ursache zurückzuführen ist, können wir diese als exogen bezeichnen. Ihrem Wesen nach muss es sich bei einer derartigen Krankheit um eine Psychose handeln, da die Symptomatik nicht einfühlend verstehbar, sondern aus den funktionellen oder strukturellen Veränderungen des Gehirns heraus erklärbar ist ( Kap. 1.3). Nicht alle Psychosen lassen sich jedoch auf eine klare organische Ursache zurückführen. Dennoch ist davon auszugehen, dass unter den vielfältigen Ursachen neben psychosozialen und innenpsychischen nicht zuletzt auch grundlegende neurobiologische Faktoren sind. Für diese Fälle wurde traditionell der Begriff endogen verwendet.
Psychische Ursachen
Wenn als grundlegend für eine Krankheit dagegen vor allem psychische Prozesse angenommen werden, so können wir diese als psychogen bezeichnen. Hier können Konflikte ebenso wie gesellschaftliche Rahmenbedingungen oder Lebensereignisse als Einflussfaktoren in Betracht gezogen werden, möglicherweise auf dem Boden bestimmter Persönlichkeitseigenschaften. Ein großer Teil der Psychologie des 20. Jahrhunderts beschäftigt sich mit der Frage nach krankmachenden innenpsychischen Prozessen, maßgeblich beeinflusst durch die Theorien Sigmund Freuds. Dieser entwickelte seine Theorien allerdings zum Verständnis normalpsychologischer Zusammenhänge. Eine Übertragung auf Psychosen ist damit nicht ohne weiteres möglich. Freud selbst stieß bei der Behandlung psychotischer Patienten rasch an seine Grenzen und hat diese nicht weiter verfolgt. Zur Verwirrung kann beitragen, dass er beispielsweise bei ausgeprägter Zwanghaftigkeit von ›Psychose‹ sprach, den Begriff also anders verwendetet, als wir es in diesem Buch tun.
Triadisches System
Die Dreiteilung psychiatrischer Krankheiten nach ihren möglichen Ursachen in exogen, endogen und psychogen wird als triadisches System bezeichnet. Das triadische System mag auf den ersten Blick zu stark vereinfachend und nur noch historisch interessant erscheinen. Es stellt jedoch die Grundlage der Differenzialdiagnostik dar, ebenso wie die Abgrenzung der Psychose als grundsätzlich eigener Qualität der psychischen Verfassung und damit die grundlegende Unterscheidung zwischen Psychose und Nicht-Psychose. Die meisten Krankheiten lassen sich zwanglos auf diese Weise einordnen, zumal unserer heutigen Klassifikation noch immer die durch das triadische System vorgegebene Einteilung zugrunde liegt.
Psychosen und affektive Störungen
Besonders bedeutsam ist die Suche nach Krankheitsursachen einerseits bei den Psychosen, andererseits bei den affektiven Störungen. Für die Differenzialdiagnostik bedeutet dies, dass zunächst einmal festgestellt werden muss, ob überhaupt eine Psychose vorliegt oder nicht. Wenn eine Psychose festgestellt wurde, ist eine organische Diagnostik erforderlich, um eine primär organische Ursache zu erkennen oder auszuschließen ( Kap. 2.9). Beim Vorliegen eines depressiven oder eines manischen Syndroms ist die Frage nach den Ursachen der Symptomatik entscheidend für das weitere Vorgehen. Verständlicherweise ist es buchstäblich ein grundlegender Unterschied, ob eine Depressivität kausal auf eine funktionelle oder strukturelle Störung des Gehirns zurückgeht (organische affektive Störung), ob sich im Rahmen eines multikausalen Geschehens auf biologischer Basis eine schwere Krankheit entwickelt (schwere depressive Episode, typischerweise mit somatischem Syndrom) oder ob das Leiden vor allem auf einschneidende Änderungen der Lebenssituation zurückzuführen ist (Anpassungsstörung mit depressiver Reaktion). Aber auch bei anderen klinischen Syndromen, gerade in den unklaren Fällen, gilt es, im Ausschlussverfahren nach den Ursachen zu suchen ( Kap. 2.8).
Grenzen der Ursachensuche
In der Regel wird es gelingen, zwischen körperlichen und psychischen Ursachen zu unterscheiden. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, bei denen somatische und psychische Ursachen nicht klar zu trennen sind – oder möglicherweise in unterschiedlichem Ausmaß beides eine Rolle spielt. Hier sind etwa Zwangsstörungen zu nennen, die in Schwere und Symptomatik äußerst unterschiedlich ausgeprägt sein können und für die sich je nach Einzelfall verschiedene Erklärungen finden. Einen weiteren Sonderfall stellen Störungen der Persönlichkeit dar (die wir allerdings auch nicht als Krankheiten im eigentlichen Sinne bezeichnen würden), denn hier kommen wir nicht zu einer klaren Zuschreibung. Denn über die Frage, welche Faktoren zur Entwicklung der Persönlichkeit beitragen, lässt sich lange diskutieren. Letztlich muss von zahlreichen Einflussfaktoren ausgegangen werden, die sowohl biologische Faktoren als auch biologische und soziale Umwelteinflüsse ebenso wie innenpsychische Faktoren umfasst. Dabei kann durchaus eine biologisch vorgegebene Grundstruktur angenommen werden, die in gewissem Rahmen durch äußere Einflüsse modifiziert werden kann. Für unser praktisches Vorgehen haben diese Überlegungen jedoch insofern nur eine untergeordnete Relevanz, da wir gewohnt sind, die Persönlichkeit als therapeutisch nur sehr begrenzt beeinflussbar zu sehen. Entsprechend werden wir den (möglicherweise biologisch determinierten) Kern nicht ändern, Modifikationen auf Ebene der Kognition oder des Verhaltens im Sinne eines Umlernens sind dagegen durchaus möglich.
Bedeutung für die Therapie
Die Therapie sollte sich also nicht nur nach der klinischen Symptomatik richten, sondern auch nach der Krankheitsursache. Bei den exogenen Krankheiten liegt das auf der Hand: wenn das Gehirn geschädigt ist, muss ich somatisch behandeln oder zumindest versuchen, eine Verschlechterung der körperlichen Situation zu verhindern. Eine therapeutische Intervention kann durchaus auf symptomatischer Ebene ansetzen, etwa medikamentös, oder es kann der Versuch unternommen werden, die Krankheitserscheinungen und ihre Folgen psychotherapeutisch abzufangen. Dies geschieht jedoch im Wissen, dass ich mit diesen Maßnahmen das Übel sozusagen nicht an der Wurzel packen kann. In jedem Falle also hat meine Ursachenzuschreibung therapeutische Konsequenzen. Wenn ich von einer körperlichen Ursache ausgehe, werde ich auch eher körperlich behandeln. (Heutzutage vor allem durch Medikamente, Neurostimulation oder andere biologische Verfahren.) Wenn ich dagegen krankmachende äußere Einflussfaktoren annehme versuche ich möglicherweise präventiv, diese auszuschalten. (In einer radikalen Form wurde dies im Zuge der Antipsychiatrie-Bewegung in den 1970er Jahren gelebt, als unter der Annahme, dass psychischen Krankheiten Folge der gesellschaftlichen Verhältnisse seien, eine schulmedizinische Therapie abgelehnt und stattdessen mit den Patienten eine Mischung aus alternativer Lebensform und politischer Agitation praktiziert wurde.) Wenn ich dagegen feststelle, dass Leid auf innerpsychischen Prozessen beruht, werde ich versuchen, diese psychotherapeutisch zu klären und zu lösen. Zwar strebt eine moderne Sicht nach einer Überwindung dieser Einseitigkeit, und die Gabe von Medikamenten schließt natürlich keine Psychotherapie aus. Eine therapeutische Schwerpunktsetzung ist im Einzelfall dennoch sinnvoll.
Gegenseitige Beeinflussung von Soma und Psyche
Heutzutage erscheint eine strenge Ursachenzuschreibung auf den ersten Blick überholt, da wir gewohnt sind, von multifaktoriellen Geschehnissen auszugehen und Wechselwirkungen zwischen Soma und Psyche annehmen, bei denen sich Ursache und Wirkung nicht klar trennen lassen (etwa wenn psychische Faktoren dazu führen, dass unser neuronales Netz moduliert wird, was wiederum auf die Psyche zurückwirkt). Wo wir hier angreifen, erscheint beliebig: dies kann dann sowohl auf neurobiologischer Ebene stattfinden (etwa durch Medikamente oder Modulation mittels Stimulationsverfahren) als auch durch psychotherapeutische Einflussnahme – letztlich beeinflusst sich alles gegenseitig, der Ansatzpunkt wäre demgemäß nicht wesentlich und die Wirkung vergleichbar. Studien mit bildgebenden Verfahren scheinen dies zu belegen, wenn sie zeigen, dass sowohl Psychotherapie als auch medikamentöse Therapie die Funktion neuronaler Kreisläufe bei Patienten mit depressiver Episode modifiziert, wenn auch in verschiedenen zerebralen Bereichen (Boccia et al. 2016). Dennoch ist es wichtig, sich immer wieder über mögliche Ursachen Gedanken zu machen. Der klinische Alltag zeigt, dass in aller Regel eine Zuordnung durchaus möglich ist. Der Umstand, dass dies nicht bei allen Patienten mühelos gelingt, darf jedenfalls nicht dazu führen, auf jede Ursachenzuschreibung generell zu verzichten. Wenn ein Patient unter einer Erkrankung leidet, die nach allem, was wir heute wissen, auf dem Boden einer biologischen Verletzlichkeit entstanden ist und bei der der vorsichtige Einsatz bestimmter Medikamente nachgewiesenermaßen hilfreich ist, dann ist es verkehrt, diesem Patienten ausschließlich Psychotherapie anzubieten. Wenn ein anderer Patient dagegen unter einer Symptomatik leidet, deren Auflösung Umlernen und Veränderungen erfordern würden, dann können Medikamente keine Psychotherapie ersetzen, sondern bestenfalls auf Symptomebene eine kurzfristige Erleichterung bringen.