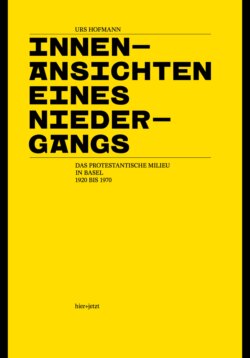Читать книгу Innenansichten eines Niedergangs - Urs Hofmann - Страница 11
1 – 1
ОглавлениеMENTALITÄTEN IN DER KIRCHEN- UND RELIGIONSGESCHICHTE
Seit den 1980er-Jahren findet vor allem in Deutschland eine andauernde Diskussion über die akzeptierten Aufgaben und Möglichkeiten der Mentalitätsgeschichte statt. Der von Ulrich Raulff herausgegebene Sammelband «Mentalitäten-Geschichte» wirkt seit 1987 als Standortbestimmung und Referenzpunkt zum Konzept der Mentalitätsgeschichte, die versammelten Aufsätze widerspiegelten die Bandbreite der Forschung, sowohl geografisch als auch thematisch.2 Das Diktum von Peter Burke, wonach «Mentalitätengeschichte den begrifflichen Raum ausfüllt, der zwischen einer eng ausgelegten Ideengeschichte auf der einen und der Sozialgeschichte auf der anderen Seite klafft», legt das Schwergewicht auf die Biegsamkeit des Konzepts.3 Ist sie nun eher einem ideen- oder eher einem sozialgeschichtlichen Ansatz verpflichtet? Oder stellt die Mentalitätsgeschichte gar ein eigenes unverzichtbares Theorieinstrument dar?4 Johann M. Müller entwertete in einer Kritik an der Methode diese Vielfalt und Flexibilität als Beliebigkeit.5 Was nicht feststeht, ist flexibel und kann, je nach Bedürfnis, an- und eingepasst werden – für Jacques Le Goff machte gerade diese Unbestimmtheit den Reiz der Mentalitätsgeschichte aus, sie sei «précisément dans son imprécision».6
Bislang hielten sich Autoren, welche mit der Mentalitätsgeschichte arbeiteten, in der Regel nicht allzu lange mit theoretischen Fragen auf, sondern erprobten ihre ganz unterschiedlichen Konzepte gleich in der Praxis. Ausnahmen davon sind Arbeiten von Peter Dinzelbacher, Volker Sellin, Peter Schöttler und in jüngster Zeit auch jene Frank-Michael Kuhlemanns.7
Lange mangelte es an einer klaren Abgrenzung von konkurrierenden und sich überschneidenden Ansätzen wie «Intellectual History», «Ideengeschichte» oder «Psycho-Historie», und es gibt nach wie vor kein feststehendes Konzept einer Mentalitätsgeschichte. Mangels theoretischer Vorarbeiten, wurde und wird der Mentalitätsbegriff häufig in einer metaphorischen Form verwendet, zum Beispiel als «geistig-seelische Disposition», «Lebensrichtung»,8 «spezifische, umweltgebundene Ausrichtung des Denkens und Fühlens»,9 «Prägung» oder «gruppentypische Vorstellungsgeflechte».10 Inzwischen wird der Begriff und das mit ihm einhergehende Konzept einer Revision unterzogen, die vor allem eine Präzisierung ist. Es wird versucht, den diffusen Begriff zu einer systematisierten Form zu führen und ihm ein tragfähiges theoretisches Fundament zu verleihen. Insbesondere Frank-Michael Kuhlemann fordert eine reflektiertere Verwendung der Begriffe und fördert gleichzeitig mit einer tiefer gehenden Differenzierung die Möglichkeiten zur Nutzung des Konzepts Mentalitätsgeschichte. Er propagiert die Unterscheidung zwischen einem funktionalen und einem substanziellen Mentalitätsbegriff einerseits und zwischen Makro- und Mikromentalität andererseits.11 Die Mentalität im formalen oder funktionellen Sinn stelle eine Art «Transmissionsriemen» dar, zwischen einer gegebenen Lebenswelt und einer sich daraus ergebenden spezifischen Lebenshaltung, die etwa durch Erziehung oder Sozialisation bestimmt wird. Dagegen bedeutet der substanzielle Begriff (der «materiale Inhalt») nach Kuhlemann «Deutungen und Positionsbeschreibungen, kulturelle Muster, politische und weltanschauliche Einstellungen, bei denen die Grenzziehung zur Ideologie problematisch ist».12 Dieser analytische Kunstgriff ist allerdings vor allem für sozialisationstheoretisch fundierte Untersuchungen im Bereich des Bildungs- und Erziehungswesens sowie, im Falle der religiösen Mentalitätsbildung, für die zahlreichen Sozialisationsinstanzen innerhalb der konfessionellen Milieus wie Sonntagsschulen, Kinderchöre, Jungfrauenvereine oder Jugendverbände sinnvoll. Zudem muss berücksichtigt werden, dass der Zusammenhang zwischen sozialisatorischen Bedingungen und den späteren Einstellungen von Menschen nur hypothetisch begründet werden kann. Quellen geben in der Regel nur über die Wirkung von Dispositionen, nicht aber über die Disposition selber Auskunft, letztere erhält man nur über eine Interpretationsleistung.13 Betont man hingegen schwergewichtig den substanziellen Mentalitätsbegriff, kann man, «über die begrenzte Perspektive psychologisierender Ansätze hinaus», sinnvoll über Mentalität reden.14
Makromentalität im Kuhlemannschen Sinne bezieht sich beispielsweise «auf nationale oder religiöse Unterschiede innerhalb einer Epoche», Mikromentalitäten dagegen können zum Beispiel zusätzliche Differenzierungen im Protestantismus (reformiert, «positiv» etc.) beschreiben.15
Einen etwas griffigeren Definitionsvorschlag bietet Rolf Schieder: «Mentalitäten sind Dispositionen einer Kollektivität, die dafür sorgen, dass die Wirklichkeitsdeutungen dieser Kollektivität selbstverständlich erscheinen und ihr Verhalten als sinnvoll erlebt wird.»16 Unter Dispositionen versteht Schieder im Rückgriff auf Theodor Geiger «Wahrnehmungsraster, mit deren Hilfe der Mensch seine Welt ordnet».17 Mentalitäten können deshalb nicht unmittelbar (gegenständlich) wahrgenommen, sondern nur rekonstruiert werden.