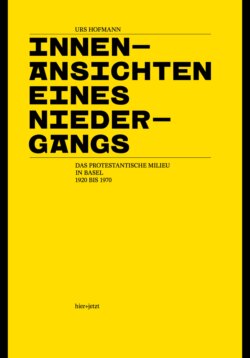Читать книгу Innenansichten eines Niedergangs - Urs Hofmann - Страница 16
1 – 5
ОглавлениеSÄKULARISIERUNG, DECHRISTIANISIERUNG, ENTKIRCHLICHUNG
Noch immer ist das Säkularisierungstheorem dasjenige, an dem sämtliche anderen Theorien über Wandlungsprozesse der Religion in der Moderne gemessen werden. So schillernd wie die Geschichte des Begriffs, so umstritten ist heute seine Gültigkeit. Die Debatte darüber vermag Bibliotheken zu füllen, weshalb im Folgenden nicht umfassend auf die Geschichte und Konjunktur dieser Theorie eingegangen wird.69
In ihrer klassischen Definition geht die Säkularisierungsthese davon aus, «dass Religion und Moderne in einem Spannungsverhältnis stehen und dass in dem Masse, wie sich die Gesellschaft modernisiert, der gesellschaftliche Stellenwert der Religion sinkt».70 Diesen Kausalzusammenhang von Religion und Moderne bestreiten unter anderem Thomas Luckmann und José Casanova. Letzterer postuliert die Vereinbarkeit von Religion und Moderne, indem er «das Begründungsverhältnis von Religion und Moderne umkehrt»,71 das heisst es geht ihm um die Umkehrung des Säkularisierungsdiskurses: Nicht Säkularität sei eine Bedingung der Modernisierung. Vielmehr habe «die Religion selbst einen [...] Beitrag zur Moderne geleistet».72 Thomas Luckmann ersetzt die Säkularisierungsthese durch das in der modernen Gesellschaft sich wandelnde Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft.73 Jedoch ist, wie Knoblauch die These von Luckmann interpretiert, die «individuelle Religion nicht als Gegenbegriff zur Kirchenreligion zu verstehen; sie bezeichnet lediglich die subjektive Ausprägung jeder Form von Weltansicht.» Kirchlichkeit meint dagegen kirchlich gebundene Religiosität, die durch «sozial vorgeformte, institutionalisierte Sprach-, Symbol-, Einstellungs- und Handlungsweisen bedingt, begrenzt und gestaltet sind».74 Individualisierungsprozesse wirken sich in unterschiedlicher Weise auf die Entwicklung von Religiosität und Kirchlichkeit aus: durch Auflösung des Zusammenhangs zwischen religiösen Einstellungen und Praktiken einerseits und Sozialstrukturen andererseits, durch Deinstitutionalisierung des religiösen Lebensverlaufs oder gar durch den Zusammenbruch konfessioneller Milieus.75 Eine grundlegende Spannung zwischen Religion und Moderne verneint auch die französische Religionssoziologin Danièle Hervieu-Léger; ihrer Ansicht nach kann die Moderne sogar religionsproduktiv wirken.76 Auch die Autoren und Promotoren des ökonomischen Marktmodells der Religionen, Rodney Stark, William S. Bainbridge, Roger Finke und Laurence R. Iannaccone gehen davon aus, dass Moderne, genauer das moderne Prinzip der Konkurrenz, die religiöse Produktivität stimuliert.77
Dass der Begriff «Säkularisierung» inzwischen mit Vorsicht gebraucht werden muss, darüber ist sich die Forschung einig,78 ebenso darüber, dass das Verständnis von Säkularisierung als eine unaufhaltsame und unumkehrbare Progression in Richtung Relevanzverlust der Religion und Verweltlichung nicht mehr gehalten werden kann, sondern dass damit Prozesse beschrieben werden können, die sich als Verschiebungen, Umschichtungen und Brüche im tradierten Bild von Kirchlichkeit und Religion charakterisieren lassen.79 Der Begriff «Säkularisierung» suggeriert eine «Eindeutigkeit, die faktisch nicht besteht», formuliert Martin Greschat treffend.80
Autorinnen und Autoren, welche den Gehalt der Säkularisierungsthese bestreiten und statt von Relevanzverlust der Religion in der Gesellschaft von einem Formenwandel sprechen, bringen für diesen Prozess andere Begriffe ins Spiel. Peter L. Berger spricht von der «Desecularization of the World»,81 José Casanova von «Deprivatisierung»,82 Grace Davie von «Believing without belonging».83 Hartmut Lehmann hat vorgeschlagen, den Begriff «Säkularisierung» durch den aus dem Französischen stammenden Begriff der Dechristianisierung («décristianisation») zu ersetzen, der das Nachlassen eines spezifisch christlichen Einflusses fasst, aber Raum offen lässt für parallel verlaufende positive Entwicklungen von nichtchristlichen Religionsphänomenen.84
Im deutschen Sprachraum ist es vor allem Friedrich Wilhelm Graf, der sich dezidiert gegen die klassische Säkularisierungsthese stellt: Die Annahme, dass in «der Moderne» «die Religion» abnehme, spiegle bestenfalls einen «modernisierungstheoretischen Dogmatismus mit hoher Empirieresistenz.»85 Stattdessen propagiert Graf den Begriff des «religiösen Feldes», entwickelt von Pierre Bourdieu. Das Konzept des «religiösen Feldes» überzeugt Graf, weil es möglich mache, statt «modernitätstypischen Religionsverfall» die «widersprüchliche Komplexität moderner Religionsgeschichten» zu erfassen.86 Damit ähnelt die Vorstellung eines «religiösen Feldes» etwas dem, was Pollack als «ein System kommunizierender Röhren» bezeichnet, um die theoretischen Modelle von Grace Davie und Stark/Bainbridge zu beschreiben.87 Pollack meint dazu, dass die Zugewinne neuer religiöser Bewegungen, Esoterikgruppen und ostasiatischer Spiritualität nicht im Entferntesten in der Lage seien, die beträchtlichen Verluste der christlichen Kirchen auszugleichen. Und mit seinem Festhalten an der Säkularisierungsthese ist Pollack immer noch in guter Gesellschaft, allen voran von Steve Bruce und Bryan Wilson.88
Möglicherweise bedarf die bislang vornehmlich dogmatische Interpretation von «Säkularisierung» einer gewissen Offenheit, so wie auch die Definition von «Religion» von Autor zu Autor variiert. In diesem Sinne ist Lucian Hölschers Verständnis von religiösem Wandel das ehrlichste: Da alle Konzepte religiösen Wandels zeitgebunden und damit bald überholt seien, versteht er den religiösen Wandel als religiös «immanent» und lässt damit Raum für zeitliche und konjunkturelle Entwicklungen.89
Trotz der Ambivalenz des Säkularisierungskonzepts wird dieses in der vorliegenden Untersuchung nicht von vornherein verworfen. Die These lautet, dass sich die Bedeutung der Religion in der Basler Gesellschaft derart verändert hat, dass man diesen Vorgang nur mit dem Terminus der Säkularisierung adäquat beschreiben kann. Anders formuliert, wird die These verneint, dass das Niveau an Religion in den 1970er-Jahren noch dieselbe Höhe aufwies wie zu Beginn des Jahrhunderts. Dabei soll nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass die Religionskonjunktur in Wellenbewegung verlaufen kann oder sich im Lauf des 20. Jahrhunderts in Basel andere, ausserkirchliche Formen der Religion im Aufschwung befinden. Unter Säkularisierung wird dabei mit Jonathan Sperber der Verfall religiöser Werte und Praktiken verstanden, nicht etwa ihre Transformation in der Gesellschaft.90 Damit verbunden ist die Frage, wie sich Phänomene der Abnahme von Religion begrifflich fassen lassen, ohne mit dem Terminus «Säkularisierung» gleich zu behaupten, die Entwicklung verlaufe kontinuierlich in Richtung eines totalen Verschwindens der Religion, sozusagen zum negativen «Eschaton» der biblischen Prophetie.
Während der empirische Teil der folgenden Analysen sich zur Hauptsache auf das Phänomen der Entkirchlichung konzentriert, das heisst auf den Bedeutungsverlust der evangelisch-reformierten Religion in ihrer institutionalisierten Form, darf gleichzeitig vom qualitativen Teil dieser Studie erwartet werden, dass er auch über mögliche Vorgänge des Bedeutungsverlustes von Religion innerhalb und ausserhalb der kirchlichen Institutionen Auskunft gibt, indem nach dem möglichen Einfluss von Industrialisierung und Rationalisierung auf die religiöse Entwicklung gefragt wird.