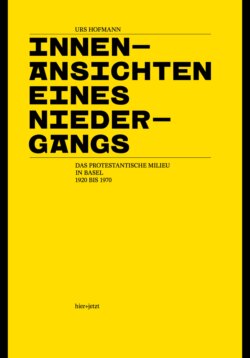Читать книгу Innenansichten eines Niedergangs - Urs Hofmann - Страница 12
1 – 2
ОглавлениеIDEOLOGIE, LEBENSWELT, MILIEU
Zur Bestimmung eines sinnvollen und vor allem nutzbaren Mentalitätsbegriffs gehört die Frage nach der geeigneten Methode. Begriffliche Unbestimmtheiten und Theoriedefizite sind der historischen Analyse nicht förderlich. Insofern ist der Ansatz der französischen Geschichtsschreibung zu kritisieren, die unter dem Mantel einer «athmosphère mentale» als einer Art «gesellschaftlichem Klebstoff» vieles miteinander verknüpfte und voneinander abhängig machte, das eigentlich zu differenzieren wäre und so dem Vorwurf der konzeptuellen Vagheit der Mentalitätsgeschichte Vorschub leistete.18 Gleichzeitig ist die heutige Form der Mentalitätsgeschichte im deutschen Sprachraum wissenschaftsgeschichtlich stark mit den Vorarbeiten der französischen Geschichtsforschung seit der Annales-Schule verbunden.19 Inzwischen hat sich die französische Mentalitätsgeschichte stark differenziert: Seit den 1960er-Jahren sind unter ihrem Vorzeichen etwa Arbeiten zur Geschichte der Kindheit, zur Französischen Revolution oder zur Kulturgeschichte des Geruchs entstanden.20
Während nun nach der französischen Auffassung von Mentalitätsgeschichte auch tiefer greifende politische Ereignisse keine direkten, auf jeden Fall keine schnellen Auswirkungen auf die Wahrnehmung, Deutung und Bewertung der erlebten Wirklichkeit haben, stellt sich zum Beispiel Detlef Pollack gegen dieses Verständnis. Mentalitäten seien keine «sozialen Letztgrössen»,21 die jede gesellschaftliche Veränderung überdauern – sie müssten in Beziehung gesetzt werden zu den sozialen und politischen Bedingungen, und das Wechselspiel zwischen Mentalitätsund Ereignisgeschichte müsse berücksichtigt werden. Dennoch: Die politische Geschichtsschreibung pflegt ihren Nachdruck auf epochale Zeiten zu legen, eine stärker an mentalen Prägungen orientierte Geschichtswissenschaft fragt nach den Gründen, warum sich Menschen, Nationen oder gesellschaftliche Gruppen so und nicht anders verhielten.22 Diese historische Betrachtungsweise wehrt sich gegen die problematische Zerlegung der Zeitgeschichte in kleine und kleinste Abschnitte und kann dadurch Kontinuitäten religiös-konfessioneller Grundüberzeugungen deutlich machen, was insbesondere in der kirchlichen Zeitgeschichte seine Bedeutung hat.
Besonders mit Blick auf die «religiöse Prägung» finde man die sogenannten «Gefängnisse der langen Dauer».23 Insofern ist die Konzentration auf die Mentalitätsgeschichte für die kirchliche Zeitgeschichte von erheblicher Bedeutung. An diesem Punkt setzten die kritischen Einwände und das Unbehagen am Konzept der «Mentalitätsgeschichte» an, wie sie unter anderem Peter Burke und Volker Sellin diskutiert haben.24 Es bestehe die Gefahr, so ein Vorwurf, die Mentalitäten zu vergegenständlichen und sie als «Gefängnisse» zu betrachten, aus denen die Individuen nicht auszubrechen vermögen. Weiter besteht der Hang zu einer Homogenisierung der Meinungen durch die Mentalitätshistoriker; eine solche Homogenisierung ist aber nicht Bestandteil des mentalitätshistorischen Ansatzes. Mentalitätsthemen sind keinesfalls die gemeinsame Übereinstimmung beteiligter Diskutanten in allen möglichen Fragen, sondern bedeuten gemeinsame «points of reference».25
Die manifesten Schwierigkeiten in der Abgrenzung von Lebenswelt, Ideologie und Mentalität, die bereits Theodor Geiger, Volker Sellin oder Michel Vovelle beschäftigt haben, lassen sich überwinden, indem man den Begriff der Ideologie, also das «bewusste Denken», in das Begriffskonzept Mentalität integriert. Sofern Ideen, Ideologien und Theorien zur «Lebenswelt» der zu untersuchenden Gruppe gehören, können sie «als handlungsleitende Maximen die Mentalität durchaus beeinflussen, ohne selber Mentalität zu sein.»26 Kuhlemann befürwortet die Aufhebung der künstlichen Barriere zwischen einer weit verstandenen Sozialgeschichte der Ideen und einer ebenso offenen Mentalitätsgeschichte, sofern das entscheidende Kriterium der Mentalität, der «lebensweltliche Bezug», berücksichtigt wird. Sozialgeschichte der Ideen bedeutet folglich in dieser Definition die Verbindung der Ideenwelt mit dem sozialen Handeln.27 Sellin schliesslich bezeichnet die Lebenswelt als eine «vortheoretische Sphäre, in die Phänomene nach ihrer Lebensbedeutung erfahren und unmittelbar beurteilt werden [...]».28
Die Religions- und Kirchengeschichte mit den Mitteln der Mentalitätsgeschichte zu analysieren, bietet sich an: Ihre Bezüge zur Mentalität scheinen sehr eng zu sein. Ebenso wie die Religiosität widerspiegelt auch die Mentalität fest verankerte Glaubensüberzeugungen und selbstverständliche Handlungsanleitungen zur Lebensführung, zu Positionsbeschreibungen oder kulturellen Mustern. Der Zusammenhang zwischen einer Idee und ihrer Trägergruppe, «die ihr Verhalten danach ausrichtet», muss nach Lepsius hinreichend stark sein, um durchreflektierte Ideen zu einem Mentalitätsthema werden zu lassen.29 Im Falle der Religion ergibt sich «die existenzielle Verankerung der Idee durch ihre Internalisierung und ihre Sanktionierung durch die Gläubigen von selbst».30 «Vielleicht», so vermutet Ulrich Raulff folgerichtig, «ist das ‹Mentale› selbst nur eine moderne Metapher für jene primäre Stellung zur Welt, die im christlichen Vokabular ‹Glauben› heisst.»31
Die Religionsforschung hat sich allerdings lange Zeit vor allem auf die grossen Theologen und ihre Theologien konzentriert und weniger auf die breite Bevölkerung und kollektive religiöse Einstellungen. Mit Ausnahme von Karl-Wilhelm Dahms Studie zur sozialen Position und politischen Mentalität evangelischer Pfarrer in der Zwischenkriegszeit aus dem Jahr 196532 sind im deutschen Sprachraum erst seit Mitte der 1980er-Jahre mentalitätsgeschichtliche Studien zu religiösen Gesellschaften entstanden.33 Das von Frank-Michael Kuhlemann zusammen mit Olaf Blaschke erarbeitete Konzept eines konzentrischen Modells von Mentalitäten und Milieus, mit den Pfarrern als Meinungsmacher in der Mitte, den sie umgebenden Kirchenparteien, den lokalen Vereinen und dem übergreifenden Verbandsprotestantismus, kann für die vorliegende Forschungsarbeit sehr hilfreich sein.34 Mentalitätsgeschichte wird hier in Anlehnung an Peter Burke und Frank-Michael Kuhlemann durch vier charakteristische Merkmale definiert: Erstens durch ihre Betonung der kollektiven anstelle der individuellen Einstellungen, zweitens durch den Nachdruck auf unausgesprochene und unbewusste Annahmen, drittens durch ihr Interesse nicht nur für den Inhalt von Meinungen, sondern auch für deren Struktur, für Kategorien, Metaphern und Symbole, das heisst dafür, wie die Leute denken, und nicht nur dafür, was sie denken.35 Viertens können schliesslich auch Ideen, Ideologien und Theorien eine Mentalität beeinflussen, sofern sie zur Lebenswelt der zu untersuchenden Gruppe gehören; sie müssen Teil der «Logik der Handlungsstruktur» und der «Sinnkonstruktion» sein, um auf die Mentalität Einfluss zu nehmen.36 Die Verknüpfung von Mentalität und Lebenswelt kann in der sozial- und mentalitätsgeschichtlich orientierten Religionsforschung durch Einbezug der konfessionellen Milieus hergestellt werden, insbesondere durch die Kirche und die kirchlichen Vereine.37
Einige analytische Stolpersteine stellen sich dennoch. Bei der Untersuchung mentaler Kommunikationsräume, wie es die konfessionellen Zeitungen und Zeitschriften, die Jahresberichte und Vereinsakten sind, muss beachtet werden, dass sich die Mentalität der sich äussernden Gruppe nur rhetorisch verfremdet zeigt. Das für die Mentalität postulierte, geäusserte Unbewusste wird mit rhetorischen Sprachmitteln und persönlichen Stilisierungen gebrochen, insbesondere auch in den Auseinandersetzungen des kirchenpolitischen Tagesgeschehens. Unter anderem im Bewusstsein dieser rhetorischen Besonderheiten und mit dem Willen, die Sprache ins Zentrum der Untersuchung zu rücken und diese gewinnbringend zu analysieren, ist die historische Diskursanalyse entwickelt worden. Sie findet konsequenterweise auch in der vorliegenden Untersuchung ihre Verwendung.
Weiter gilt es zu beachten, dass die Mentalität, nach der in den Zeitschriftenartikeln gesucht wird, diejenige einer ganz bestimmten Gesellschaftsschicht ist: die Mentalität der Pfarrer, der Kirchenvorstände und der Theologen. Insofern handelt es sich um eine Elite, deren Verhalten nicht automatisch repräsentativ ist für eine umfassende evangelisch-protestantische Mentalität. Damit am Ende von der möglicherweise vorhandenen protestantischen Mentalität gesprochen werden kann, ist es notwendig, auch die andere protestantische Gesellschaftsschicht in die Untersuchung miteinzubeziehen – die Gruppe der Kirchgänger, Zeitschriftenleser und Vereinsmitglieder. Diese Voraussetzung wird in der vorliegenden Arbeit soweit erfüllt, wie die Analyse der protestantischen Vereinsakten Aussagen zu den Laienmitgliedern möglich machen.