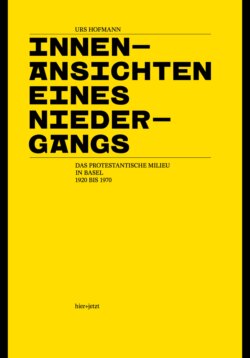Читать книгу Innenansichten eines Niedergangs - Urs Hofmann - Страница 6
EINLEITUNG « DIE REFORMIERTE KIRCHE DER SCHWEIZ WERDE KLEINER UND ARMER, SAGEN SOZIOLOGEN VORAUS. SOLCHE AUSSAGEN STIMMEN, VOR ALLEM WENN SIE NACH DEM EREIGNIS GEMACHT WERDEN. – UND ANSONSTEN? FESTSTEHT: DIE REFORMIERTE KIRCHE IST ÜBERALTERT. ES FEHLT DER NACHWUCHS, AUS BIOLOGISCHEN GRÜNDEN. REFORMIERTE BEKOMMEN WENIGER KINDER. ALLES ANDERE BLEIBT KAFFEESATZLESEN, GERADE IM BEZUG AUF DAS RELIGIÖSE: KEINER HÄTTE DARAUF GEWETTET, DASS NACH DEM TOD DES NAZARENERS AUS EINEM HÄUFCHEN JERUSALEMER DIE CHRISTENHEIT ENTSTEHT. KAUM JEMAND HÄTTE GEDACHT, DASS DER AUFMÜPFIGE MÖNCH LUTHER NICHT AUF DEM SCHEITERHAUFEN LANDEN, SONDERN EINE WELTWEITE KIRCHE INITIIEREN WÜRDE. 2 »
ОглавлениеUm Aussagen zur Zukunft der Kirchen zu treffen, kann es durchaus von Nutzen sein, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, es müssen ja nicht gleich 2000 Jahre sein. Man kann, nach dem Prinzip Hoffnung oder im Gottvertrauen, darauf zählen, dass die Schwäche der etablierten Kirchen im 20. Jahrhundert nur eine vorübergehende ist. Die Entwicklungen seit den 1960er-Jahren und das Wissen um die beschränkte Reformfähigkeit der Landeskirchen sprechen hingegen auch unter einem langen Zeithorizont gesehen eher für ihre fortdauernde Marginalisierung.
Um diesen Blick zurück geht es in der vorliegenden Forschungsarbeit. Woher kommt der Bedeutungsverlust der Kirchen? Und ist heute wirklich bereits «nach dem Ereignis»? Dass der Schweizerische Evangelische Kirchenbund (SEK) vor Kurzem eine Studie in Auftrag gegeben hat, um «die Zukunft der Reformierten»3 einzuschätzen, deutet auf ein auch in der Gegenwart anhaltendes Krisenbewusstsein der reformierten Kirchen in der Schweiz hin. Damit ist gleichzeitig gesagt, dass mit der auch in den Medien populären Rede von der «Wiederkehr der Religionen»4 oder der «Wiederkehr der Götter»5 nicht die Mitgliedskirchen des SEK gemeint sein können. Die vorliegende Untersuchung bezieht gegenüber dieser weit verbreiteten Diagnose, die Gegenwart erlebe eine «Renaissance des Religiösen»6 einen kritischen Standpunkt – die im Folgenden auf empirischer Basis vorgenommene Historisierung dieses Phänomens wird zeigen, ob man über lange Sicht von einer «Renaissance» sprechen kann. Indessen hat es seine Gründe, dass die Themen Kirche und Religion wieder ihren Platz auf den Titelseiten der medialen Öffentlichkeit gefunden haben7 oder dass Hundertausende Jugendliche zum Weltjugendtag nach Köln reisen, um den Papst zu sehen. Sicher haben der «islamistische Schock»8 und die mit der Migration von Menschen aus islamischen Staaten verbundenen Ängste einen Teil zum Interesse am Religiösen beigetragen. Allein, diese Erklärung griffe zu kurz, denn hier geht es in erster Linie um eine Renaissance des Interesses an Religion. Was die Wochenzeitschrift Spiegel mit «Das Gefühl des Glaubens»9 betitelt, trifft den Nagel wohl auf den Kopf – dieses «Gefühl» umschreibt die Sehnsucht nach dem Sinn im eigenen Leben, nach Transzendenz und verbindlichen Werten. Ereignisse wie die millionenfach besuchte Beisetzung Johannes Paul II. zeigen, über den erfolgreichen Event-Charakter der Veranstaltung hinaus, dass bereits die Inszenierung von Religion in den Menschen etwas anrührt, eine Verbindung zum Übersinnlichen, die weiterhin besteht. Menschen erinnern sich wieder ihrer religiösen Residuen und suchen im Gefühl des Glaubens den Glauben an sich. Die Kirche übt weiterhin ihren Einfluss aus, ob er nun bewusst oder unbewusst wahrgenommen wird, und das Phänomen Religion in der Gegenwart sollte nicht vorzeitig abgeschrieben werden.
Vor diesem Hintergrund unternimmt dieses Buch den Versuch, die Verankerung der reformierten Kirche in der Gesellschaft und ihren Einfluss auf diese Gesellschaft, mit anderen Worten: die Mächtigkeit der Kirche in Bezug auf die soziale Wirklichkeit und den Wandel dieses Verhältnisses im Laufe der Zeit zu untersuchen. Im Mittelpunkt stehen die Schnittpunkte zwischen der Kirche und der ausserkirchlichen Gesellschaft. Dort manifestiert sich das Verhältnis der Kirche zur realen Lebenswelt, die Bedeutung der Kirche für die Menschen. Es besteht kein Zweifel daran, dass sich Stellenwert und Einfluss der protestantischen Religion und der Kirche in der Gesellschaft im vergangenen Jahrhundert stark verändert haben. Neben der Abkehr von der Kirche ist es im Verlauf der Moderne in verschiedenen Ländern auf unterschiedliche Weise zu einer Abkehr von christlicher Lehre und von christlich geprägten Lebensformen gekommen.
Diese Prozesse des Sich-Distanzierens vom Christentum sind aber nicht gleichzusetzen mit jeglicher Abkehr von Religion oder religiös inspirierter Wertorientierung. Im Gegenteil gibt es vielerlei Verbindungen zwischen einer Hinwendung zu nichtchristlichen Glaubensformen und der Persistenz christlichen Einflusses. Diese Mischformen von christlichen und nichtchristlichen Elementen bestehen weiterhin und wirken auf die Wahrnehmung von politischen, gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen ein. Religion und die Kirchen als ihre Vertreter sind Faktoren der menschlichen Daseinsorientierung. Auch die modernen, «säkularisierten» Gesellschaften im 20. Jahrhundert sind nicht religionslos; die Religion und die Kirche haben aber einen anderen Stellenwert und andere Erscheinungsformen als in früheren Zeiten; man kann hier nach der Transformation von Kirche und protestantischer Lebenswelt fragen. Religionsgemeinschaften mussten auf «modernitätsspezifische Transformationen und Brüche»10 reagieren und sich mit den zunehmend von der Kirche emanzipierenden Bürgern auseinandersetzen.
In Bezug auf die reformierte Kirche in Basel stellt sich diese Problematik insofern, als die grosse Mehrheit der städtischen Bevölkerung protestantischen Glaubens war und dies heute auf tieferem Niveau noch immer ist. Der tragende gesellschaftliche Kreis des 19. und frühen 20. Jahrhunderts der Stadt, das konservative Bürgertum, war Mitglied der protestantischen Kirche. Die Entwicklung der evangelisch-reformierten Kirche in Basel kann demnach nicht losgelöst vom Denken und Handeln dieser Gesellschaftsschicht analysiert werden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach potenziellen Milieustrukturen dieser evangelischreformierten Gemeinde, nach der Charakterisierung eines allfälligen Milieus und dessen Veränderungen. Welches sind die Gründe, die, zumindest auf den ersten Blick, von Säkularisierung oder Entkirchlichung sprechen lassen?
Dagegen soll eine Herangehensweise, die das Banner der Säkularisierungsthese und der Theorien der steten Entchristlichung der Gesellschaft bis hin zur völligen Vernachlässigbarkeit von Kirche und Religion in der Gesellschaft vor sich hinträgt, vermieden werden. Es wirkt der Erfassung weitreichender Veränderungen in der Moderne entgegen und kann deshalb zur Erkenntnisfalle werden. Die Resultate der Untersuchung sollen hier für sich sprechen. Auch eine einseitige Fokussierung auf die Probleme der Kirche ist dem Stellenwert des Religiösen in der Gesellschaft nicht angemessen und reicht nicht aus, um die ganze historische Dimension zu erfassen. Stattdessen stehen die verschiedenen Formen der Veränderung im Zentrum der Fragestellung.
Das in den Kirchenstatistiken dargebotene Material erlaubt dazu nur bedingt aufschlussreiche Aussagen. Über subjektive Motive, religiöse Gefühlslagen und Selbstrepräsentationen von Frömmigkeit kann daraus ebenso wenig erfahren werden wie über moralische Wertorientierungen, politische Einstellungen oder Herkunftsmilieus der Gottesdienstbesucher. Der erste Teil des Buches untersucht deshalb charakteristische Problemkonstellationen, die über das Verhältnis von Kirche und Gesellschaft und Veränderungen in diesem Verhältnis Auskunft geben. In einer Art Tiefenbohrung liegt die Konzentration hier auf zentralen Debatten und Entwicklungen in kirchlichen und kirchennahen Zeitschriften, welche als Einbrüche der Modernisierung in die Kirche wahrgenommen werden können. Die innerkirchlichen Diskurse entzündeten sich an den Modernisierungsprozessen der Industrie, an der Ausbreitung neuer Kommunikationstechnologien oder am sich wandelnden Rollenverständnis der Frau. Wie wurden diese Themen diskutiert, welche theoretischen und praktischen Antworten gab die Kirche? Die Analyse dieser als Krisenzeiten definierten Zeitabschnitte soll es möglich machen, über die spezifische Mentalität der Basler Protestanten Auskunft zu geben und sie zu umreissen. Persistenz und Wandel von Einstellungen und Praktiken im protestantischen Milieu sollen aufgezeigt und festgehalten werden. Es sollen Erkenntnisse gewonnen werden über Veränderungen im protestantischen Wirklichkeitsbild und über die diskursive Vergewisserung des protestantischen Selbstverständnisses. Zentrale Fragen sind jene nach der Vitalität von Religion, nach dem Rückgang der Bindekraft der traditionellen religiösen Institutionen und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Kirche. Kirchliche Organisationen und Medien stellen den Mitgliederschwund der Landeskirchen ins Zentrum ihres Interesses, Theologen und Kirchenhistoriker haben sich in ihren Beiträgen bisher hauptsächlich auf theologische Probleme und auf die Strukturen der Kirchen beschränkt. Das Buch hat zum Ziel, den ab Mitte der 1960er-Jahre sichtbar erfolgten dramatischen Bruch der protestantischen Gesellschaft mit ihrer Kirche, der sich vorab in einer massiven Kirchenaustrittswelle zeigte, mit einer Untersuchung über dessen Vorgeschichte zu erhellen. Hintergrund bildet die Annahme, dass «Kirche und Gesellschaft in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis»11 stehen. Im Zentrum der Analyse stehen dabei Fragen nach der Struktur, den Akteuren und der Mentalität des Protestantismus in Basel-Stadt.12 Zur Beschreibung der Vergesellschaftungsmuster nach dem Niedergang des protestantischen Milieus – so es denn eines gegeben hat – schlägt Benjamin Ziemann vor, mit den Begriffen «Transzendenz» und «Immanenz» zu arbeiten.13 Basierend auf der soziologischen Systemtheorie von Niklas Luhmann, finde man Religion «nur dort vor, [...] wo die Differenz immanent/transzendent kommunikativ verwendet wird».14 Mit anderen Worten geht es darum zu prüfen, wo Immanentes unter dem Gesichtspunkt der Transzendenz betrachtet wird. Im Konkreten bedeutet dies, protestantische Texte verschiedener Provenienz nach dem «Wandel der Semantiken» zu untersuchen, das heisst nach Neuformulierungen religiöser Codes. Die Texte reformierter Provenienz sind deshalb nicht primär mit der herkömmlichen Hermeneutik zu analysieren, die nach der Intention des Autors und den Erwartungen der Adressaten fragt. Stattdessen kann nach Variationen und Neuformulierungen religiöser Prägungen gesucht werden. Beispiele dafür sind das Umschwenken von der klassischen hierarchischen Glaubensordnung zur Betonung des Partnerschaftlichen im Glauben; die Suche nach neuen Schwerpunkten der Glaubensvermittlung – nicht mehr nur in der anonymen Grossgemeinde, sondern in lockeren Kleingruppen; die Betonung des Reflexiven und Dialogischen anstelle des Dogmatischen.
Die vorliegende Forschungsarbeit praktiziert bewusst ein methodisches Sowohl-als-auch. Da zumindest die erste Hälfte des Untersuchungszeitraums unbestritten in die Milieuphase reicht beziehungsweise noch vom «Vereinsprinzip als Strukturprinzip der bürgerlichen Gesellschaft»15 im 19. Jahrhundert geprägt ist, kann eine Analyse mit dem Milieuansatz und die Beobachtung der Konjunkturen von Kirchen- und Vereinsmitgliedschaften und Kirchenbesuchen neue Erkenntnisse zu Tage fördern. Gleichzeitig reicht die Untersuchung zeitlich über den sogenannten Niedergang des Milieus hinaus, womit für diesen Zeitraum ein ergänzendes Analyseinstrument notwendig ist. Mit der Diskursanalyse, die sich auf die Sprache konzentriert und den Wandel von Sprach- und Zeichensystemen untersucht, steht hier ein Mittel zur Verfügung.
Die Bedeutung des schweizerischen Protestantismus im 20. Jahrhundert, seine soziale und politische Gestaltungskraft und die Veränderungen in der protestantischen Kirchlichkeit blieben bislang nahezu unerforscht.16 In der Schweiz hat sich vor allem die Religionssoziologie mit der Religionsgeschichte befasst. Beispiele hierfür sind die Arbeiten von Roland J. Campiche und in jüngster Zeit von Jörg Stolz oder auch von Peter Voll.17 Die Religionssoziologie, welche seit Émile Durkheim und Max Weber zum Kernbereich der Soziologie gehörte, verlor indes «zunehmend ihre historische Dimension»,18 das heisst sie konzentriert sich hauptsächlich auf Gegenwartsanalysen. Die Kirchengeschichte dagegen ist uneingeschränkt historisch orientiert, die neuzeitliche Protestantismusforschung unter gesamtgesellschaftlichen Vorzeichen ist allerdings bislang nur ausnahmsweise in ihren Blickwinkel geraten.19 Diese Lücke kann die Erforschung der Kirchen- und Religionsgeschichte unter einem sozialgeschichtlichen Blickwinkel füllen. Mit Martin Greschat geht es ihr darum, «die Einbindung des individuellen Glaubens und seiner sozialen Wirklichkeit sowie die Einordnung der Kirchen samt ihren Organisationen und Gliederungen in die sie umgebende gesellschaftliche Realität offenzulegen. Es geht um die Frage nach der Mächtigkeit oder der Schwäche religiöser Kräfte und Kreise innerhalb des genannten Kontextes.»20 Zweitens untersucht Sozialgeschichte die Religion nicht in ihrem Verhältnis zum Staat, sondern im Verhältnis zur Gesellschaft, das heisst, dass in ihrem Mittelpunkt Veränderungen im Verhalten von Individuen und Gruppen stehen.
Wissenschaftliche Forschung im Bereich der kirchlichen Zeitgeschichte, insbesondere zum Protestantismus im 20. Jahrhundert, gewann unter den Sozialhistorikern im deutschen Sprachraum erst seit den 1980er-Jahren zunehmend an Bedeutung. Vertreten sind bis heute vor allem regionalgeschichtliche Studien, die versuchen, für ein konkretes Gebiet oder eine bestimmte Bevölkerungsgruppe eine charakteristische Mentalität nachzuweisen. Die bislang vorliegenden Resultate sind aber wegen ihrer teilweisen Disparität und ihrer regionalen Beschränkung nicht automatisch auf andere Länder übertragbar. Wünschbar sind deshalb zuerst weitere Mikrostudien, das heisst regionale konfessionelle Studien über einzelne Milieus und die jeweils prägenden Formen kirchlicher Vergesellschaftung, bevor dann begonnen werden kann, die Untersuchungsgebiete auf grössere geografische und religiöskirchliche Räume auszudehnen.21
1 Horst Bannach, zit. nach Tschudi, Felix: «Gesamtkirchliche Aufgaben und Dienste», Kirchenblatt 1, 7. 1. 1965, S. 2.
2 Tilmann Zuber, Chefredaktor des Kirchenboten, in einem Kommentar zur Zukunft der Reformierten, in: Kirchenbote Kanton Basel-Stadt, Nr. 1, Januar 2011, S. 5.
3 So der Titel dieser vom Observatoire des religions en Suisse in Lausanne verfassten Umfeldanalyse. Stolz, Jörg, Edmé Ballif (Hg.): Die Zukunft der Reformierten. Gesellschaftliche Megatrends – kirchliche Reaktionen, Zürich 2010.
4 Ein Beispiel unter vielen: Die Zeit 33, 11. 8. 2005.
5 Graf, Friedrich Wilhelm: Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen Kultur, München 2007.
6 Pollack, Detlef: Säkularisierung – ein moderner Mythos? Studien zum religiösen Wandel in Deutschland, Tübingen 2003, S. 12.
7 Zuletzt: Die Zeit 49, 29. 11. 2012, S. 1: «Wo Gott nichts zu suchen hat»; Die Zeit 22, 26. 5. 2011, S. 1: «Ist die Kirche noch zu retten?»; Tageswoche 48, 30. 11. 2012, S. 1: «Kranke Kirche».
8 Herbert Schnädelbach in «Wiederkehr der Religion», Zeit Online vom 11. 8. 2005.
9 Der Spiegel 15, 11. 4. 2005, S. 1.
10 Graf, Friedrich Wilhelm, Klaus Grosse Kracht: Einleitung: Religion und Gesellschaft im Europa des 20. Jahrhunderts, in: Dies. (Hg.), Religion und Gesellschaft. Europa im 20. Jahrhundert, Köln 2007, S. 26.
11 Altermatt, Urs: Katholizismus und Moderne, Zürich 1989, S. 27.
12 Herbert Kühr drückt dies so aus: «Die Frage nach der Stabilität und dem Wandel der normativen Steuerungskraft des milieuspezifischen Wertsystems bedarf zu ihrer Beantwortung eines erweiterten methodischen Instrumentariums. Der empirisch-analytische Ansatz allein genügt nicht; erforderlich sind komplementäre unterschiedliche quantitative und qualitative Verfahren.» Kühr, Herbert: Katholische und evangelische Milieus: Vermittlungsinstanzen und Wirkungsmuster, in: Oberndörfer, Dieter, Hans Rattinger, Karl Schmitt (Hg.), Wirtschaftlicher Wandel, religiöser Wandel und Wertewandel. Folgen für das politische Verhalten in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1985, S. 245–261, hier S. 260.
13 Ziemann, Benjamin: Codierung von Transzendenz im Zeitalter der Privatisierung. Die Suche nach Vergemeinschaftung in der katholischen Kirche, 1945–1980, in: Geyer, Michael, Lucian Hölscher (Hg.): Die Gegenwart Gottes in der modernen Gesellschaft. Transzendenz und religiöse Vergemeinschaftung in Deutschland, Göttingen 2006, S. 380–403.
14 Ziemann, Transzendenz, S. 381. Vgl. Luhmann, Niklas: Die Religion der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 2000, S. 53–114, insbes. S. 77.
15 Tenfelde, Klaus: Die Entfaltung des Vereinswesens während der Industriellen Revolution in Deutschland (1850–1873), in: Dann, Otto (Hg.), Vereinswesen und bürgerliche Gesellschaft in Deutschland, München 1984, S. 55–114, S. 58.
16 So auch Lindt, Andreas: Der schweizerische Protestantismus. Entwicklungslinien nach 1945, in: Conzemius, Victor, Martin Greschat, Hermann Kocher (Hg.), Die Zeit nach 1945 als Thema kirchlicher Zeitgeschichte, Göttingen 1988, S. 61–71, hier S. 71.
17 Dubach, Alfred, Roland J. Campiche (Hg.), Jede(r) ein Sonderfall? Religion in der Schweiz. Ergebnisse einer Repräsentativbefragung, Zürich und Basel 1993; Campiche, Roland J.: Die zwei Gesichter der Religion. Faszination und Entzauberung, Zürich 2004; Stolz, Zukunft; Voll, Peter: Religion, Integration und Individualität. Studien zur Religion in der Schweiz, Würzburg 2006.
18 Schieder, Wolfgang: Religion in der Sozialgeschichte, in: Ders., Volker Sellin (Hg.), Sozialgeschichte in Deutschland. Entwicklungen und Perspektiven im internationalen Zusammenhang, Göttingen 1987, S. 9–31, S. 14.
19 Eine Ausnahme bilden die Arbeiten von Thomas K. Kuhn, der sich unter anderem mit der geistigen Landesverteidigung oder der Haltung zum Kommunismus aus kirchengeschichtlicher Sicht befasst hat. Kuhn, Thomas K.: Emil Brunner und die «geistige Landesverteidigung» in der Schweiz 1933–1945, in: Lekebusch, Sigrid, Hans Georg Ulrichs (Hg.): Historische Horizonte. Vorträge der dritten Emder Tagung zur Geschichte des reformierten Protestantismus, Wuppertal 2002, S. 297–310; Ders.: «Geistige Landesverteidigung» und reformierte Theologie in den 1930er-Jahren, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 114 (2003), S. 21–44; Ders.: «McCarthy-Schwierigkeiten» – Der Streit um Helmut Gollwitzer als Nachfolger Karl Barths 1961/62, in: BZGA 109 (2009), S. 53–102.
20 Greschat, Martin: Die Bedeutung der Sozialgeschichte für die Kirchengeschichte. Theoretische und praktische Erwägungen, in: Doering-Manteuffel, Anselm, Kurt Nowak (Hg.): Kirchliche Zeitgeschichte. Urteilsbildung und Methoden, Stuttgart 1996, S. 101–124, S. 105.
21 Graf, Friedrich Wilhelm: Dechristianisierung. Zur Problemgeschichte eines kulturpolitischen Topos, in: Lehmann, Hartmut (Hg.), Säkularisierung, Dechristianisierung, Rechristianisierung im neuzeitlichen Europa, Göttingen 1997, S. 32–66, S. 52; Greschat, Martin: Rechristianisierung und Säkularisierung: Anmerkungen aus deutscher protestantischer Sicht., in: Lehmann, Säkularisierung, S. 76–85, S. 85; Schieder, Wolfgang: Säkularisierung und Sakralisierung der religiösen Kultur in der europäischen Neuzeit. Versuch einer Bilanz, in: Lehmann, Säkularisierung, S. 309–313, S. 310.