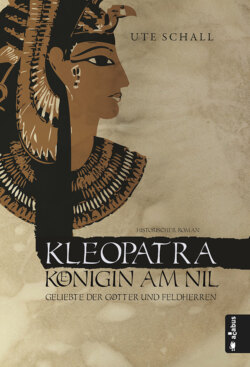Читать книгу Kleopatra. Königin am Nil - Geliebte der Götter und Feldherren - Ute Schall - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDer Bürgerkrieg und das Ende des Pompeius Magnus
„Hast du es auch schon gehört? Es heißt, der verwegene … “ Die Leute auf der Straße flüsterten hinter vorgehaltener Hand. Wem sollte man sich anschließen? Wem recht geben? Was würde aus ihnen, den einfachen Leuten, was aus Rom? Schon kam das Gerücht auf, die Senatorenschaft habe in seltener Einmütigkeit beschlossen, die Hauptstadt zu verlassen. Das sah den Herren ähnlich. Aber konnte man von diesen dekadenten Stadtvätern etwas anderes erwarten? Waren sie nicht schon immer nur auf den eigenen Vorteil bedacht gewesen? „Väter, dass ich nicht lache! Von einem Vater würde man ein wenig Fürsorge erwarten und nicht, dass er sich feige aus dem Staub macht.“
Die Empörung in Rom war groß, auch in der Oberschicht. Hatte es je ein römischer Heerführer gewagt, seine Truppen gegen die eigene Vaterstadt zu führen? Man mochte sich noch so sehr darüber aufregen, man wusste, dass man Caesar kaum etwas entgegen zu setzen hatte. Angst und Schrecken lähmten die „Ewige Stadt“, wie man Rom allmählich zu nennen begann. Wie würde dieser Konflikt enden? War der Niedergang der über Jahrhunderte geheiligten res publica aufzuhalten? Offensichtlich strebten beide Kontrahenten nach der Alleinherrschaft. Nur schien der gemäßigte Pompeius von beiden das geringere Übel zu sein. Vielleicht sollte man sich eher ihm anschließen, wollte man wenigstens Grundzüge der alten und bewährten Staatsform erhalten.
Dass Pompeius über eine größere Anzahl von Streitkräften verfügte und überhaupt von beiden der Mächtigere war, stand zweifelsfrei fest. Nur waren seine Soldaten in Spanien stationiert. Was also konnten sie nützen? Nie hätte er damit gerechnet, dass sein Gegenspieler die Dreistigkeit besäße, das Imperium an seiner verwundbarsten Stelle herauszufordern, an der Hauptstadt selbst, die auf eine derartige Situation alles andere als vorbereitet war. Es bestand kaum Aussicht, die spanischen Einheiten noch rechtzeitig nach Italien zu führen und dem Gegner entgegen zu setzen. Also begann Pompeius, neue Truppen zu rekrutieren. Aber Caesar war schneller.
Nach nur kurzem Widerstand ergab sich die Hauptstadt des mächtigen Reiches und dazu noch einem aus den eigenen Reihen. Die Verwirrung nahm ungeahnte Ausmaße an. In seiner Not forderte Pompeius Magnus den Senat auf, Italien sofort zu räumen, denn er könne das Mutterland des Imperiums mit den ihm zur Verfügung stehenden Soldaten nicht mehr halten. Er selbst werde sich, ließ er die eingeschriebenen Väter wissen, zunächst vor seinem Gegner in Griechenland in Sicherheit bringen und von dort aus unter dem Schutz seiner mächtigen Flotte das verlorene Terrain zurückgewinnen. Hals über Kopf folgten ihm die meisten Senatoren, hohe Beamte und viele Adelige über das Meer und ließen Frauen, Kinder und den Mann auf der Straße im Stich.
Es dauerte keine zwei Monate, da hatte Caesar ganz Italien in Besitz. Da er von seiner bereits sprichwörtlichen Milde Gebrauch machte und sich gegenüber jedermann freundlich und leutselig verhielt, liefen Pompeius’ Soldaten in Scharen zu ihm über. Vorerst vermied er eine Verfolgung der Fliehenden. Zum einen drohte in Spanien eine gewaltige feindliche Armee. Zum anderen verfügte er über keine Flotte, die das Übersetzen über die Adria ermöglicht hätte. Auch mussten zunächst die Verhältnisse in Rom selbst geklärt werden.
Es fiel Caesar nicht allzu schwer, das auf der Iberischen Halbinsel stationierte Heer, das nach Pompeius’ Flucht führerlos war, zur Kapitulation zu zwingen. Die Getreidezufuhr nach Italien hatte er durch zwei Legionen, die er nach Sizilien, zur Kornkammer des Reiches, abkommandiert hatte, gesichert. Auf dem Rückmarsch nach Italien nahm er Massilia ein und rückte dann in unglaublicher Geschwindigkeit nach Rom vor, das vor seinem Erscheinen mehr denn je zitterte. Jedermann befürchtete, die schrecklichen Zeiten der Proskriptionen eines Sulla würden sich nun wiederholen. Man war auf ein baldiges Ende gefasst. Doch dann geschah, was einem Wunder gleichkam. Caesar, vor dem man sich so sehr gefürchtet hatte, ließ öffentlich verkünden, es sei genug Blut geflossen. Er begnadigte seine Gegner und rief die Geflohenen zurück. Aus Dankbarkeit wurde er zum Konsul gewählt. Einmal im Amt, besetzte er alle Schlüsselpositionen mit seinen Anhängern.
Ob so großartiger Erfolge seines Gegners sah sich Pompeius Magnus bald in die Defensive gedrängt. Er wollte den Kampf dennoch nicht verloren geben. Noch nicht.
Nachdem Caesar den Rubikon überschritten hatte, war auch Roms Satellitenstaaten rasch klar geworden, dass sein Vorgehen nur Bürgerkrieg bedeutete, aus dem sie sich kaum würden heraushalten können. Ägypten gehörte zu den ersten, die begriffen, was von einem Freund und Bundesgenossen des römischen Volkes erwartet wurde. Es dauerte nicht lange, da erschien eine Abordnung des Pompeius in Alexandria, angeführt von seinem gleichnamigen Sohn, und bat um Militärhilfe für den Kampf gegen Caesar. Vor allem Kriegsschiffe begehrte der Römer, der den jungen König daran erinnerte, wie bereitwillig Pompeius Magnus seinem Vater Ptolemaios geholfen hatte, den Thron zurück zu gewinnen. Zudem wies er diskret auf die hohen Beträge hin, die Ägyptens Staatsführung Rom noch immer schuldete, da die aufgenommenen Kredite in der kurzen Zeit, die nach Ptolemaios’ Rückkehr an den Nil bis zu seinem Tod verstrichen war, nicht hatten beglichen werden können.
Gnaeus Pompeius dem Jüngeren entging in Alexandria nicht, wie gespannt die Atmosphäre war. Er traf sich mit der jungen Königin, die ihn tief beeindruckte. Er hatte schon viel von Kleopatra gehört, über die man sich ja in Rom die wildesten Geschichten erzählte. Aber als er sie zum ersten Mal erblickte, verschlug es ihm buchstäblich die Sprache, was die Königin mit nachsichtigem Lächeln zur Kenntnis nahm. Sie saß auf einem goldenen Thron, eine zierliche, in ein hauchzartes Gewand gehüllte Frau, der ein schwarzer, nur mit einem Lendenschurz bekleideter Sklave Luft zufächelte. Als Zeichen ihrer Macht trug sie die Geierhaube über dem pechschwarzen, zu dünnen Zöpfen geflochtenen Haar. Auf ihren Schultern lag ein Pektoral aus Gold und Lapislazuli. Auf Bart, Geißel und Krummstab hatte sie diesmal verzichtet.
„Willkommen in Alexandria!“, begrüßte sie den römischen Gast mit einem leichten Senken des Kopfes. Unwillkürlich zwang es den Römer zu einer tiefen Verbeugung, ohne dass er seinen Blick von Kleopatra abwenden konnte. „Ich höre, du bist zu uns an den Nil gekommen, um unsere Unterstützung im Kampf gegen den Feind deines Volkes zu erbitten“, fuhr die Königin fort. Der junge Pompeius war unfähig zu antworten. Nie zuvor hatte er eine solche Frau gesehen. Gewiss, er kannte viele adelige Damen zu Hause in Rom, die sich stets vornehm und zurückhaltend gaben, die züchtig gekleidet waren und nur sprachen, wenn man sie ausdrücklich dazu aufgefordert hatte. Sie hielten sich auch weitgehend aus dem politischen Geschehen heraus. Undenkbar, dass eine Frau an der Spitze der römischen Staatsführung stünde, wenn er sich auch der Tatsache bewusst war, dass der mittelbare Einfluss vieler Frauen auf das öffentliche Leben gar nicht so gering war, wie es den Anschein hatte. Hatte nicht ein weiser Mann schon vor Zeiten richtig erkannt, dass der Römer zwar die Welt beherrsche, den Römer aber das Weib?
Sein lüsterner Blick blieb auf Kleopatras kleinen, festen Brüsten hängen, die sich unter dem durchsichtigen Gewand verführerisch abzeichneten, und an der dunklen Scham, die ungeahnte Freuden verhieß. „Gewiss, hohe Frau“, stotterte er endlich und trug der Königin mit wenigen Worten sein Anliegen vor. Kleopatra hörte ihn geduldig an. Es entging ihr nicht, welche Wirkung sie auf den Fremden ausübte und für einen kurzen Augenblick erwog sie, ihn endgültig in ihre exotischen Netze zu spannen. Er war ja ein stattlicher Mann, dieser junge Pompeius, und schien viel von der legendären Männlichkeit seines Vaters geerbt zu haben, dem er wie aus dem Gesicht geschnitten war. Allein seine Größe beeindruckte. Kleopatra erinnerte sich gut an Pompeius Magnus, den Vater, den sie auf seinem Landgut in den Albaner Bergen kennengelernt hatte. Und sie hatte sich damals – sie war ja noch ein Kind gewesen – gefragt, ob er das cognomen „Magnus“ wegen seiner Körpergröße oder wegen seiner Bedeutung trug. Den Kopf des Bittstellers zierte ein Kranz fülliger hellbrauner Locken. Die Sonne der Schlachtfelder hatte seinen Teint goldbraun gefärbt und seine dunklen Augen strahlten wie glühende Holzkohle. Gewiss ein Mann, wie ihn sich jede Frau wünschte, nachts, wenn sie der Schlaf floh oder es schien, als habe sie der Traumgott gänzlich vergessen. Wenn sie seine Blicke richtig deutete, fiele es ihr sicherlich nicht schwer, ihn in ihre Arme und in ihr Bett zu locken, und vielleicht könnte sie sogar einige Vorteile für ihr arg bedrängtes Land herausholen, wenn sie sich ihm hingäbe. Aber wäre es wirklich klug, ihn zu verführen und sich in seine Abhängigkeit zu begeben? Niemand konnte vorhersagen, wie der Bürgerkrieg enden würde. Was wäre, wenn Pompeius auf der falschen Seite stünde? Sie verwarf den Gedanken rasch wieder und beschloss, den Römer seiner wie auch immer gearteten Fantasie zu überlassen.
Mit ihrem Bruder, vielmehr mit dessen Ratgebern, kam sie überein, Gnaeus Pompeius 500 germanische und gallische Reiter, die in ägyptischen Diensten standen, sowie 50 Kriegs- und zehn Transportschiffe zur Verfügung zu stellen. Sie ahnte noch nicht, dass das die vorläufig letzte Entscheidung gewesen sein sollte, die sie als Königin gemeinsam mit ihrem jugendlichen Bruder traf.
Denn unentwegt und beharrlich arbeitete vor allem Ptolemaios’ Berater Potheinos an Kleopatras Entmachtung. Die Zahl ihrer Anhänger bei Hofe verringerte sich zusehends. Sie hatte keine Erklärung dafür und sie wusste auch nicht, wie sie dem entgegen wirken sollte. Es schien ihr, als spiele dabei die Garnison von Alexandria, deren Rückgrat sich seit den Tagen der Heimkehr von Kleopatras Vater Gabiniani nannte, also von Gabinius’ zurückgelassenen Truppen stammte, eine entscheidende Rolle. In ihren Heimatländern war es nicht üblich, einer Frau eine derartige Machtfülle einzuräumen, wie sie die Ägypter dieser Kleopatra gewährten, eine Unabhängigkeit, von der die Weiber zu Hause nicht einmal zu träumen gewagt hätten. Eine Frau hatte das Haus zu führen, ihren Mann zu bedienen und für den Nachwuchs zu sorgen. Damit erschöpfte sich die ihr von der Natur zugewiesene Rolle. Allen voran wurde der Militärtribun, ein unsympathischer Mann namens L. Severus, nicht müde, gegen die Königin, die sich eine derartige Stellung anmaßte, zu hetzen.
„Man sollte diesen Kerl einen Kopf kürzer machen“, wandte sich Kleopatra an ihren Lehrer, der sie wieder einmal in ihren Gemächern aufgesucht hatte und im Augenblick der einzige Vertraute war, den sie an diesem Hof noch besaß. „Und so wahr ich bald ohne meinen lästigen Bruder herrschen werde, werde ich nichts unversucht lassen, ihn zumindest aus meinem Land zu vertreiben.“ „Das dürfte nicht ganz einfach sein“, gab Apollodoros zu bedenken. „Schließlich ist er Römer und du hast selbst als ägyptische Königin keine Macht über ihn. Es sei denn, er ließe sich etwas zu Schulden kommen. Dann allerdings …“ „Mir wird schon etwas einfallen, unsere Freunde davon zu überzeugen, dass er hier unerwünscht ist.“ Kleopatra gab sich zuversichtlich. „Das darfst du mir glauben, Apollodoros. Doch wenn wir schon bei den Römern sind, was hört man vom römischen Bürgerkrieg?“
„Nichts, wovon du nicht bereits Kenntnis hättest, meine Königin. Es scheint, als bräuchten die Kontrahenten Zeit, sich zu entspannen und über das weitere Vorgehen nachzudenken, ehe sie zum letzten Schlag ausholen. Gaius Iulius Caesar hat mittlerweile ganz Italien unter seine Herrschaft gebracht. Pompeius und fast alle Senatoren sind aus Rom geflohen und halten sich derzeit in Griechenland auf. In Alexandria werden bereits Wetten darauf abgeschlossen, wer von beiden das Rennen machen wird, Caesar oder Pompeius. Noch liegt Pompeius Magnus vorne, aber der Julier holt mächtig auf. Manche räumen ihm schon die größeren Chancen ein. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie die Sache ausgehen wird.“
Derweil hatten die Ressentiments der Gabiniani gegen die Königin ein bislang nicht für möglich gehaltenes Ausmaß angenommen. Behaglich hatte sich die römische Truppe am Nil eingerichtet, und sich an das trockene Klima und die angenehmen Lebensverhältnisse gewöhnt, als sie eine Order des neuen Statthalters von Syrien, Marcus Calpurnius Bibulus, erreichte. Bibulus befahl einem Teil der Soldaten, unverzüglich nach Syrien aufzubrechen und ihn in einem neuerlichen Feldzug gegen die Parther zu unterstützen. Das Ansinnen löste bei den Männern Unruhe und Empörung aus, störte es sie doch in ihrer Beschaulichkeit. Viele von ihnen hatten sich einheimische Frauen genommen, hatten Kinder gezeugt und ihre gemütlichen Behausungen allenfalls ab und zu verlassen, wenn gegen Aufständische in Ägypten selbst vorzugehen oder Präsenz zu zeigen gewesen war. So hatte es ihnen Gabinius befohlen. Einen anderen Kommandanten als ihn oder den hinter ihm stehenden Pompeius erkannten sie nicht an. Was also sollten sie in Syrien? Und was gingen sie überhaupt diese Parther an? Die beiden Gesandten, die Bibulus an den Nil geschickt hatte, um die Forderung zu überbringen, zwei seiner leiblichen Söhne, wurden von den Gabiniani ermordet, und niemand zeigte sich bereit, der Aufforderung zum Heeresdienst Folge zu leisten.
Zu Recht war der Vater vor allem über die Tötung seiner Söhne erzürnt. Er verlangte von Kleopatra die Herausgabe der Mörder, um sie zu bestrafen. Das aber brachte die Königin in eine missliche Lage. Durch ein bloßes Ausdrücken des Bedauerns und der Anteilnahme ließe sich Bibulus nicht besänftigen. So viel stand fest. Doch die Auslieferung der Schuldigen beraubte sie sicherlich der letzten Sympathien, die sie bei der römischen Schutztruppe noch genoss. Schließlich musste sie erkennen, das ihr keine andere Wahl blieb, als Bibulus’ Wünschen zu entsprechen, wollte sie die Römer nicht ganz und gar gegen sich aufbringen. Eine kleine Schutztruppe vor der eigenen Haustüre vor den Kopf zu stoßen war eine Sache. Die Weltmacht Rom herauszufordern eine andere.
Geschickt nutzten Ptolemaios’ Berater das Dilemma, in dem die Königin steckte. Sie ließen die über die Entscheidung äußerst aufgebrachten Männer wissen, sie hätten die Auslieferung nicht zu verantworten. Wäre es nach ihnen gegangen, hätten sie sich gewiss schützend vor ihre Gabiniani gestellt. Aber Kleopatra sei nun einmal die alleinige Herrscherin und habe selbstherrlich, wie das so ihre Art sei, die man ja kenne, von ihrer Macht Gebrauch gemacht. Ihr Stern war nun endgültig am Sinken und ihr Sturz in die nahe Zukunft gerückt.
Die Palastanlage der königlichen Familie lag außerhalb der Stadt am Ufer des Meeres, ein einsames Refugium, das die Fröhlichkeit der Welt, den Lärm der Straße und die schlechten Gerüche, die aus den Häusern der Armen kamen, außen vor ließ. Nachts, wenn im Haus alles schlief, hörte Kleopatra das Meer rauschen, es flüsterte, es stöhnte, es lockte, und oft genug schlich sich die junge Königin an den Strand, um das Wasser zu beobachten, das im Mondlicht silbern glitzerte. Fern von hier, wo die Wellen an andere Ufer schlugen, lag Rom, das geliebte, das verhasste Rom, von dem sie so wenig wusste, von dem sie nichts aus eigener Anschauung kannte, weil Pompeius Magnus, der sich als Freund ihres Vaters ausgegeben hatte, sie gezwungen hatte, fern der Hauptstadt in seiner Villa in den Albaner Bergen auf ihre Zukunft zu warten. Immer, wenn sie hierher kam und ihre Sehnsucht über das Meer schickte, schwor sie sich, eines Tages in Rom Einzug zu halten, nicht als arme Bittstellerin, die sie damals gewesen war, sondern als Königin des Reiches am Nil, die gekommen war, ihre römischen Freunde zu besuchen. Oder gar als Herrscherin über die erhabene Roma selbst? Nein, daran war nicht zu denken!
Durch die geschlossenen Läden der wandhohen Fenster drang nichts von dem gleißenden Licht des hohen Sommertags. Schon seit Monaten ging die Dienerschaft gesenkten Hauptes schweigend ihrer Arbeit nach. Jedermann fühlte die unbestimmte Spannung, die in der Luft lag, die drückend, schwer und nahezu unerträglich auf den Gemütern lastete. Verstummt waren Flöten und Schalmaien, deren silberheller Klang früher so oft die Säle erfüllt hatte, die Säulengänge, weitläufigen Flure und Zimmerfluchten und die blühenden Gärten mit ihren Schatten spendenden Feigen- und Ölbäumen, den duftenden Lotusblüten und den hohen Papyrusstauden. Auletes, der Flötenspieler, lebte nicht mehr. Von Tag zu Tag fühlte sich Kleopatra einsamer. Selbst Apollodoros gelang es nicht, ihr die düsteren Gedanken zu vertreiben. Wehmütig erinnerte sie sich an Nefer, die Gespielin ihrer Kindheit, die einzige geliebte Schwester, die alles Unheil von ihr fern gehalten hatte. Bis zuletzt. Bis sie sich selbst geopfert hatte. Ob es in ihrem Leben noch einmal eine Freundin wie Nefer geben würde?
Als vornehme Dame verkleidet, streifte Kleopatra in Begleitung nur einer Dienerin über Alexandrias großen Sklavenmarkt. Es war einer jener Hochsommertage, an denen eine unbarmherzige Sonne in wenigen Wimpernschlägen die Haut verbrannte. Nie zuvor hatte sie sich als Königin in ihrem Land persönlich in das Getümmel der Stadt begeben und unter das gemeine Volk gemischt, das ihr laut und schmutzig vorkam, die meisten Menschen ungewaschen, viele vom Genuss des Bieres, das auch in dieser Stadt so reichlich floss, schon am Morgen betrunken. Eine dicke Schwade von Knoblauchgeruch wehte ihr entgegen. Kleopatra hielt sich die Nase zu. „Warum arbeiten diese Leute nicht?“, wandte sie sich an ihre Dienerin, ohne jedoch eine Antwort zu erwarten. Heftiger Vorwurf lag in ihrer Stimme. Auch die Kleine war ja wie ihre Herrin über die Palastmauern nie hinausgekommen. Statt die Königin anzusehen, fing das Mädchen an entsetzlich zu weinen, sodass Kleopatra sanft den Arm um ihre Schultern legte und versuchte, sie mit freundlichen Worten zu trösten. Da stand sie, die menschliche Ware, zitternd, nackt und bloß am Straßenrand, den mehr oder weniger fachmännischen Blicken der Vorübergehenden schutzlos preisgegeben. Ein Schild, das über das ungefähre Alter, den Namen und die Vorzüge ihres Körpers Auskunft gab (und die Mängel verschwieg), um den Hals gebunden. Lautstark priesen die Händler ihr Handelsgut an und machten mit Schellengeläut auf sich und das, was sie anzubieten hatten, aufmerksam.
Aber Kleopatra ließ sich nicht beeinflussen. Doch was suchte sie eigentlich? Oder was hoffte sie zu finden? Mit sicherem Schritt und feinem Gespür ging sie geradewegs auf ein Mädchen zu, das ängstlich und scheu vor der vornehmen Dame den Blick senkte. „Wie heißt du?“, wollte sie von der Kleinen wissen, einem halben Kind noch, das kaum in die Pubertät gekommen war. „Ich habe meinen Namen vergessen, hohe Frau“, flüsterte das zitternde Wesen demütig. „Sieh mich an!“, befahl Kleopatra und erschrak selbst über die Strenge, die sie unbewusst in ihre Stimme gelegt hatte. Langsam erhob die junge Sklavin den Blick und die Königin erschauderte erneut. Noch nie hatte sie in solche Augen gesehen, wissende, geheimnisvolle Augen, die in höchste Höhen und in tiefste Abgründe geschaut und alles bewahrt hatten, Freude, Leid, Entzücken und Qual. Das gesamte Schicksal der Menschheit schien ihr aus diesen Augen entgegen. Angezogen und abgestoßen zugleich, rief sie den Verkäufer heran. „Was verlangst du für sie?“, richtete sie sich an den erstaunten Mann. „Für sie?“, fragte er ungläubig. „Wollt Ihr wirklich …?“ „Habe ich mich nicht deutlich ausgedrückt?“, herrschte ihn die Königin an. Dann befahl sie, der Kleinen die Ketten abzunehmen, die sie an einem Holzpfahl festhielten, und legte ihr um die Schultern ein Tuch, das die Blöße des Kindes bis zu den Fußspitzen verdeckte. „Ab heute gehörst du mir.“ Freundlich nahm sie das Mädchen an der Hand. Ein kleiner, zitternder Vogel, der aus dem Nest gefallen ist, dachte sie. „Ich werde dich Merit nennen, das scheint mir der passende Name für dich zu sein. Ob du Griechin bist oder Ägypterin oder gar Jüdin, es spielt keine Rolle. Fürchte dich nicht, Merit! Du wirst es gut bei mir haben. Denn du wirst nur mir dienen und unter meinem persönlichen Schutz stehen. Nefer, verstehst du, sie fehlt mir so sehr. Du wirst mir eine zweite Nefer sein.“ Aber wie sollte das zitternde Kind die fremde Dame verstehen?
Nach Kleopatras Entscheidung, die Mörder der Söhne des Bibulus auszuliefern, wandte sich die römische Einheit ganz von ihr ab und dem jungen Ptolemaios zu. Sie hatte es nicht anders erwartet. Die Männer verlangten immer entschiedener, Kleopatras Anhänger hinzurichten, die Königin zu verjagen und Ptolemaios als alleinigen Herrscher auf den Thron zu setzen. Die Lage in Alexandria heizte sich derart auf, dass Kleopatra um ihr Leben fürchtete. Mit nur wenigen Getreuen floh sie nach Oberägypten, wo sie nach wie vor beliebt war. Doch sie erkannte bald, dass sie auch dort in Gefahr war. Potheinos’ Macht reichte weit. Und er würde weder Mittel noch Wege scheuen, ihr überall im eigenen Land nachzustellen. Doch wohin sollte sie noch fliehen? Sie dachte nicht daran, ihrem einfältigen Bruder das Feld kampflos zu überlassen. Als armselige Pilgerin verkleidet brach sie schließlich Richtung Syrien auf und fand in Askalon, einer Hafenstadt im alten Philisterland, das neben dem Judenstaat lag, eine Bleibe. Mit dem Geld, das sie der Staatskasse entnommen hatte, warb sie Truppen an. Sie gedachte, gegen ihr Heimatland zu ziehen und ihre Stellung zurückzuerobern.
Ihre Entschlossenheit ließ die Berater ihres Bruders aufschrecken. Hatte sich nicht auch in Rom gerade erst einer aus den eigenen Reihen gegen die Staatsführung gestellt? Eilig schickten sie die ägyptische Armee der Königin entgegen. Sie hofften, die bloße Drohgebärde werde Kleopatra davon abhalten, in Ägypten einzudringen. Und wenn nicht, musste die Sache eben mit militärischer Gewalt geklärt werden. Zu einem Aufeinandertreffen kam es aber nicht. Wieder einmal mischte das Schicksal die Karten anders. Und wieder einmal hieß das Schicksal Rom.
Als Freund des verstorbenen Ptolemaios und Hüter von dessen letztem Willen, der ausdrücklich die gemeinsame Herrschaft der Ptolemäer-Geschwister bestimmt hatte, hätte Pompeius Magnus eigentlich auch für Kleopatra Partei ergreifen und die Durchsetzung ihrer Ansprüche gegen den Bruder erwirken müssen. Aber die politische Lage Roms und die, in der sich Pompeius selbst befand, verlangten, wie er meinte, eine andere Regelung. Sicherlich war der minderjährige König leichter zu lenken als die für ihre Zielstrebigkeit allseits bekannte Schwester. Und auf Ägypten konnte er im Kampf um die Vorherrschaft in Rom nicht verzichten.
So empfahl er den wenigen in der Hauptstadt zurückgebliebenen Senatoren, Ptolemaios als Alleinherrscher anzuerkennen, eine Anregung, der sie geschlossen folgten. Kleopatra schien ausgespielt zu haben.
„Er ist ein Verräter“, wandte sie sich an Apollodoros, „aber er irrt sich, wenn er glaubt, dass ich so sang- und klanglos von der Bildfläche verschwinde. Freilich weiß ich, dass meine Aussichten, jemals wieder in mein Land zurückkehren und dort regieren zu dürfen, äußerst gering sind. Pompeius wünsche ich die Pest an den Hals! Ich kann nur hoffen, dass Caesar aus diesem Zweikampf als Sieger hervorgehen wird. Gaius Iulius Caesar! Man sagt, er sei weiblichen Reizen noch nie abgeneigt gewesen. Und er schätze Frauen, die über einen klaren Verstand verfügen. Dem Manne kann geholfen werden.“
Pompeius regte weiter an, auch Ptolemaios dem Jüngeren den Titel „Freund und Bundesgenosse des römischen Volkes“ zu verleihen. Er selbst gedachte, über den jungen, unerfahrenen König die Vormundschaft auszuüben. Allenthalben nannte man ihn schon „Tutor des Ptolemaios“. Sollten die gnädigen Götter ihm den Sieg gewähren – woran eigentlich kein Zweifel bestand –, hätte er mit Ägypten bereits einen wichtigen Verbündeten. Auch diesem Vorschlag stimmten die eingeschriebenen Väter einstimmig zu.
Der römische Bürgerkrieg hatte Potheinos’ Macht erheblich gestärkt. Er führte den Staatsrat an, und Ägypten befand sich dank seiner Voraussicht in einer glücklichen Lage. Wer auch immer den Kampf für sich entscheiden mochte, Alexandria hatte nichts zu befürchten. Würde Pompeius siegen, was freilich für Ägypten die einfachere Lösung wäre, dann wäre der mächtigste Römer durch die eingegangenen Verpflichtungen gegenüber Ptolemaios XIII. gebunden. Doch selbst, wenn der Sieg Caesar zufallen sollte, was Potheinos allerdings für wenig wahrscheinlich hielt – aber wer kannte schon die Launen der Götter? –, dann könnte man sich immerhin darauf berufen, dass man Pompeius sowohl durch das Gastrecht als auch vertraglich verpflichtet gewesen sei und somit gar keine Wahl gehabt hätte. Die Machtverhältnisse im Osten hätten nun einmal für Pompeius gesprochen. Doch würde sich ein Gaius Iulius Caesar von diesen Argumenten überzeugen lassen? Würde er Ägypten nicht gleich zur römischen Provinz und damit einen König überflüssig machen? Er hatte doch schon einmal einen begehrlichen Blick auf das alte Land geworfen, wenn die Sache auch Jahre zurücklag.
Die Königin langweilte sich. „Warum dauert das alles so lange?“, wollte sie von Apollodoros wissen, den sie diesmal in seinen Gemächern aufgesucht hatte. Er bewohnte ein einfaches Arbeitszimmer, in dem auch eine harte Pritsche stand. Ein mit allerlei Schriften belagerter Tisch und ein Holzstuhl waren daneben die einzigen Möbelstücke, die Kleopatra fand. „Wenn es nach mir ginge, dann läge dieser schmierige Eunuch Potheinos längst in Ketten“, bemerkte sie und sah sich neugierig in dem kargen Raum um. Unverständlich, dass man in solcher Einfachheit leben konnte, auch wenn dies hier keine Bleibe auf Dauer war und sie vielleicht bald nach Alexandria zurückkehren konnten. Sie hatte sich bisher darüber keine Gedanken gemacht. „Noch ein wenig Geduld, Herrin“, entgegnete der Vertraute ruhig. „Ich begrüße dich in meiner bescheidenen Behausung und bitte um Vergebung. Du bist anderes gewohnt, wie ich weiß. Aber mir genügt es. Ohnehin erlaubt mir meine Zeit nicht, meine Gedanken an irgendwelchen Luxus zu verschwenden. Gut, dass du kommst. Ich hätte dich sowieso bald aufgesucht. Es gibt nämlich Neuigkeiten von der römischen Front. Aber ich würde sie dir gern …“ Er warf einen Blick auf Merit, die, in ein edles Gewand gekleidet und die Haare nach ägyptischer Mode glatt frisiert, ihrer Herrin wie ein kleines Äffchen nicht von der Seite wich. Als Kleopatra bei Apollodoros eingetreten war, hatte sie sich vor die Königin gestellt, als müsse sie diese vor bösen Geistern schützen. „Du kannst reden, mein Freund!“, meinte Kleopatra lächelnd. „Meine kleine Merit ist mir längst zur liebsten Freundin geworden. Es scheint, als habe ich in ihr wirklich eine zweite Nefer gefunden.“ Damit streichelte sie dem Mädchen über das braune glänzende Haar und schob es sanft zur Seite.
„Nun“, begann Apollodoros vorsichtig, ohne den Blick von der Sklavin zu wenden, „mir wurde zugetragen, dass sich die Verhältnisse wohl zu Gunsten Caesars entwickeln. Gegen Ende des Sommers hat er über Pompeius’ Heer in der Ebene von Pharsalos in Griechenland einen entscheidenden Sieg errungen. Dabei scheinen Pompeius’ Fußtruppen und auch seine Reiterei denen des Juliers weit überlegen gewesen zu sein. Aber Caesar hatte die geschicktere Taktik. Die kampferprobten Veteranen seiner berühmten zehnten Legion sollen dabei die entscheidende Rolle gespielt haben. Soll er es doch wie kein anderer verstehen, seine Männer an sich zu binden, auch wenn diese längst nicht mehr aktiv dienen. Wie auch immer. Pompeius hätte gut daran getan, an seinem ursprünglichen Plan festzuhalten, die Entscheidungsschlacht zu verschieben. Aber er sei von seiner Umgebung so sehr gedrängt worden, dass er sich entschlossen habe zu handeln. Ein verhängnisvoller Fehler. Ausschlaggebend, seine Streitmacht dem Gegner entgegen zu stellen, sei jedoch ein Traum gewesen: Er habe sich das von ihm erbaute Theater in Rom betreten gesehen, wo eine riesige Menschenmenge seine Ankunft mit tosendem Beifall feierte. Auch habe er im Traum den Tempel der Venus Victrix mit zahllosen Beutestücken geschmückt. Dieses günstige Omen habe letztlich seinen Sinneswandel bewirkt.“
Ganz nahe trat Apollodoros an Kleopatra heran, die ihm aufmerksam zuhörte. „Aber ich will dich nicht auf die Folter spannen, meine Königin. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Pompeius begriff also, dass die Schlacht für ihn verloren war, und zog sich deprimiert in sein Lager zurück. Aber die feindlichen Truppen folgten ihm auf den Fersen. Als Caesars Männer in seine Unterkunft eindrangen, suchte er sein Heil in der Flucht, wobei er seine Leute schmählich im Stich ließ. Er floh Richtung Küste und fand ein römisches Handelsschiff. Dem Kapitän bezahlte er ein hohes Bestechungsgeld und wurde dafür mit den wenigen Getreuen, die ihm geblieben waren, an Deck genommen. In Mytilene auf Lesbos wurden die Flüchtlinge abgesetzt. Dort raffte er einige Schiffe zusammen, nahm seine Frau Cornelia an Bord und reiste weiter nach Pamphylien, wo sich ihm kilikische Flotteneinheiten anschlossen. Als auch noch 60 Senatoren zu ihm stießen, fasste er neuen Mut. In Dyrrhachium aber, wo die Hauptmacht seiner Flotte lag, brach das Chaos aus, als man vernommen hatte, dass der große Pompeius feige geflohen war.“
„Was ist mit unseren Leuten?“, wollte Kleopatra, die ihren alten Lehrer bislang nicht unterbrochen hatte, wissen. „Was ist mit den Schiffen, die wir seinem Sohn zur Verfügung gestellt haben?“ „Sie scheinen alle unversehrt zu sein“, antwortete Apollodoros, „angeblich liefen sie bereits – wie auch die rhodische Flotte – ihren Heimathafen an. Wir erwarten sie also in Kürze.“ „Den Göttern sei Dank!“ Kleopatra war erleichtert. „So wurden meine vielen Gebete doch erhört.“ „Noch ist nichts endgültig entschieden, meine Königin“, warnte Apollodoros. „Sollte Caesar sein sprichwörtliches Glück weiterhin die Treue halten, so bleibt doch abzuwarten, wie er sich uns gegenüber verhalten wird. Und das Problem Pompeius ist noch keineswegs gelöst. Wie wird Caesar mit ihm verfahren, wenn er seiner habhaft wird? Was werden Pompeius’ Anhänger tun? Du siehst, es ist noch viel zu früh, sich zu freuen. Hoffen freilich darfst du.“
Als Pompeius mit seinen Anhängern vor der Insel Rhodos ankern wollte, verweigerten ihm die Rhodier die Unterstützung. Seine Gesandten durften den Inselhafen nicht einmal anlaufen. In seiner Verzweiflung wandte er sich mit der Bitte um Hilfe an den Partherkönig. Aber der römische Erzfeind weigerte sich, einem Römer in Not entgegen zu kommen. Warum auch? Seit Menschengedenken bekriegten sich die beiden Völker, auf beiden Seiten waren Ströme von Blut vergossen worden. Dass der große Pompeius nicht einmal davor zurückschreckte, die verhassten Parther um Unterstützung anzuflehen, brachte viele seiner Landsleute gegen ihn auf. Ohnehin war ein Großteil seiner Truppen bereits ins feindliche Lager übergelaufen.
Was sollte er tun? Er wollte auf keinen Fall den Kampf vorzeitig aufgeben und Caesar das Feld überlassen. Noch bestand ja Hoffnung. War er nicht der, den die Geschichte bereits zu Lebzeiten mit dem seltenen Titel „Der Große“ ausgezeichnet hatte? Er musste sich dieser Ehre würdig erweisen. Er musste kämpfen bis zum Tod. Ägypten kam ihm in den Sinn. Die letzte Zuflucht und das Reich, von dem aus sich eine Rückkehr an die Macht noch am ehesten organisieren ließe. Hatte er nicht erst vor Kurzem die Alleinherrschaft des Ptolemäerkönigs anerkannt und sich als dessen Tutor bezeichnet? Hatte ihm Ägypten nicht im Kampf gegen Caesar See- und Landstreitkräfte zur Verfügung gestellt? Zuversichtlich ließ er die Anker lichten. Immerhin begleiteten ihn schon wieder 2000 Bewaffnete. In Pelusion, wo sich Kleopatras und Ptolemaios’ Armeen noch immer feindlich gegenüber lagen, gedachte er, an Land zu gehen und vom König weitere Unterstützung zu fordern.
Aber Ptolemaios’ Beraterstab hatte sich nach heftigen Diskussionen bereits von ihm abgewandt und vorausschauend auf die Seite des Siegers geschlagen.
Theodotos hatte inzwischen von seiner sprichwörtlichen Redekunst Gebrauch gemacht und seine Mitstreiter ohne große Anstrengung davon überzeugt, Pompeius zwar kommen zu lassen, doch sofort umzubringen. Nur so werde man sich Caesar gefällig erweisen. Lächelnd hatte er noch hinzugefügt: „Ein Toter beißt nicht.“ Eifrig war Potheinos seinem Gesinnungsgenossen beigesprungen. Aus allen Ländern, hatte er argumentiert, sei Pompeius schon vertrieben worden, und jetzt suche er, der kein Vertrauen in die Zukunft mehr habe, ausgerechnet Schutz bei einem Volk, das er in seinen eigenen Untergang mitziehen werde. Die Schatten der vielen im Bürgerkrieg Gefallenen, deren Tod er zu verantworten habe, zögen ihn mit sich hinab.
Doch wie sollte man sich des Verlierers entledigen, wie dessen Beseitigung rechtfertigen? Auch dafür hatte Potheinos Rat gewusst. Man fürchte, so ließ er verbreiten, Pompeius könne das königliche Heer aufwiegeln und versuchen, das alte Land am Nil unter seine Kontrolle zu bringen. Und da gäbe es noch die Gabiniani, die auf ihn eingeschworen waren. Niemand könne vorhersagen, wie sie sich verhalten würden. Am Ende würde noch der römische Bürgerkrieg in seiner entscheidenden Phase auf ägyptischem Boden ausgetragen. Zumindest das zu verhindern rechtfertigte in den Augen der ägyptischen Führungsschicht den politischen Mord.
Nur wenige wurden in die blutigen Pläne des Staatsrats eingeweiht. Zu ihnen gehörten L. Septimius, ein Kommandant, der an Pompeius’ Seite bereits im Seeräuberkrieg gekämpft hatte, und Achillas. Beide verfolgten sicherlich auch eigene Interessen. Draußen auf der ruhigen See ankerte Pompeius’ kleine Flotte. Er ahnte, was die verschlagenen Ägypter vorhatten. Denn seit geraumer Zeit kreuzten bemannte königliche Schiffe vor dem Hafen, und am Ufer hatte sich bewaffnetes Fußvolk aufgestellt. Als beabsichtigten sie, einen lieben Gastfreund an Land zu begleiten, nötigten einige Männer den großen Römer auf ein kleines Boot. Kurz bevor dieses an Land ging, zog Septimius sein Schwert und stieß Pompeius nieder. Achillas sprang ihm bei. Sterbend zog der Gefallene die Toga über das Gesicht und fügte sich stöhnend in sein Schicksal. Der Leiche schlugen die Attentäter den Kopf ab und warfen sie nackt ins Meer. Der Freigelassene Philippus erbarmte sich seines Herrn, wusch den kopflosen Toten mit Meerwasser und errichtete am Strand aus dem aufgeschichteten Holz gestrandeter Schiffe einen Scheiterhaufen.
Mit Entsetzen hatten Pompeius’ Gattin Cornelia und sein Sohn Sextus das Geschehen beobachtet. Es war sinnlos, der großen Überzahl der Mörder entgegen zu treten. Dem Gatten und Vater konnten sie nicht mehr helfen. Sofort ließen sie die Anker lichten und versuchten, das offene Meer zu erreichen, was ihnen nur mit Mühe gelang. Andere aus Pompeius’ Begleitung hatten weniger Glück. Die ägyptischen Galeeren holten sie ein, nahmen Besatzung und Passagiere gefangen und töteten sie. Stolz sahen die Ägypter nun der nahen Zukunft entgegen. Sicherlich würde sie Caesar, der die Flüchtigen über das Wasser verfolgt hatte, für ihre Tat reich belohnen. Aber sie hatten sich gründlich getäuscht.