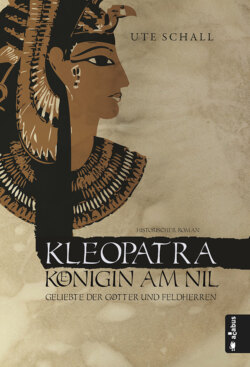Читать книгу Kleopatra. Königin am Nil - Geliebte der Götter und Feldherren - Ute Schall - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEreignisreiche Jugendjahre
„Ich kenne sie alle“, gestand Kleopatra. „Ich habe das Gestern gesehen, ich weiß, was vor 200 Jahren war, und ich kenne das Morgen. Ich sehe in die Herzen der Menschen, denn ich verstehe ihre Sprache.“
Das Mädchen war gerade fünf, als sich bereits ihre einzigartige Begabung bemerkbar machte. Ihr wacher Geist fing jedes Wort auf, jede Äußerung ihrer Untertanen, der Fremden, die nach Alexandria kamen, der Juden, die sich hier niedergelassen hatten, und nicht zuletzt die der zahlreichen Delegationen aus Parthien, Syrien und Punt, die vor dem Thron ihres Vaters erschienen, um ihm und seinem Reich ihre Aufwartung zu machen. Und schneller, als es je einem oder einer ihrer Sippe gelungen war, bildeten sich in ihrem Kopf aus dem Wort Silben, Wörter, Sätze und Geschichten, sodass jeder über das kleine Mädchen staunte, das in einem Alter, in dem andere Kinder noch mit Puppen und knöchernen Figürchen spielten, ihrem Vater schon eine große Stütze war. Er konnte sich auf seine Tochter verlassen. Kleopatra übersetzte und es dauerte nicht lange, da entfernte Ptolemaios alle anderen Dolmetscher von seinem Hof.
Die Kleine war nicht schön, was der Vater, der von sich selbst behauptete, ein Ästhet zu sein, oft bedauerte. Warum nur konnte die Natur nicht einmal eine Ausnahme machen und Schönheit und Geist in einem Menschenkind vereinen? Kleopatras Nase war etwas zu lang geraten, der Mund allzu üppig mit einem dennoch herben Zug über einem fliehenden Kinn. Ein wenig zu klein saß der Kopf auf einem langen, dürren Hals. Zudem war das Kind schmächtig geblieben, als weigere es sich zu wachsen. Ihre ganze Erscheinung hatte schon jetzt etwas Reifes, fast Greisenhaftes an sich und Ptolemaios befürchtete, dass sich daran auch nichts ändern würde. Oft hörte man den besorgten Vater seufzen. Ob sich für seine Tochter, die so gar nichts von der äußeren Schönheit ihrer ägyptischen Mutter geerbt hatte, außer vielleicht der olivfarbenen Haut, wohl je ein Mann fände? Andererseits hatten die Götter das Kind mit der Gabe eines überaus scharfen Verstandes gesegnet, vor dem er gelegentlich erschrak. War es denn möglich, dass ein Kind solcher Gedankengänge fähig war, dass ein Kind in Kleopatras Alter schon komplizierte politische Zusammenhänge verstand? Und auch noch ein Mädchen, dem die Gesellschaft doch traditionsgemäß jeden vernünftigen Gedanken absprach? Wenigstens in ihren geistigen Gaben schien sie das verkleinerte Abbild der großen königlichen Gemahlin zu sein und Ptolemaios genoss es, wenn die Kleine dafür von allen bewundert und mit einer gewissen Achtung bedacht wurde.
Nur wenige Jahre nach Kleopatras Geburt wurde die Mutter erneut schwanger. Bald kam Arsinoé zur Welt, die sich im Gegensatz zu ihrer oft nachdenklichen älteren Schwester zu einem fröhlichen, von jedermann geliebten und verhätschelten Mädchen entwickelte, deren silberhelles Lachen durch die weiten Zimmerfluchten des elterlichen Palastes drang. Auch Kleopatra war dem Charme des Kindes verfallen. War nicht die Schwester so, wie sie selbst gern gewesen wäre? Nicht nur, dass sie in Arsinoë eine willkommene Spielgefährtin fand, soweit ihre Bestimmung überhaupt irgendeine Art von Unbeschwertheit zuließ. Arsinoë war es vor allem gelungen, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und damit unbewusst der älteren Schwester eine Freiheit einzuräumen, von der sie sich nie hatte träumen lassen. Kleopatra hasste das höfische Protokoll, das ihr Leben auf so unangenehme Weise einschränkte, sodass sie sich oft wie in einem Kokon gefangen fühlte. Ein Mädchen tut das nicht, ein Mädchen darf jenes nicht. Das geziemt sich nicht für eine Königstochter. Sie hatte zu gehorchen. Naoma, erste Dienerin der großen königlichen Gemahlin, die längst zu einer Art Haushofmeisterin aufgestiegen war – Kleopatra pflegte sie „Hausdrachen“ zu nennen –, wachte mit Argusaugen über die Sittlichkeit der Königstöchter und wurde nicht müde, der unzähmbaren Älteren die gefügige Arsinoë als leuchtendes Beispiel vor Augen zu führen. Kleopatra mochte die Alte nicht, vor deren runzligem Gesicht sie sich, solange sie denken konnte, fürchtete und deren harte graue Augen unbedingten Gehorsam forderten. Und sie mochte sie mit den Jahren immer weniger, da ihr bewusst wurde, wie sehr die Ägypterin Ptolemaios verachtete, den überaus geliebten Vater, der freilich nicht dem gängigen Ideal eines Herrschers entsprach, des neuen gottgleichen Königs für das vereinigte Reich.
Der übermäßige Weinkonsum und die gewaltigen Berge von Nahrung, die der König zu verschlingen pflegte, ließen seinen ohnehin fülligen Leib immer mehr anschwellen. Dazu kam, dass er von Tag zu Tag bequemer wurde. Selbst innerhalb der Palastanlage ließ er sich mittlerweile tragen, was er mit Schmerzen in den Beinen begründete. Auf die vorwurfsvollen Blicke seiner Tochter hin hob er nur ohnmächtig die Schultern: „Das Alter, mein Kind, das Alter.“
Die Veränderung seines Körpers wirkte sich indes nicht auf die Zuneigung seiner Gemahlin aus, deren Herz auch nach so vielen Jahren des Zusammenlebens noch Freudensprünge tat, wenn sie seiner ansichtig wurde.
Auch in seinem Regierungsstil ließ der König nach. Er war nie ein herausragender Herrscher gewesen und hatte immer wenig Interesse an der Staatsführung gezeigt, und das wusste er auch. Ob seine Bauern genügend zu essen hatten, ob die Nilschwelle rechtzeitig eingetreten war, ob Seuchen seine Untertanen heimgesucht hatten, ja selbst jene religiösen Pflichten, die nach alter Sitte dem Staatsoberhaupt oblagen; das alles schien ihn nichts anzugehen. Zufrieden mit sich saß er in seinem Palast, der einem goldenen Käfig glich, empfing Gesandte, lud Künstler, Gelehrte und Philosophen ein und erfreute sich an gutem Essen, an Musik und Tanz. Schon lange war er dazu übergegangen, seine Tochter, die bei jeder Audienz neben ihm saß, in seine Entscheidungen einzubinden und ihr mehr und mehr Aufgaben zu übertragen. Und wieder bewies das Kind eine erstaunliche Klugheit und erntete allseits Bewunderung. War es normal, dass eine Zehnjährige, nach Art der alten Gottkönige gekleidet, geschminkt und mit Krummstab und Geißel angetan, vom Thron des Königs aus Recht sprach, wobei ihr der Vater nur assistierte? Dass sie es war, die die Abgesandten fremder Völker empfing? Dass sie Gesetze erließ, die bei aller Strenge durchaus vernünftig waren und das Zusammenleben der unterschiedlichen Stämme, die in ihrem Reich lebten, regelten? Bei allen Göttern, Kleopatra hätte das Zeug dazu, seine Nachfolgerin zu werden! Und sie würde eine bessere Regentin sein als er es war. Davon war Ptolemaios mittlerweile fest überzeugt. Aber sie war ja nur ein Mädchen. Offensichtlich hatte da die große Mutter Natur etwas verwechselt. Sie hatte versehentlich den Geist eines Mannes in den Körper einer Frau gesteckt. Doch hatte es im alten Land am Nil nicht auch so manche Königin gegeben, die zum Wohle ihrer Untertanen herrschte?
„Hermes-Thot“, empfing die Königin, deren Schönheit durch die Reife des Alterns noch aufgewertet worden war, ihren Gemahl, „nun, er hat mir im Traum mitgeteilt, dass es Amun-Re gefallen habe, meinen Leib erneut zu segnen. Und diesmal, mein König, wird er unsere Ehe mit der Geburt eines Thronerben beglücken. Das hat er mir fest versprochen.“ Dabei verbeugte sie sich mit gesenktem Blick achtungsvoll vor ihrem Mann. Er sollte nicht sehen, dass sie, die nicht nur in Liebesdingen erfahrene Frau, wie ein junges Mädchen errötete. Mit inniger Zärtlichkeit nahm der König das Gesicht seines Eheweibes in die Hände und hauchte ihr einen Kuss auf die glühende Stirn. Dann schloss er sie fest in die Arme.
„Da bist du ja endlich, mein Kind!“ Mit sanfter Gewalt löste sich die Königin aus der Umarmung ihres Gemahls und wandte sich ihrer älteren Tochter zu.
„Mutter!“ Kleopatra klang verstimmt. „Ich habe dich schon so oft gebeten, mich nicht immer ‚mein Kind‘ zu nennen. Denk doch bitte an die Dienerschaft! Nur noch zwei Sommer und ich werde in die Gemeinschaft der heiratsfähigen Frauen aufgenommen werden.“
„Und wenn du dreimal so alt wärest, mein Töchterchen! Du wirst immer mein Kind bleiben.“ Sie zog Kleopatra an sich und blickte ihr liebevoll in die geheimnisvollen grünen Augen. Besonders anmutig war sie auf den ersten Blick nicht, diese Tochter, da musste sie Ptolemaios recht geben. Und dennoch ging von ihr eine Anziehungskraft aus, die jenseits all dessen lag, was man gemeinhin als schön bezeichnete. Kleopatra würde eine faszinierende Frau werden, da war sich ihre Mutter ganz sicher, hervorragend durch Geist und Bildung und die größten Männer ihrer Zeit würden ihr zu Füßen liegen … Erwartungsvoll betrachtete das Mädchen die in Gedanken versunkene Königin.
„Mutter?“ Die Frau blickte auf. „Ich habe dich rufen lassen, um dir eine freudige Mitteilung zu machen. Du bist alt genug zu erfahren, was deinen Vater und mich so glücklich macht.“ Dabei ergriff sie die Hand ihres Gatten und führte sie an die Lippen. „In wenigen Wochen“, fuhr sie fort, „wird dir ein Bruder geboren werden und ich möchte ihn dir ans Herz legen. Wir sind alt, dein Vater und ich. Vielleicht nicht so sehr an Jahren, aber du weißt ja, vor dem Tod ist man niemals sicher. Wobei wir uns diesen natürlich völlig gegensätzlich vorstellen. Dein Vater glaubt an ein Schattendasein im unterirdischen Orkus und versucht, ein guter Mensch und ein gerechter Herrscher zu sein. Denn nur wer auf der Erde rechtschaffen lebt, kann nach seiner Ansicht auch auf ein erträgliches Dasein in der Unterwelt hoffen. Ich hingegen bin davon überzeugt, nach meinem Tod Osiris gleich zu neuem Leben zu erstehen. Durch Umarmung und Mundöffnung wird mich der Totengott Anubis wieder beleben und Isis und Nephtys werden mir zur Auferstehung in Gestalt des Gottes Horus verhelfen. Ptolemaios, dein Bruder, wird für seine Untertanen der neue sichtbare Horus sein und in ihm, meinem Sohn, werde auch ich in die Ewigkeit eingehen. Du siehst also, welch große Verantwortung ich dir auferlege, meine Kleopatra.“
Das Geständnis der Königin, wieder schwanger zu sein und einen Sohn zu erwarten, ließ die Tochter für einen Augenblick einen Anflug von Eifersucht verspüren. Gehörte der Vater nicht ihr allein? Sollte sie ihn etwa mit einem Bruder teilen? Arsinoë war als zweitgeborene Tochter für sie keine Konkurrenz. Aber ein Sohn? Und war es nicht seit alters her Brauch ihrer – zugegeben mütterlichen – Vorfahren gewesen, dass Väter ihre Töchter und Brüder ihre Schwestern ehelichten, um das Blut der Familie reinzuhalten? Die Verbindung von Bruder und Schwester war immer noch erwünscht. War nicht, wenn sie gewissen Gerüchten glauben konnte, Ptolemaios sogar mit seiner Halbschwester Kleopatra, ihrer Namensvorgängerin, verheiratet gewesen, ehe er sich ihrer Mutter zugewandt hatte? Doch ihr Bruder würde noch ein unmündiges Kind sein, wenn sie auf den Thron käme. Undenkbar, ihn zum Mann zu nehmen. Oder würde ihr Vater gar ihn …? Nicht auszudenken! Eifersucht? Ja, vielleicht.
Sie vertrieb das aufsteigende Gefühl, hatte sich gleich wieder im Griff und versprach, über den Auftrag nachzudenken. Dann wandte sie sich zum Gehen. Doch noch einmal rief die Mutter sie zurück. „Übrigens berichtet mir dein ägyptischer Lehrer Imhotep, dass du Fortschritte machst. Das freut mich, mein Kind!“ Freundlich lächelnd blickte sie der Tochter nach, die sich höflich bedankte und das Gemach der Königin verließ.
„Du magst das Herz einer Zehnjährigen haben, Prinzessin, aber du hast den Verstand einer erwachsenen Frau.“ Imhotep versuchte, das verstörte Mädchen zu beruhigen. Wusste die große Königin denn überhaupt, was sie da von ihrer Tochter verlangte? „Beruhige dich, gehe in dich und bitte Amun-Re um Hilfe und Erleichterung. Und meinetwegen auch die Götter deines Vaters.“
„Amun-Re-Zeus“, begann Kleopatra schluchzend, nachdem sie sich in einen der kleinen Haustempel geflüchtet hatte, der den Göttern Griechenlands und Ägyptens gleichermaßen als Heimstatt diente. „Wie zahlreich sind doch deine Werke; sie sind dem Gesicht des Menschen verborgen, du einziger erhabener Gott, dem kein anderer gleichkommt …“ Dann trug sie dem Gott ihrer Ahnen vor, was ihre junge Seele bedrückte, und endete mit der Bitte, ihr für alles, was das Leben heute und zu jeder Zeit von ihr forderte, den Segen des Himmels zu gewähren. Erst jetzt begann sie zu weinen. Aber sie weinte längst nicht mehr wie ein Kind. Nie hätte sie geahnt, dass sie so viele Tränen barg, denn all die Jahre waren ihre Augen trocken geblieben. Mit verschleiertem Blick stürzte sie nach draußen, stolperte blind in die Arme Nefers, ihrer Dienerin und Vertrauten, und ließ sich von ihr trösten. Sie wusste, dass sie soeben einen Teil ihrer Kindheit hinter sich gelassen hatte und auf dem Weg zum Erwachsenwerden war.
Ganz Alexandria begrüßte die Geburt des neuen Prinzen mit überschwänglicher Begeisterung. Überall in der Stadt waren der Rhythmus der Rahmentrommeln und der hohe Gesang der Rohrflöten zu vernehmen. Ausgelassen tanzten die Menschen auf den hell erleuchteten Straßen. Und selbst aus dem fernen Memphis, wohin Ptolemaios’ Boten die freudige Nachricht gebracht hatten, kamen Grüße und gute Wünsche. Die Apis-Bruderschaft werde für das neue Familienmitglied und das Königshaus beten, ließ der Hohepriester den Schwiegersohn wissen. Er hoffe, dass es auch seiner Tochter gut gehe. Gern sähe er sein Kind einmal wieder und natürlich auch die Enkel, die er ja noch nicht kenne. Vielleicht wäre der Familie ja ein Besuch der alten Heimat in naher Zukunft möglich. Der alte Mann ahnte nicht, wie bald sich sein Wunsch erfüllen sollte.
Erneut war die königliche Gemahlin guter Hoffnung. Und der Verlauf der Schwangerschaft, die sich durch nichts von der vorhergehenden unterschied, ließ ahnen, dass auch diesmal ein Prinz geboren würde. Doch sollte seine Geburt unter ganz anderen Vorzeichen als denen bei der Geburt des älteren Bruders verlaufen.
Seit Tagen peitschte ein heftiger Sturm aus südwestlicher Richtung den Sand der nahe gelegenen Wüste auf, trübte die Luft, dass man die Hände vor den eigenen Augen nicht sah, und legte sich als grauer schmieriger Belag wie ein Leichentuch über die erstarrte Stadt. Totenstille überall. Die Bewohner Alexandrias waren aufgerufen, Türen und Fenster zu vernageln und ihre Behausungen nicht zu verlassen. Wie vor einem gefährlichen Feind hatte sich auch die Königsfamilie in ihrem Palast verbarrikadiert. Das schwache Licht weniger Öllämpchen verlieh den dunklen, mit kostbarem Holz getäfelten Räumen, die Ptolemaios und die Seinen bewohnten, ein gespenstisches Aussehen, das die ohnehin schlechte Stimmung noch mehr trübte. Und die Luft stand. Man war es gewohnt, den Großteil des Tages im Freien zu verbringen, außerhalb der beengenden Mauern, in den schattigen Gärten bei den murmelnden Brunnen, den seerosengeschmückten Teichen, in den duftenden Orangenhainen, den herrlichen Papyruswäldern oder unter den silberblättrigen Olivenbäumen. Selten begab man sich tagsüber ins Haus.
Die Geburt ihres vierten Kindes hatte die Königin mehr Kraft gekostet als die ihrer drei älteren Kinder zusammen. Sie schob es ihrem fortgeschrittenen Alter zu. Die alte Volksweisheit hatte schon recht, wenn sie meinte, Kinder solle man in jungen Jahren bekommen. So sei es schließlich von der Natur auch vorgesehen.
„Ich werde dafür sorgen, dass du nicht mehr schwanger wirst“, bemerkte Naoma besorgt. Sie hatte sich bereit erklärt, die Pflege ihres Schützlings zu übernehmen, der sich diesmal von der Mühsal des Wochenbetts nur langsam erholte. Naoma war alt geworden. Ihre Beine gehorchten ihr kaum mehr und ihre Hände, die mit hässlichen braunen Flecken übersät waren, zitterten. Sie bemühte sich, wenigstens ihren Kopf ruhig zu halten. Mit all den Gebrechen kostete es die Greisin eine nahezu übermenschliche Anstrengung, ihrer Aufgabe gerecht zu werden, aber sie versuchte es ohne zu murren. Die Königin bestand auf ihrer Hilfe und ihrer Gesellschaft. Sie konnte sich ein Leben ohne diesen guten Geist, der ihr bisheriges Leben so selbstlos begleitet hatte, nicht vorstellen. Die Königin brauchte sie.
„Vier Kinder in einem Jahrzehnt! Mehr kann ein noch so hoch gestellter Mann von seiner Frau nicht verlangen. Du hast deine Pflicht getan. Mehr als das, meine Schöne. Hätte ich geahnt, was dieser Grieche deiner schwachen Gesundheit zumuten würde, glaube mir, ich hätte damals deinen Vater beschworen, dich nicht mit ihm zu verheiraten. Es hat schließlich genügend Anwärter gegeben, junge Männer aus den vornehmsten Familien Ägyptens, die ein Auge auf dich geworfen hatten. Manchmal stelle ich mir vor, was geworden wäre, hättest du einen von ihnen genommen. Wir säßen jetzt bequem in Memphis, fern aller Repräsentationspflichten und vor allem fern von diesem turbulenten Alexandria, wo man nicht einmal seines Lebens sicher ist. Aber du, du musstest ja unbedingt deinen Kopf durchsetzen. So wie immer. Schon als kleines Mädchen …“
„Ich kenne deine Vorwürfe, meine Liebe“, unterbrach sie die Königin. „Ich habe sie oft genug gehört. Du bist ja mit ihnen nie sparsam gewesen. Es ist schon alles gut so. Ein jeder hat den Platz einzunehmen, der ihm vom Schicksal zugewiesen wurde. Und mein Platz ist hier, Naoma. Ich habe nie bereut, meine Heimatstadt verlassen und hier ein neues Leben begonnen zu haben, fern von meinem geliebten Vater, meinen Geschwistern und allem, was mir vertraut war. Freilich war es nicht immer leicht und manchmal schnürte mir das Heimweh das Herz zu. Aber Ptolemaios hat mich geliebt, er tut es bis heute, auch wenn mein Gesicht die ersten Spuren des Alters trägt und mein Leib allmählich aus der Form gerät. Und ich liebe ihn. Die Liebe, gute Naoma, erträgt vieles und verzeiht alles. Und wo die Liebe ist, ist man zu Hause.“ Eine Weile schwieg die Königin, als müsse sie über die Bedeutung ihrer eigenen Worte nachsinnen. Dann wandte sie sich erneut an ihre alte Amme.
„Etwas anderes beunruhigt mich, Naoma. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sich in Alexandria das Volk zusammenrottet und lauthals Ptolemaios’ Tod fordert. Er hat mir nichts davon erzählt, er hält ja alles, was mich aufregen könnte, von mir fern. Aber wie du weißt, haben die Wände unseres Palastes Ohren. Nicht nur der König hat seine Spitzel im ganzen Reich verteilt. Auch meine Vertrauensleute hören sich um. Von ihnen wurde mir zugetragen, dass die Frau, die Ptolemaios vor mir geehelicht hatte, gemeinsam mit ihrer Tochter Berenike das Volk aufwiegle und nach dem Thron lechze. Nur zum Schein habe sie sich mit dem Los der Verbannung abgefunden. Seit geraumer Zeit bereite sie mit Hilfe getreuer Anhänger ihre Rückkehr nach Alexandria vor, wo sie ihre Tochter, nach ihrer Meinung Ptolemaios’ einziges legitimes Kind, auf den Thron setzen und sich als große königliche Beraterin aufspielen wolle. Ihrem früheren Gemahl und seiner jetzigen Familie habe sie Rache geschworen.“
Auch Naoma hatte von dem drohenden Aufstand gehört. Im Palast wusste fast jeder davon. Aber sie hatte dem Gerede zunächst keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Immer wieder war von der Unzufriedenheit des Volkes die Rede und oft genug hatte sich gezeigt, dass sich diese wieder gelegt hatte oder überhaupt nur ein leeres Gerücht war. Als man ihr jedoch berichtete, der König verstärke die Mauern und erhöhe die Anzahl der Wachen, hatte sie sich genauer erkundigt. Doch wie alle anderen, die unbequeme Fragen stellten, hatte man auch sie mit der lapidaren Feststellung abgefertigt, dass die Zeiten unsicher seien und man vorsorgen müsse. Kein Grund zur Beunruhigung! Doch Naoma war nicht dumm. Mochte sie auch nur eine Sklavin sein und niemals das genossen haben, was man in Gesellschaftskreisen eine höhere Bildung nannte, so verfügte sie doch über Erfahrungen, die keine Bücher vermitteln konnten. Ein langes Leben in unmittelbarer Nähe der Vornehmen und Herrschenden hatte sie geprägt und ihr Weisheit und Weitsicht verliehen, die über jedes Schulwissen hinausgingen. Und es gab Träume, immer wieder Träume! Von dunklen Wolken träumte sie, die sich bleischwer über Alexandria und den Palast legten und dessen Mauern bis in die Grundfesten erschütterten. Von bislang unbekannten Gestirnen träumte sie, die sich blutrot vor die Sonne schoben und alles in undurchdringliches Dunkel hüllten. Sie sah das Gefieder der Ibisse, das sich von einem Augenblick zum nächsten schwarz färbte. Vögel, die Steinen gleich tot vom Himmel fielen. Und Ptolemaios, der jung und schlank im königlichen Ornat auf der Sonnenbarke gegen Westen segelte. Träumte sie? Erlebte sie? Sie vermochte es, sobald der Tag angebrochen war, nicht zu sagen. Nur ihr nächtliches Gewand, das von Schweiß durchtränkt war, verriet, wie sehr sie gelitten hatte.
Bald war sie überzeugt, dass Alexandria und der Königsfamilie turbulente Ereignisse ins Haus stünden, ja dass deren Leben und Stellung bedroht waren. In weiser Voraussicht gab sie Anweisung, alles für eine Flucht ihrer geliebten Herrin und der Kinder vorzubereiten. In Alexandria war die hohe Familie nicht mehr sicher. Memphis würde ein geeignetes Asyl sein, wo sie die Apis-Priesterschaft und vor allem der Hohepriester sicherlich mit Freude aufnähmen. Nur Ptolemaios, der nach ihrer Auffassung so großes Unglück über ihre Prinzessin gebracht hatte, als er sie zunächst ver- und dann entführte, mochte sehen, wo er blieb. Ihm würde sie gewiss keine Träne nachweinen.
Sie sprach zu ihrer Herrin von den dunklen Gedanken, die sie seit einiger Zeit umtrieben und quälten, und weihte sie in ihre Pläne ein. Alles sei vorbereitet. Die Königin müsse nur zustimmen. Aber es sei Eile geboten. Damit warf sie sich, was bisher noch nie geschehen war, der Königin zu Füßen.
Die hohe Frau war verwirrt. Vor allem, dass Naoma Ptolemaios nicht in ihre Rettungspläne einbezogen hatte, so denn diese überhaupt nötig waren, störte sie. Konnte die Alte nicht endlich begreifen, dass es ohne den geliebten Mann auch für sie, die Königin, keine Flucht gab? Durfte sie Ptolemaios so schmählich im Stich lassen? Hatte sie ihm nicht damals, als sie den Krug miteinander zerbrochen hatten, ewige Treue geschworen, ein Ausharren an seiner Seite bis zum Tod? Doch was hatte ihr Göttergemahl vor? Warum redete er nicht mit ihr? Wenn Naoma die Lage in der Stadt durchschaut und erkannt hatte, dass sich die königliche Familie in Lebensgefahr befand, um wie viel mehr musste dann ihm klar geworden sein, dass etwas zu ihrer Rettung geschehen musste? Gewiss, in letzter Zeit hatte auch sie eine gewisse Unruhe im Palast beobachtet. Sie hatte gesehen, dass Ptolemaios an Speisen und Getränken nur vorsichtig nippte, ehe er in gewohnter Weise zugriff, und dass mancher Sklave, dem das Vorkosten der königlichen Mahlzeiten befohlen worden war, schon nach wenigen Bissen oder Schlucken tot zusammenbrach. Aber man hatte Königen nach dem Leben getrachtet, solange Menschen denken konnten, und ebenso lange hatten sich die Herrschenden dagegen zu schützen vermocht. Nein, dachte die hohe Frau, an ein bevorstehendes Attentat glaubte sie nicht. Es waren die üblichen Vorsichtsmaßnahmen, die man traf. Weiter nichts.
Und wenn die besorgte Dienerin doch recht hatte? Nun, sie würde ihren Gatten darauf ansprechen, was an den umlaufenden Gerüchten wahr sei und ob es die Verstoßene und Verbannte tatsächlich wagen könnte, das freilich wegen der hohen Steuerlast nicht ganz zu Unrecht aufgebrachte Volk auf ihre Seite zu bringen und gegen ihren Wohltäter zu konspirieren. Bei Gelegenheit. Eilig schien ihr die ganze Sache nicht.
Doch kaum hatte sich Naoma, verzweifelt ob der Sturheit ihrer Herrin, in ihre Kammer zurückgezogen, wurde die Königin abrupt aus ihren Gedanken gerissen. Ohne die übliche Form der Etikette zu wahren, stürzte Ptolemaios in ihr Gemach, um ihr schwer atmend zu sagen, sie müsse Alexandria mit den Kindern eiligst verlassen und sich in Sicherheit bringen. „Das Volk probt den Aufstand“, keuchte er. „Uns bleibt keine Zeit. Kleopatra, meine frühere Gemahlin, hat im ganzen Reich Truppen gesammelt, die sich schon im Anmarsch auf Alexandria befinden. Ich habe bereits befohlen, das Nötigste zusammenzupacken. Du wirst zu deinem Vater zurückkehren und ich werde mich nach Rom unter den Schutz des Pompeius begeben und dort meine Freunde um Unterstützung bitten. Denn die Stärke meiner Truppen reicht gegen die der Verräterin nicht aus, um unseren Anspruch zu verteidigen. Und ich habe nicht vor, den Platz kampflos zu räumen. Zum Glück habe ich mir durch großzügige Geschenke die Römer von Anfang an verpflichtet, wenn man mich auch oft genug getadelt hat, ich verschleudere das Erbe unserer Vorfahren und schände die Ehre des Reiches.
Aber es ist jetzt nicht die Zeit, zu politisieren und philosophische Reden zu halten. Die Feinde der Ptolemäer werden bald vor den Toren des Palastes stehen. Ich fliehe, Liebste, und ich habe alle Vorkehrungen getroffen, dass auch du sofort aufbrechen kannst. Bete zu deinen Göttern und rufe auch die meinigen an! So es ihnen gefällt, werden wir uns bald wiedersehen.“
Noch einmal umarmte er die geliebte Frau. Dann eilte er hinaus und strebte zum Hafen, wo ein Schnellsegler bereits auf ihn wartete.