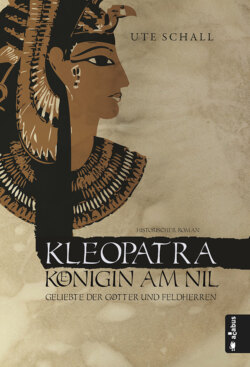Читать книгу Kleopatra. Königin am Nil - Geliebte der Götter und Feldherren - Ute Schall - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAuf der Reise nach Rom
Die Königin war der Verzweiflung nahe. Sie hatte alle Räume der großzügigen Palastanlage durchsuchen lassen. Keine Abstellkammer, keine Truhe, kein noch so düsterer Winkel war den Augen ihrer Dienerschaft verborgen geblieben. Selbst Zimmer, die seit Menschengedenken nicht mehr benutzt wurden und verschlossen waren, hatten sie aufgebrochen und aufmerksam durchforscht. Aber ihre Tochter Kleopatra war nirgendwo zu finden. Sie war und blieb verschwunden.
Auch weil Naoma zum Aufbruch drängte, entschloss sich die Königin in ihrer Todesangst schweren Herzens, ihr Töchterchen sich selbst zu überlassen. Zwar war gerade ihre Älteste für ihre Klugheit bekannt, aber sie war trotz ihrer beinahe zwölf Jahre noch ein Kind und hatte sich noch nie in einer ähnlich gefährlichen Lage befunden.
Doch draußen randalierte der Pöbel. Schon hämmerten und polterten aufgebrachte Rebellen heftig an die Tore der Residenz und forderten Einlass. Die ersten Griechen lagen erschlagen in den Straßen Alexandrias und immer wieder skandierte der aufgebrachte Mob: „Tod dem König, Tod den Ptolemäern!“
Da befahl die Königin, den Palast auf geheimen Wegen umgehend zu verlassen und eiligst die bereitstehenden Wagen zu besteigen, die sie und die Königskinder in die Sicherheit von Memphis bringen sollten.
Und was geschähe mit Kleopatra? Würde sie alleine zurechtkommen? Würde sie ihr Leben retten können? Es wäre ihr sicherlich ein Leichtes, als einfaches ägyptisches Mädchen verkleidet irgendwo in der Stadt Unterschlupf zu finden. Es blieb nur zu hoffen, dass die Tochter auf diesen Gedanken kam.
Mit tränenverschleierten Augen schlurfte König Ptolemaios indes über das Deck des Schnellseglers. Selbstvorwürfe quälten ihn. Er war ein schwacher König. Und er war ein schlechter Vater und Ehemann. Er hatte die Seinen schmählich im Stich gelassen. Wer konnte sagen, ob auch ihnen die Flucht gelungen war, ob sie sich vor den randalierenden Aufständischen noch rechtzeitig hatten in Sicherheit bringen können? Niemand wusste es, aber ein jeder konnte sehen, wie feige er, der „große König“, in Wirklichkeit war. Sollte er vielleicht umkehren und in Alexandria zu retten versuchen, was zu retten war? Sollte er nach Memphis eilen und dort zusammen mit seiner Familie warten, bis sich die Gemüter wieder beruhigt hatten? Aber was könnte er, ein Mann, dem man seine Stellung streitig machte, gegen die Überzahl seiner Gegner ausrichten? Und müsste er nicht in Memphis vor den Hohepriester, seinen Schwiegervater, treten und kleinlaut eingestehen, dass er ein Gescheiterter war? Er, der die Stadt einstmals als großer König besucht hatte, als Wiedergeburt der mächtigen Pharaonen. Als aus den Fluten des Nils auferstandener Osiris? Nein, das verbot sein Stolz.
Oft glaubte er, die verächtlichen Blicke der Seeleute auf sich ruhen zu sehen. Und hatte neulich nicht gar einer gewagt, vor ihm auszuspucken, um ihm seine Verachtung zu zeigen? So weit war es schon mit ihm gekommen. Er hatte hier, nur von einer kleinen Leibgarde bewacht – die meisten seiner Leute hatten sich auf die Gegenseite geschlagen –, der rauen See und den nicht weniger rauen Männern schutzlos ausgeliefert, nicht einmal die Möglichkeit, sich gegen solche Unverschämtheiten zu wehren. Und was das Schlimmste war: Sie hatten recht. Er war ein Verräter, ein Versager. Und er schämte sich dafür. Jetzt war er sogar nahe daran, sein Reich und seine Ehre oder das bisschen, das davon geblieben war, den Römern in den gierigen Rachen zu werfen. Aber konnte er denn anders? Wieder rollte ihm eine Flut von Tränen die feisten Wangen hinab.
Schleichende Schritte, die er hinter seinem Rücken vernahm, rissen ihn aus seinen Gedanken. Augenblicklich vermutete er ein Attentat. So also rächte sich die verstoßene Gattin. Hier auf dem Schiff, wo sich keine Art des Widerstands bot, ließ sie ihn hinterrücks ermorden. „Gut eingefädelt“, sprach er zu sich selbst. „Das hätte ich dir gar nicht zugetraut, Kleopatra.“ Dann machte er sich auf das bevorstehende Ende gefasst.
Aber nichts geschah. Der König stand klopfenden Herzens auf dem Deck. So mochten Verurteilte auf die Hand des Scharfrichters warten. Die undeutlichen Schritte waren jetzt gänzlich verhallt. Er fühlte nur einen stechenden Blick, der sich in sein müdes Fleisch grub. Langsam drehte er sich um.
Die königliche Familie, jetzt vaterlos, näherte sich unter großen Anstrengungen der alten Stadt Memphis. Immer wieder wurde sie auf ihrem Weg von Aufständischen angehalten und verhört. Doch erkannten diese weder die Frau noch die Kinder. Niemand hätte in der Reisenden, die in Lumpen gehüllt gleich einer einfachen Marktfrau auf einem klapprigen Gemüsekarren saß, die große königliche Gemahlin vermutet.
„Du siehst, liebe Naoma, manchmal hat es auch etwas Gutes, wenn man im goldenen Käfig eingesperrt ist und von keinem gesehen wird. Ich wage nicht, mir vorzustellen, was geschehen wäre, hätte sich von diesen Verbrechern auch nur einer an mein Gesicht erinnert. Arsinoë sieht aus wie ein verdreckter Spatz, und die beiden Kleinen gleichen eher den ungeliebten Ablegern von Straßenvolk als hochgeborenen Prinzen. Und dann dieses Fahrzeug! Ich darf nicht daran denken, was mit ihm vermutlich schon alles befördert wurde: verfaultes Obst und Gemüse, Kuhmist, Kameldung, verendete Tiere, und womöglich hat es auch schon als Leichenwagen gedient. Es ist derart unbequem, dass kein noch so winziger Teil meines Körpers von blauen Flecken verschont geblieben ist. Und meine Knochen! Aber verzeih, meine Liebe! Du bist so viel älter als ich, bist krank und gebrechlich, und dennoch klagst du nicht. Ich muss dir wirklich dankbar sein. Hast du nicht trotz all dieser Beschwerden alles so gut vorbereitet? Hätte ich doch nur eher auf dich gehört! Vielleicht hätten wir uns ja auf einer früheren Flucht nicht so verkleiden müssen. Ich sehe uns an und könnte lachen, wenn die ganze Sache nicht so zum Weinen wäre.“
„Wir werden überleben, meine Königin. Das ist das Einzige, was zählt.“ „Ist es das wirklich?“ Die große königliche Gemahlin zweifelte. War denn ein Leben um jeden Preis überhaupt ein Leben? Sie war im Luxus aufgewachsen und ihr Mann hatte ihr jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Zahllose Sklaven hatten sich um ihr Wohlergehen bemüht, hatten ihr die kostbarsten Gewänder angelegt und das wertvollste Geschmeide umgehängt, das die Gold- und Silberschmiede in ihrem Reich zu fertigen imstande waren. Sie hatte nur von den edelsten Speisen gekostet. Wie selbstverständlich hatte sie das alles angenommen, ohne auch nur einen Anflug von Dankbarkeit zu zeigen. Und jetzt! Ein wenig konnte sie die Menschen verstehen, die immerzu ertragen mussten, was sie gerade ertrug. Und mit einem Mal verstand sie auch, dass sie versuchten, sich von Zeit zu Zeit mit ihren bescheidenen Mitteln dagegen zu wehren. Doch hatte sich nicht immer wieder gezeigt, dass auch neue Herrscher trotz aller gegebenen Versprechen die Bedingungen nicht änderten oder allenfalls vorübergehend Linderung verschafften? Niemand vermochte sich auf Dauer der göttlichen Ordnung zu entziehen. Einem jeden hatte die Vorsehung seinen Platz zugewiesen. Mehr denn je war sie davon überzeugt.
Sie freute sich auf ihren Vater, der inzwischen sicherlich alt und gebrechlich, aber immer noch eine Autorität war. In den Briefen, die regelmäßig zwischen Memphis und Alexandria hin- und hergegangen waren, hatte er sich zwar nie beklagt, doch zählte er jetzt beinahe 50 Jahre, ein Alter, das zu erreichen den wenigsten Bewohnern des Reiches am Nil vergönnt war.
Wie schön wäre es gewesen, im herrschaftlichen Reisewagen die marmorgepflasterte Straße hinauf zu fahren, die zum künstlich angelegten Hügel mit der unter Palmen versteckten Palastanlage führte! Wie schön, als erhabene Königin, gefolgt von den Blicken zahlreicher Neugieriger, in prächtigem Ornat dem staunenden Vater entgegen zu treten, an der Hand die Kinder, seine Enkel, die auch sein Weiterleben nach dem Tod sicherten! Zwar war ein Bote vorausgesandt worden, um den alten Mann auf seine Tochter und Enkelkinder und das Unglück, das ihnen zugestoßen war, vorzubereiten. Doch wo stand geschrieben, dass der Getreue ungehindert bis Memphis vorgedrungen war? Und wie sollte sie ihrem Vater erklären, weshalb sie ihren Mann nicht mitgebracht hatte, den König von Ober- und Unterägypten, der gerade auf dem Weg war, sein Reich, seine Familie, seine Freiheit und seine Ehre den Römern zu verkaufen? Wie, dass sie Kleopatra im Stich gelassen hatte? Ach, sie hätte das ungehorsame Mädchen länger suchen müssen, hätte nicht aufgeben dürfen. Sie hätte die Sklaven strenger antreiben müssen, alles im Haus umzudrehen, und androhen müssen, die ganze Meute einen Kopf kürzer zu machen, sollten sie das Kind nicht herbeischaffen. Wahrscheinlich hätte sie sich gerade um diese Tochter, die sich so sehr von Gleichaltrigen unterschied, mehr kümmern müssen. Sie machte sich Vorwürfe. Doch war ihr Kleopatra, die von Ptolemaios offensichtlich inniger geliebt wurde als seine anderen Kinder, immer so selbstständig erschienen, ihren Jahren an Klugheit weit voraus, und so hatte sie das Kind leichtfertig, wie sie jetzt wusste, zu oft sich selbst überlassen. Sie hatte schnell festgestellt, dass sich Kleopatra den Erziehungsversuchen Naomas verweigerte, ja gegen diese eine regelrechte Abneigung entwickelte. Nach langer und sorgfältiger Auswahl hatte sie dann Nefer, ein dunkelhäutiges Sklavenmädchen, einige Jahre älter als ihre Tochter, in ihre Familie aufgenommen und Kleopatra hatte sich rasch mit dieser angefreundet. Nefer war, was man von der Prinzessin nicht behaupten konnte, ein lebenstüchtiges, geschicktes und vorausschauendes Persönchen. Es war ihr sogar gelungen, die wilde Königstochter ein wenig zu zähmen. Ihr Einfluss auf die Prinzessin war immer größer geworden. Wie eine Klette hatte die Kleine an der neuen Dienerin gehangen, und wo Nefer gewesen war, war auch Kleopatra bald aufgetaucht. Die beiden waren in kürzester Zeit unzertrennlich geworden. Ach, wenn sie, die Königin, doch nur wüsste, dass Nefer bei ihrer Tochter war! Dann müsste sie sich keine Sorgen machen.
Endlich tauchten in der Ferne aus dem grauen Staub der Straße die ersten Behausungen von Memphis auf: Die einfachen Lehmhütten der Sklaven und die kleinen Geschäfte der Handwerker, dann Palmengärten, in denen die herrlichsten Blumen blühten. In der alten Königsstadt schien die Zeit still zu stehen. Nichts von dem Lärm, der in Alexandria herrschte. Niemand, der ihrem Gemahl und seiner Familie nach dem Leben trachtete. Memphis lag in dumpfem, seit mehr als zwei Jahrtausenden währendem Schlaf.
Der König traute seinen Augen nicht und für einen Atemzug hatte es ihm sogar die Sprache verschlagen. „Du hier?“, stammelte er. „Vater!“, rief das junge Mädchen, um Verständnis ringend. „Vater, ich konnte nicht anders.“ Damit warf sie sich ihm um den Hals.
„Ich habe alles versucht, hoher Herr, deine Tochter von dieser Unbesonnenheit abzubringen, aber du kennst sie ja selbst. Was sie sich einmal in den Kopf gesetzt hat …“ Nefer fiel Ptolemaios schluchzend zu Füßen. Sie war darauf gefasst, dass der König gleich in Zorn ausbrechen und der Mannschaft des Schiffes befehlen würde, sie zur Strafe über Bord zu werfen. Aber das hatte sie schließlich verdient. Sie hätte Kleopatra härter anfassen, sie hätte sie einsperren und der Mutter übergeben müssen. Das hätte ihr, der Dienerin, jedoch das Herz gebrochen, denn sie wusste, wie sehr ihr Schützling an dem Vater hing. „Niemals“, hatte ihr die Prinzessin entgegen geschleudert, „niemals würde ich ihn im Stich lassen, und das weißt du. Wenn er nach Rom geht, gehe ich selbstverständlich mit. Er spricht ja kaum Latein und nur ein wenig Griechisch. Wie soll er sich dort verständigen, wie soll er verstehen, was man ihm sagt, von ihm verlangt? Du weißt selbst, wie unzuverlässig unsere Übersetzer sind. Wo steht geschrieben, dass sie nicht von den Römern gekauft wurden? Und außerdem: Ich könnte es nicht ertragen, ihm so fern zu sein.“ Nefer, die die junge Herrin liebte, als wäre sie ihre Schwester (was ihr freilich wegen ihres niederen Standes nicht zukam), ließ sich beschwatzen und verschaffte ihnen beiden ein sicheres Versteck auf dem Schnellsegler, auf dem Ptolemaios zu fliehen beabsichtigte. Teuer hatte sie dafür bezahlt. Sie hatte einem der Seeleute eine sie „schon lange quälende, heimliche Liebe“ gestanden und ihm ihren Körper verkauft. Dafür hatte sie im Bauch des Schiffes einen engen Verschlag bekommen, ein finsteres, schmutziges Loch, das von Ratten und allerhand Ungeziefer bewohnt war. Kleopatra störte es nicht. Wenn sie nur in der Nähe des Königs sein konnte und ihm ihre Hilfe anbieten durfte! Sie würde jedes noch so große Ungemach auf sich nehmen. Heimlich hatten sich die beiden jungen Frauen nachts auf das Schiff geschlichen, sich in der stinkenden Behausung eingerichtet und ihren Proviant ausgepackt: einen Krug Wasser, Oliven und trockenes Brot. Es war alles, was ihnen in der Eile zusammenzuraffen gelungen war. Voller Ungeduld hatten sie dann auf das Auslaufen gewartet. Wenn sie sich erst auf hoher See befänden, könnte sie König Ptolemaios nicht mehr von Bord jagen, zumindest nicht Kleopatra, wie sich Nefer mit klopfendem Herzen eingestand.
„Aber hast du denn nicht an deine arme Mutter gedacht?“, wollte der König von seiner Tochter wissen. Seine Miene war streng, doch insgeheim war er auf dieses Kind stolz. „Kannst du dir nicht vorstellen, welche Sorgen sie sich um dich macht?“
„Was ist mit Mutter, geht es ihr nicht gut? Und meinen Geschwistern?“ Angst schwang in der Stimme des Mädchens mit. Nein, an ihre Mutter hatte sie im Augenblick der Flucht tatsächlich keinen Gedanken verschwendet und sie schämte sich dafür. Sie dachte an die hohe Frau, die schon durch ihre übermenschliche Schönheit Abstand gebot, die sie, anders als den Vater, stets mit scheuer Bewunderung betrachtet, deren Harfenspiel sie andächtig gelauscht hatte. Ach, Mutter hatte etwas so Unwirkliches an sich, dass Kleopatra, als sie noch Kind gewesen war, oft geglaubt hatte, ihre Mutter sei gar kein menschliches Wesen, sondern die Göttin Isis selbst, die liebende Schwestergemahlin, die geruhte, zum Wohle der Menschen für eine Weile auf Erden zu wandeln. Glich sie nicht jener Statue der Göttin, die den kleinen Haustempel der Ptolemäer in Alexandria schmückte? Zeigte Isis nicht das gleiche Lächeln, mit dem auch die Königin stets ihren Kindern begegnete? Trug sie nicht das ebenmäßig vornehme Gesicht mit genau den Zügen, die auch der Mutter eigen waren? Es konnte nicht anders sein: Die Mutter war Isis, und Göttern musste man, das hatte sie schon als ganz kleines Mädchen gelernt, immer mit Achtung und Abstand begegnen.
„Was ist mit Mutter?“, fragte Kleopatra noch einmal und Ptolemaios sah die Angst in ihren Augen. „Ich weiß es nicht“, gestand er. „Aber ich hoffe, dass ihr und deinen Geschwistern die Flucht aus der Hölle von Alexandria gelungen ist. Eigentlich bin ich davon überzeugt. Deine Mutter ist eine intelligente Frau, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht. Ich habe sie beschworen, Alexandria so schnell wie möglich zu verlassen und bei ihrem Vater Zuflucht zu suchen. Naoma hatte bereits alles zur Flucht vorbereitet. Die Alte ist mit Gold nicht aufzuwiegen, wenn sie mich auch immer verachtet hat. Sofern alles gut gegangen ist, ist unsere Familie längst in Memphis eingetroffen und damit in Sicherheit. Wir sollten uns also keine allzu großen Sorgen machen. Aber ich muss deiner Mutter natürlich mitteilen lassen, dass du dich wohlbehalten mit mir auf dem Weg nach Rom befindest, damit sie sich beruhigen kann. Wir werden in Kürze die Insel Cypern anlaufen, wo wir uns von der Überfahrt ein wenig ausruhen wollen. Von dort wird eines unserer Begleitschiffe nach Ägypten zurückkehren und deiner Mutter die Nachricht überbringen. Nach einem kurzen Zwischenaufenthalt wollen wir so schnell wie möglich Rom erreichen. Je eher wir dort sind, desto früher können wir nach Hause zurückkehren. Eine Gesandtschaft, die mein Anliegen dem römischen Senat überbringen soll, habe ich bereits vorausgeschickt. Und auch meinem Freund Pompeius Magnus habe ich unsere Ankunft angekündigt. Rom“, seufzte er. „Ägyptische Kunstschätze stehen bei den Reichen Roms hoch im Kurs. Sie dekorieren mit ihnen ihre Landhäuser und mit dem alten Schmuck ihre Frauen oder Geliebten. Und überhaupt: Seit die Römer vor Jahren die Cyrenaika so ganz ohne Anstrengung unterworfen und zu ihrer Provinz gemacht haben, fürchte ich ohnehin, dass sie eines nicht mehr fernen Tages ihre Fühler auch nach unserem Land ausstrecken werden, und wir werden ihnen schutzlos ausgeliefert sein. Ägypten ist ein fruchtbares Land und in Rom selbst wird von den Regierenden nichts so sehr gefürchtet wie eine Hungersnot. Zudem wird unser Reich nur allzu gern als Ausgangspunkt für die Eroberungen in Asien gesehen. Es verlangt wohl ein Gesetz der Natur: Der Große frisst den Kleinen und der noch Größere frisst den Großen. Übrigens hat schon vor Jahren Gaius Iulius Caesar – er war damals noch curulischer Ädil – beim Senat beantragt, ihm durch einen Volksentscheid ein außergewöhnliches Imperium zu übertragen, das ihn berechtigen sollte, Ägypten zu besetzen und zur römischen Provinz zu machen. Und nur der Widerstand seiner römischen Gegner und Roms Achtung vor allem Griechischen hat uns vor diesem Schicksal bewahrt. Vielleicht wäre es ja nicht einmal das Schlechteste, sich ganz unter den Schutz Roms zu begeben. Im Augenblick bleibt uns ja nichts anderes übrig, als auf die römische Hilfe zu hoffen. Danach werden wir weitersehen.“
Cypern! Wie viel hatte Kleopatra schon von der Insel, die erst vor kurzem dem Römischen Reich eingegliedert worden war, von ihrem griechischen Lehrer Apollodoros gehört. Sie erinnerte sich auch an das enttäuschte Gesicht ihres Vaters, als ihm von der Einnahme Cyperns durch die Römer berichtet worden war. „Dieses Rom kommt unserem Herrschaftsgebiet immer näher!“, hatte er die Nachricht kommentiert und war daraufhin in tiefes Nachdenken verfallen. Hatte er nicht selbst ein Auge auf das seinem Reich so nahe gelegene Eiland mit seinen reichen Bodenschätzen geworfen? Der Traum, dass Cypern einmal zu Ägypten gehören könnte, war ausgeträumt.
Nur wenige Stunden nachdem er auf der Insel angelegt hatte, ließ Cato, der für Rom – wenn auch mit einem gewissen Widerwillen – die Insel annektiert hatte, den König rufen. Ptolemaios konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass ihn der Römer von oben herab behandelte, ja ihm sogar unverhohlen seine Verachtung zeigte. Es habe sich, so Cato, bereits herumgesprochen, dass Ptolemaios nicht vertrieben worden, sondern aus eigenen Stücken aus Alexandria geflohen sei, ohne seinen Thron auch nur im Geringsten zu verteidigen. Wo käme Rom eigentlich hin, wenn sich ein jeder, der sich selbst zu helfen zu feige sei, seine Hilfe erbitte? Aber gut! Rom schätze die guten Handelsbeziehungen, die zwischen beiden Reichen bestünden, und er wolle sehen, was sich machen ließe. Ptolemaios solle jedoch nicht sofort aufbrechen, sondern sich auf seiner Reise Zeit lassen. Es sei schließlich nicht ganz einfach, den Senat zuhause zu überzeugen, dass die Unterstützung, die man dem Ägypter zuteilwerden lassen wolle, gut angelegt sei. Ohnehin sei die politische Lage in Rom derzeit etwas verworren und viel Fingerspitzengefühl sei nötig, um Ptolemaios’ Wunsch den eingeschriebenen Vätern vorzutragen.
„Ich beabsichtige nicht“, wandte sich der König an seine Tochter, „noch länger auf Cypern zu bleiben und die Überheblichkeit dieses Römers weiterhin zu ertragen. Da unser Besuch in Rom offensichtlich noch nicht erwünscht ist, werden wir uns zunächst nach Athen begeben. Ich habe es selbst noch nie gesehen. Aber jeder, der der Stadt schon einen Besuch abgestattet hat, preist sie in den höchsten Tönen. Lassen wir uns also überraschen!“
Athen! Kleopatra vermochte nicht zu sagen, wie sehr sie sich über den unvorhergesehenen Umweg freute. Was hatte ihr der griechische Lehrer nicht alles über die Stadt des Geistes erzählt, deren Schutzpatronin keine Geringere als Zeus’ Tochter Athene war! Einst sei sie in voller Rüstung dem sich öffnenden Haupt ihres Vaters entsprungen und die kleine Kleopatra hatte sich oft gefragt, ob denn auch sie auf diese Weise zur Welt gekommen sei. Trotz aller Bewaffnung aber galt Athene als friedliebende Göttin, als Inbegriff der Weisheit, deren Symbol die Eule war. Vor Menschengedenken hatte sie im Wettstreit mit Poseidon den Athenern den Ölbaum gebracht, der bis heute am Hang der Akropolis gedieh. Er hatte die Stadt, die von da an den Namen der Göttin trug, wohlhabend und berühmt gemacht. Ja, vielen galt Athen als geistige Hauptstadt des Römischen Reiches schlechthin.
Doch auch als Heilszentrum hatte sie sich einen Namen gemacht. Hier und im nahe gelegenen Epidaurus konnten Interessierte die Heilkunde studieren und es waren nicht nur freie Männer, die davon eifrig Gebrauch machten. Auch Sklaven und Freigelassenen stand das Recht zu, sich in der Kunst des Heilens zu vervollkommnen und im ganzen Römerreich ein weites Betätigungsfeld zu finden. Griechische Ärzte genossen vor allem in Rom selbst einen hervorragenden Ruf. Athen war auch ein begehrter Aufenthaltsort für all jene vornehmen Römer, die Griechisch und Latein fließend nebeneinander sprachen. Es ging sogar soweit, dass in Rom nur der Anspruch auf wahre Bildung erheben konnte, der wenigstens einmal im Leben für längere Zeit in Griechenland gewesen war.
Die Stadt empfing sie unfreundlich. Aus dem wolkenverhangenen Himmel regnete es in Strömen. Dicke Schmutz- und Schlammschichten wälzten sich durch die aufgeweichten Straßen. Kaum jemand nahm Notiz von der Ankunft des Königs und seines kleinen Hofstaats. Als sie am Piräus die Landungsbrücke überquert und festen Boden unter den Füßen hatten, stolperte Nefer über einen Stein und fiel zu Boden. Kleopatra beeilte sich, ihr wieder auf die Beine zu helfen. Nefer war unverletzt. Aber auf ihren bleichen Wangen stand das pure Entsetzen. Sie klagte nicht, aber sie blickte sich furchtsam um und ihr Körper begann heftig zu zittern. „Ich werde diese Stadt nicht mehr verlassen“, flüsterte sie. Doch niemand bemerkte die Sorge der jungen Frau.
Die Prinzessin machte sich die heftigsten Vorwürfe. Warum nur hatte sie wieder einmal ihren Kopf durchsetzen und in Begleitung der Freundin die Sicherheit des ihnen zugewiesenen Palasts verlassen und sich dieser Gefahr aussetzen müssen? Hatte der Vater sie nicht ausdrücklich gewarnt und es ihr verboten? Dabei war alles bisher so gut gelaufen. Schon am Tag nach ihrer Ankunft riss der Himmel auf und über der Akropolis strahlte hell die wärmende Frühlingssonne. Kleopatra hielt nichts im Haus und so freute sie sich, als endlich eine Abordnung der Stadtväter kam, um den fremden König willkommen zu heißen. Gern erklärten sich die Abgesandten auf die Bitte des Königs hin bereit, ihm und seinem Gefolge die Schönheiten Athens zu zeigen. Kleopatra machte einen Freudensprung. Was würde sie ihren Geschwistern nicht alles erzählen können, wenn sie erst alle wieder beisammen wären! Voller Staunen bewunderten die Fremden die Sehenswürdigkeiten und die Kunstwerke, von denen Athen mehr aufzuweisen hatte als die meisten anderen Städte des Römerreichs. Auf der Akropolis strahlten die bunt bemalten Tempel mit der Sonne um die Wette: der gigantische Parthenon, der zu Ehren der Göttin Athene errichtet worden war, die mächtigen Propyläen mit den schlanken ionischen Säulen, die zu den Heiligtümern führten, das Erechtheion, dessen Dach keine Säulen, sondern die Statuen junger Korbträgerinnen trugen. Und dann der kleine Nike-Tempel, Haus und goldener Käfig für die Siegesgöttin, der die schlauen Athener die Flügel gestutzt hatten, damit sie aus ihrer Stadt nie mehr wegflöge. Am Fuße des Hügels kroch endlich das gewaltige Theater bergan, die älteste Vergnügungsstätte dieser Art auf der ganzen Welt, und Kleopatra glaubte für einen Augenblick, die Begeisterung der Zuschauer zu hören. Sie hatte gelernt, dass die Athener, anders als die Bürger Roms, Vergnügen geistiger und sportlicher Art besonders schätzten und ihnen die blutigen Gladiatorenkämpfe der Römer höchst zuwider waren.
Die Tage flossen gemächlich dahin. Seit einiger Zeit sprach die Königstochter öfter davon, die Athener auch einmal nachts zu besuchen, Straßen, die sie bisher nur tagsüber oder noch gar nicht gesehen hatte, dunkle, geheimnisvolle Winkel und verrufene Plätze. Nefer wollte davon nichts hören. „Dein Vater hat es ausdrücklich verboten“, warnte sie. „Aber er muss ja nichts davon wissen. Wir könnten uns als gewöhnliche Straßenkinder verkleiden. Damit hatten wir doch schon einmal Erfolg. Erinnerst du dich?“ Es brauchte keine allzu großen Überredungskünste, um die willige Sklavin von den Reizen eines solchen Abenteuers zu überzeugen. Ohne weitere Begleitung schlüpften die beiden Mädchen auf Schleichwegen aus dem Haus. Ausgelassen, übermütig und unerfahren stürzten sie sich ins nächtliche Athener Getümmel.
Im belebten Händlerviertel näherten sich ihnen wankende Gestalten. Betrunkene übergaben sich an Häuserecken oder schlugen in fremden Gärten das Wasser ab. Zwielichtiges Gesindel kam ihnen grölend entgegen. Dann sprach sie einer an. „Na, ihr beiden Hübschen, wollt ihr euch nicht ein kleines Goldstück verdienen? Ich kenne da einen betuchten Herrn, der steht auf solche Täubchen. Wie wär’s?“ Unwillkürlich beschleunigte Nefer ihren Schritt. Kleopatra hatte Mühe, der Freundin zu folgen. Da stellten sich ihnen plötzlich, aus einem dunklen Hauseingang kommend, zwei grobe, zahnlose Gestalten in den Weg. „Wohin so eilig, meine Schönen?“ Schon ergriff einer Kleopatras Arm und hielt sie fest. Nefer drehte sich um, stürzte sich auf den überraschten Mann, schlug ihm mit den Fäusten ins Gesicht und biss in die Hand, die er ihr abwehrend entgegenstreckte. Von Schmerz gepeinigt, ließ er Kleopatra für einen Augenblick los. „Lauf, Mädchen, lauf!“, schrie Nefer der jungen Herrin zu. Dann erhielt sie vom Begleiter des Unverschämten einen Schlag, von dem sie bewusstlos zu Boden sank.
Im Schutz der Dunkelheit kehrte Kleopatra um Luft ringend in die Athener Unterkunft des Königs zurück. Kleopatra hatte nicht bemerkt, was ihrer Freundin geschehen war. Sie hatte sich in ihrer Angst nicht mehr nach Nefer umgesehen, war aber davon überzeugt gewesen, dass sich diese erfolgreich gewehrt hatte und ihr auf den Fersen gefolgt war. Als sie jedoch feststellte, dass sie allein war, schossen ihr Tränen in die Augen. Wo war ihre Vertraute geblieben? Sollte sie etwa …? Sie wagte nicht, daran zu denken. Nefer war stark. Im Gegensatz zu ihr war sie hochgewachsen und verfügte über eine ungeheure Kraft. Wie oft hatte sie die junge Herrin durch die Luft gewirbelt, als wäre diese eine leichte Feder. Erst als eine Stunde vergangen war, begann sie, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Es gab in der Dienerschaft einen jungen Sklaven, der auf Nefer ein Auge geworfen hatte. Zu ihm schlich sich die Königstochter und trug ihm ihre Befürchtung vor. Sie beauftragte ihn, die Vermisste sofort zu suchen. Besorgt machte sich der junge Mann mit mehreren Dienern auch gleich auf den Weg. Brennende Fackeln in den Händen, durchleuchteten sie jeden auch noch so verborgenen Winkel, die finstersten Höfe und die verlassensten Straßen. Von Nefer fanden sie keine Spur. Traurig kehrten sie unverrichteter Dinge nach Hause zurück, um der jungen Herrin den Misserfolg zu melden und sich ihrem gerechten Zorn zu stellen. Doch Kleopatra senkte nur beschämt den Blick. Dann betete sie zu den Göttern, ihre Getreue möge noch am Leben sein und bald zu ihrer Familie zurückfinden. Sie bot den Himmlischen sogar ihr eigenes Leben für das ihrer Freundin an, das sie so leichtfertig aufs Spiel gesetzt hatte. Aber die Götter nahmen das Opfer nicht an.
Am nächsten Morgen fanden Sklaven, die erneut ausgesandt worden waren, das Mädchen zu suchen, vor einer billigen Kaschemme ein verschnürtes Bündel, das einem menschlichen Körper ähnelte. Dem, der es öffnete, starrten zwei gebrochene Augen entgegen. Es enthielt den blutverschmierten Leichnam der bis in den Tod getreuen Dienerin. Sie hatte ihr Leben gegeben, um das ihrer jungen Herrin zu retten.