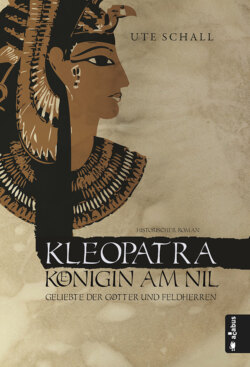Читать книгу Kleopatra. Königin am Nil - Geliebte der Götter und Feldherren - Ute Schall - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBekanntschaft mit Römern
Draußen vor den Toren der Stadt, wie es die ungeschriebenen Gesetze der Griechen und Römer vorsahen, sollte auch Nefer ihre letzte Ruhestatt finden. In seinem Zorn über den Ungehorsam der beiden jungen Frauen hatte Ptolemaios zunächst verfügt, sie zur Strafe in ein Massengrab zu werfen, wie es für Unfreie und das gemeine Volk üblich war, streunenden Hunden, hungrigen Ratten, Raben und Aasgeiern ausgesetzt. Aber Kleopatra hatte sich ihrem Vater zu Füßen geworfen und unter bitteren Tränen und vielfachen Entschuldigungen erreicht, dass er sich zuletzt erbarmen ließ, Nefer eine eigene Ruhestätte zu gewähren. Er kaufte ein Grab und ließ eine schöne Stele errichten, die das Relief einer freundlichen Dienerin zeigte, einer treuen Gefährtin, die gerade dabei war, ihrer jungen Herrin die Haare im Nacken zusammenzustecken. Wenige Worte hielten in den abstrahierten Bildern der ägyptischen Schrift die Umstände ihres Todes fest und drückten Kleopatras Schuldgefühle und Dankbarkeit aus. Weinend stand die Prinzessin vor der noch offenen Grube und flehte zu den Göttern, der geliebten Freundin ein erträgliches Schattendasein in der Unterwelt zu gewähren, wie sie es sich durch ein vorbildliches Leben verdient hatte. Vielleicht, tröstete sie sich, war es ja für eine Sklavin ein Glück, ihr Leben in Griechenland oder Rom auszuhauchen. Wäre Nefer im alten Reich am Nil gestorben, wäre ihre Erinnerung für alle Zeiten ausgelöscht gewesen. Daran hätte selbst ein König nichts ändern können. Denn in Ägypten hatten nur die Reichen und Einflussreichen Anspruch auf Einlass in die Ewigkeit. „Heute“, gestand Kleopatra ihrem Vater, der ihre Trauer schweigend respektierte und dessen anfänglicher Zorn einer tiefen Sorge um den Seelenzustand seiner Tochter gewichen war, „heute habe ich zum ersten Mal erfahren, was Verlust bedeutet. Nefer wird in meinem Herzen immer einen besonderen Platz einnehmen. Aber ich werde nie mehr ihre Stimme hören, nie mehr ihr silberhelles Lachen …“ Damit warf sie sich ihrem Vater an die Brust und ließ ihren Tränen freien Lauf.
„Es ist ein Vorrecht der Jugend, schnell zu vergessen, Herr.“ Der Bote, den Ptolemaios von Cypern aus nach Memphis geschickt hatte, hatte auch den Auftrag erhalten, Apollodoros in Ägypten einzuschiffen und nach Athen zu bringen. „Ich kann es nicht verantworten“, hatte der König zu seiner erstaunten Tochter gesagt, „dass du während unserer langen Reise keinen Unterricht erhältst, obwohl, wie es heißt, das Leben selbst oft die beste Lehrmeisterin ist. Apollodoros wird uns begleiten und dir die Schönheiten der griechischen Kultur, die ja auch ein Teil unserer eigenen ist, noch näher bringen. Was du bei ihm gelernt hast, wird dir die Erfahrung vor Ort noch anschaulicher machen. Übrigens ist unsere Familie in Sicherheit“, fuhr er fort, „du kannst also beruhigt sein. Auch weiß deine Mutter, dass du dich bei mir aufhältst. Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, wie dankbar ich bin, dass die Götter meine Gebete erhört haben. Bitten wir jetzt noch um die Gnade, uns alle in nicht allzu ferner Zukunft in Alexandria gesund wiederzusehen.“
Der König spazierte also mit dem Gelehrten, in philosophische Betrachtungen versunken, über das Deck. Apollodoros war längst zu Ptolemaios’ wichtigstem Vertrauten aufgestiegen und nahm unter den Unfreien am Hof von Alexandria eine privilegierte Stellung ein. Kleopatra stand indessen sinnend am Heck des Schiffes und sah mit feuchten Augen zu, wie sie sich immer weiter vom griechischen Festland entfernten. „Leb’ wohl, geliebte Freundin!“, flüsterte sie gegen den Wind. Ihr Lehrer irrte, wenn er glaubte, sie werde je vergessen. Wahrscheinlich würde mit der Zeit der Schmerz nachlassen – sie hatte es zumindest oft so gehört – und Nefer würde zuletzt nur eine freundliche Erinnerung sein. Aber noch tat es weh. Wussten die Männer, die ihr am nächsten standen, denn nicht, wie feinfühlig und empfindsam sie in Wirklichkeit war, dass sich hinter ihrer rauen Schale ein ganz weicher Kern verbarg?
Die Götter des Meeres und der Lüfte waren Ptolemaios’ Unternehmen gewogen. Nur ab und zu mussten die Ruderer eingreifen. Ansonsten segelte das Schiff lautlos über die flache See, als flöge es nur so dahin. In wenigen Tagen hatte die Reisegesellschaft die Südspitze der italischen Halbinsel erreicht. In Kürze würde sie Ostia anlaufen, die alte Hafenstadt Roms, wo Pompeius sicherlich schon ungeduldig ihr Eintreffen erwartete.
Die Kunde von Ptolemaios’ Flucht verbreitete sich in Alexandria wie ein Lauffeuer. Das Volk jubelte. Tücher schwenkend und Freudengesänge anstimmend zogen die Menschen durch die Straßen. Würde nun endlich ein neues Zeitalter anbrechen? Oder hatte man nur den einen Tyrannen gegen einen anderen getauscht, wie das schon so oft geschehen war? Bald hieß es, Kleopatra, die sechste aus der Königsfamilie dieses Namens, sei zusammen mit ihrer Tochter Berenike zurückgekehrt, und Berenike schicke sich an, zusammen mit ihrer ehrgeizigen Mutter die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Kleopatra? Aber wie war das möglich? Erst jetzt erfuhr das Volk, dass Ptolemaios die Schwestergemahlin vor fast eineinhalb Jahrzehnten verbannt und eine andere Frau in seinen Palast und sein königliches Bett geholt hatte. Aber wer war sie, deren Namen niemand kannte? Und wie war es dem König gelungen, die unglaubliche Aktion so lange geheim zu halten und seine Untertanen derart zu täuschen?
Kaum hatten Kleopatra VI. Tryphaina und die Erstgeborene des Königs den Thron bestiegen, stellte sich heraus, dass sie nicht daran dachten, die Zügel der Herrschaft lockerer zu halten. Im Gegenteil! In getreuer Nachahmung ihres Vaters unterdrückte Berenike das Volk, zwang ihm noch höhere Steuern ab, als Ptolemaios es getan hatte, und verteilte ihre Spitzel im ganzen Land. Ein unbedachtes Wort genügte, der geringste Ausdruck der Unzufriedenheit, und man war ihrer Gerichtsbarkeit ausgeliefert, die sie gnadenlos ausübte. Berenike regierte mit eiserner Hand und errichtete in kürzester Zeit ein Schreckensregiment, das an die schlimmste Zeit der Perserherrschaft erinnerte, die die Bewohner Ägyptens freilich nur aus den Erzählungen kannten. War man etwa dafür auf die Straße gegangen? Der Widerstand gegen Ptolemaios war eine Selbstverständlichkeit gewesen, fast ein Ritual, und niemand, der damals seinem Unmut lautstark Luft gemacht hatte, hatte Schlimmes zu befürchten gehabt. Doch jetzt wagte keiner, seine Unzufriedenheit mit dem Regime öffentlich kundzutun. Nachbar fürchtete sich vor dem Nachbarn, Freund vor dem Freund. Kein Vater war seines Sohnes, kein Sohn seines Vaters sicher. Manche Familienfehde, seit vielen Jahren unterschwellig ausgetragen, fand jetzt ihr blutiges Ende. Und eine Änderung der Verhältnisse war nicht in Sicht. Schon wünschte man sich Ptolemaios Auletes zurück. Doch man wusste ja nicht einmal, wo er war und ob er überhaupt noch lebte.
Bald nach der Übernahme des Thrones fühlte sich Kleopatra Tryphaina müde und verbraucht. Sie wurde von Tag zu Tag schwächer. Zusehends verfiel die einst so starke Frau, sodass immer mehr Aufgaben auf ihre Tochter übergingen. Die Ärzte wussten keinen Rat und auch Kräuterfrauen und Geistheiler konnten sich auf den Zustand der Königin keinen Reim machen. War sie vielleicht von einem bösen Dämon befallen? Gegen ihn wäre freilich mit menschlichen Mitteln nichts auszurichten. Da konnten nur die Götter helfen.
Nur ein Jahr war seit der Flucht ihres früheren Gatten vergangen, da wurde es Kleopatra unmöglich, das Bett zu verlassen. Berenike machte sich weniger Sorgen um die Krankheit der Mutter als um ihren eigenen Stand. Würde Kleopatra jetzt sterben, was würde dann mit ihrem, Berenikes, Anspruch auf den ägyptischen Thron? Es kam jetzt darauf an, diesen von höchster Stelle bestätigen zu lassen. Sie würde unverzüglich eine Gesandtschaft nach Rom schicken, die ihre Interessen vor dem dortigen Senat vertreten sollte. Ptolemaios war schon dort, um die Römer um Hilfe zu bitten. Das hatte sie von ihren Spitzeln erfahren. Wer von ihnen würde es schaffen, die neuen Herren der Welt mit den besseren Argumenten zu überzeugen und auf seine Seite zu bringen? Was sie betraf, so würde sie nicht weniger als 100 Gesandte aufbieten und an Schätzen alles, was sie und ihr noch immer reiches Land aufbringen konnten.
In Rom ging die Sache des Königs kaum voran. Würde es Pompeius, auf dessen Landgut in den Albaner Bergen die Flüchtlinge Aufnahme gefunden hatten, gelingen, im Senat die Mehrheit für die Rückführung des fremden Königs mit römischer Hilfe zu gewinnen? Der große Feldherr war sich nicht sicher. Seine Stellung war geschwächt. Er hatte leichtsinnigerweise nicht nur die Optimaten gegen sich aufgebracht, sondern auch Crassus, seinen Kollegen im Triumvirat, der in Rom vor kurzem eingeführten Dreimännerherrschaft, der auch der aufsteigende Gaius Iulius Caesar angehörte. Ptolemaios, der sich auf Pompeius’ Wunsch eigentlich hätte ruhig verhalten und abwarten sollen, begann bald, der Entscheidungsfindung der eingeschriebenen Väter nachzuhelfen. Er hatte bereits eine ganze Reihe führender Römer bestochen, als er gegen die unliebsame Gesandtschaft der ägyptischen Thronräuberin vorging. Bei Puteoli in der lieblichen Campagna hatten die Ägypter angelegt, um von dort aus Rom auf dem Landweg zu erreichen. Schon unterwegs fielen viele durch Mörderhand. Diejenigen, denen es gelang, unversehrt nach Rom zu gelangen, wurden von Ptolemaios entweder durch bare Münze überzeugt, von ihrem Vorhaben abzulassen, oder ebenfalls ermordet, wenn sie sich dem Wunsch des Königs ohne Land widersetzten. Diese Behandlung von Gesandten, die selbst für römische Verhältnisse ungewöhnlich, ja verwerflich war – in der Regel galten Boten bei vielen Völkern, zumindest bei denen, die Anspruch auf eine gewisse Zivilisation erhoben, als unantastbar – rief im Senat heftige Proteste hervor, blieb aber ungesühnt. Zu viele Senatoren hatten von den Verbrechen profitiert und sich gewissermaßen zu Mittätern oder zumindest Mitwissern gemacht. So schien es besser, es beim Protest zu belassen.
Da Ptolemaios auf die Flucht nur wenig Geld hatte mitnehmen können, nahm er bei reichen Römern Kredite auf, um seine Rückführung und die Bestechungen zu finanzieren. Sein Hauptgläubiger hieß Gaius Rabirius Postumus, ein skrupelloser Mensch, der die Ägypter bald für seine „Großzügigkeit“ bestrafen sollte.
Gleich einer Gefangenen wanderte Kleopatra in den Gärten von Pompeius’ Landgut umher. All ihre Hoffnungen, die Weltstadt Rom, um die sich so viele Geschichten rankten und die so herrliche Bauwerke aufweisen und Vergnügungen bieten sollte, mit eigenen Augen zu sehen, waren zunichte geworden. Pompeius hatte sie ausdrücklich angewiesen, den Landsitz nicht zu verlassen, um das sensible Vorhaben nicht zu stören. Zu ihrer Zerstreuung hatte er Gaukler und Artisten, Tänzer und Sänger in die Albaner Berge geschickt, fahrendes Volk, das den Fremden keine allzu willkommene Abwechslung bot. Gerade was kulturelle Darbietungen betraf, waren die Mitglieder des ägyptischen Königshauses äußerst verwöhnt.
Langsam verlor Ptolemaios die Geduld. Immer höhere Bestechungsgelder flossen, immer lauter forderte der König die Hilfe Roms. Behandelte man so etwa Freunde und Bundesgenossen des römischen Volkes? Der König war zutiefst enttäuscht. Dann endlich erteilte der Senat Pompeius’ Freund Publius Cornelius Lentulus Spinther den Auftrag, nach Ephesus zu reisen und dort die Rückkehr des Königs vorzubereiten. Aber die Götter Roms hatten auch noch ein Wörtchen mitzureden. Als wollten sie das Unternehmen aufschieben, schlug auf dem Mons Albanus in die Statue Jupiters ein Blitz ein, ein denkbar ungünstiges Omen, das nur zur Vorsicht mahnen konnte. Um ganz sicher zu gehen, wie zu verfahren sei, wurden die Sibyllinischen Bücher befragt. „Wenn der Ägypter mit der Bitte um Hilfe kommt“, meinte die Stelle, auf die der zuständige Priester zufällig getroffen war, „verweigert sie ihm nicht! Aber hütet euch, ihm eine größere Streitmacht zur Verfügung zu stellen! Denn damit drohten euch nur Ungemach und Gefahr.“
Es konnte nicht verhindert werden, dass das römische Volk von der Warnung erfuhr, die in der Öffentlichkeit heftige Diskussionen auslöste. Was gingen die Römer die Belange dieses Flötenspielers an? Sollten sie etwa ihr Leben einsetzen, um diesem unsympathischen Fettwanst zu seinem vermeintlichen Recht zu verhelfen? Der Senat wagte nun nicht mehr, gegen den herrschenden Volkswillen zu entscheiden. Die lästige Angelegenheit wurde vertagt und schließlich ganz von der Tagesordnung gestrichen.
„Ist Ephesus auch von den Griechen gegründet worden?“, interessierte sich Kleopatra, die am Arm ihres Vaters in den Straßen der jetzt römischen Stadt flanierte. Der in Gedanken versunkene König antwortete nicht und so wiederholte die Tochter die Frage. „In der Tat“, meinte er schließlich, „und sie gehört zu den wichtigsten Städten in diesem Teil der Welt. Ihre Bibliothek genießt bis heute einen gewissen Ruf, der freilich nicht dem der Büchersammlung, die wir in Alexandria haben, gleichkommt. Wie du ja weißt, wird bei uns das gesamte Wissen der Menschheit von ihren Anfängen an bewahrt. Dennoch geschieht hier Bemerkenswertes. Im Theater beispielsweise werden immer die neuesten Stücke aufgeführt. Ephesus ist ein Zentrum der Kultur mit herrlichen Säulenhallen, Basiliken und Tempeln. Überhaupt ein Kleinod ausgezeichneter Architektur.“
Auch hier zehrte das lange Warten auf die endgültige Entscheidung Roms an den Nerven der Flüchtlinge und stellte ihre Geduld auf eine weitere harte Probe. Kleopatra beschloss, sich nicht länger dem Nichtstun und der Langeweile hinzugeben. Am Stadtrand von Ephesus hatten kühne Baumeister auf sumpfigem Gelände der Stadtpatronin Artemis einen Tempel errichtet, wie ihn die Welt zuvor niemals gesehen hatte, ein Heiligtum, das alles bisher Dagewesene an Schönheit und Monumentalität weit übertraf. So jedenfalls hatte es ihr ihr Lehrmeister Apollodoros geschildert. Wenn man ihm glauben konnte, zählte es längst zu den Wundern, die Menschenhand erschaffen hatte.
Mit ungläubigem Staunen betrachtete Kleopatra das erhabene Bauwerk von ferne und fragte sich, wie es Architekten gelungen war, ein derart mächtiges Gebäude auf dem unsicheren Grund zu errichten, obwohl doch jedes Kind wusste, dass man Sümpfe wegen der Gefahr zu versinken am besten mied.
Zum Artemistempel also wanderte die Königstochter, sooft sie glaubte, ihren Vater, der immer stärker an Melancholie und Schwermut litt, allein lassen zu können. Seit Menschengedenken pilgerten Gläubige dorthin, um zu der vielbrüstigen Göttin, die Fruchtbarkeit und Leben spendete, zu beten und ihr Opfer zu bringen. Durch die vielen Geschenke und Gaben, die sie mitbrachten, war der Tempel mittlerweile unermesslich reich geworden. Und auch die nahegelegene Stadt Ephesus profitierte von dem nicht ablassenden Pilgerstrom. Bald, dachte die Königstochter, bald würde auch sie sich ein Herz fassen und das Heiligtum, das sie bisher nur von außen bewundert hatte, betreten, um Artemis ihre vielfachen Anliegen vorzutragen, den Wunsch etwa, bald nach Hause zurückkehren zu dürfen und den richtigen Partner zu finden, um ihm Kinder zu schenken, wenn ihre Zeit gekommen wäre.
„Sei gegrüßt, Kleopatra vom Nil“, empfing sie eine junge Tempeldienerin, deren Schädel glatt rasiert war. Kleopatra wunderte sich, woher das fremde Mädchen ihren Namen kannte. Aber sie sagte nichts. Neugierig betrachtete sie die junge Frau, die ihr Leben offensichtlich ganz in den Dienst der Gottheit gestellt hatte, sah das braun geschminkte Gesicht, bemerkte den alles durchdringenden Blick und den schlanken, fast knabenhaften Körper, der sich unter dem durchsichtigen Gewand abzeichnete. „Die Große Mutter erwartet dich schon“, fuhr das Mädchen fort, und Kleopatra fiel die tiefe, dunkle Stimme auf, die zu der unwirklichen Erscheinung so gar nicht passte. „Mein Name ist Aphasia, und du darfst mich gern so nennen.“ Damit nahm sie Kleopatra an der Hand und führte sie ins Innere des Gotteshauses, das von zahllosen Öllämpchen in ein diffuses Licht getaucht war. Schwaden von Weihrauch schlugen Kleopatra entgegen und eine Luft, die ihr schier den Atem nahm. Sie brauchte einige Zeit, bis sich ihre Augen an den geheimnisvollen Dämmer gewöhnt hatten. „Warte einen Augenblick!“, bat Aphasia und verschwand in einem Gemach, aus dem sie jedoch gleich wieder zurückkam, in der Hand ein hauchzartes weißes Gewand, das mit Gold- und Silberfäden durchwirkt war und dem Kleid der Tempelfrau glich. „Ehe du dich der Großen Mutter Artemis nähern darfst, um zu opfern und zu beten, musst du dich einer strengen Reinigung unterziehen. So verlangt es der Brauch. Du bist übrigens im richtigen Augenblick gekommen, Königstochter vom Nil. Wir feiern heute das große Fest der Fruchtbarkeit mit Opfern, Gesang, Musik und Tanz. Die Frauen, die auserwählt wurden, haben sich bereits versammelt. Später wirst du dich ihrem Kreis anschließen, später, wenn die Göttin bereit ist, dich zu empfangen.“ Leiser Gesang drang an Kleopatras Ohr, ein feines Summen, fern und unwirklich, ein gleichmäßiges Murmeln zu sich stets wiederholender Melodie.
Die beiden jungen Frauen betraten ein anderes Gemach, in dem es fast kein Licht gab. Aus einer kleinen Luke in der Decke fiel ein winziger Sonnenstrahl. In der Mitte des Raumes stand ein großes bronzenes Becken, das mit nach Rosenöl duftendem Wasser gefüllt war. Aphasia begann, die Königstochter langsam zu entkleiden. Dann bat sie den Gast, in das Becken zu steigen und ganz unterzutauchen. In kreisenden Bewegungen, sachte und bedächtig, wusch sie Kleopatras Gesicht, fuhr sanft über Brüste und Bauch und kam schließlich bis zu den Füßen. Dabei sagte sie magische Formeln in einer Sprache auf, die Kleopatra nicht verstand. Zuletzt streifte sie der Gereinigten das mitgebrachte Gewand über. Zufrieden betrachtete sie ihr Werk und führte die Bittstellerin schließlich vor die Statue der Großen Mutter, ein Meisterwerk aus Gold und Elfenbein, dessen Anblick Kleopatra fast die Sprache verschlug. „Bete und faste“, befahl Aphasia, „damit du dich des Anblicks der Göttin würdig erweist. Ich entferne mich jetzt und werde dich erst wieder holen, wenn Artemis mir ein Zeichen gibt. Aber ich kenne weder den Tag noch die Stunde. Sei also bereit!“
Ehrfurchtsvoll sah sich Kleopatra in dem hohen Saal um, den nur das übergroße Standbild der Göttin schmückte. Von Ferne erklang wieder der eintönige Singsang. “Große Mutter, Spenderin aller Gaben. Du Leben gebende und tötende Göttin. Du, aus der alles wird. Du, mit der alles vergeht. Mit der alles vergeht.“ Kleopatra stimmte in das unbestimmte Murmeln ein, fand zum Gebet, betete so inbrünstig, wie sie zuletzt gebetet hatte, als ihr der Glaube der Kindheit noch nicht abhandengekommen war. „Heilige Artemis von Ephesus“, formten ihre ein wenig zitternden Lippen, „in großer Bedrängnis komme ich zu dir. Erhöre, oh Mutter, mein Flehen.“ Dann trug sie der Gottheit alles vor, was ihr auf der jungen Seele brannte. „Sichere uns eine baldige Heimkehr, und schenke mir einen liebevollen Gefährten und Kinder, in denen ich weiterleben kann in Ewigkeit! Dir zur Ehre, dir zum Ruhme.“ Gesenkten Hauptes hatte sie vor der Göttin gestanden. Jetzt erhob sie den Blick und ihr war, als schenke ihr die Große Mutter ein huldvolles Lächeln.
Leise war Aphasia hinter sie getreten. Kleopatra hatte die Tempeldienerin nicht gehört. Wie lange mochte sie vor der Göttin gebetet haben? Sie wusste es nicht. Zeit schien keine Rolle zu spielen an diesem Ort, der mit der Wirklichkeit nichts gemein hatte. „Es hat den Anschein, als habe sich die Göttin deiner gnädig angenommen“, flüsterte hinter ihr die dunkle Stimme. Hatte gerade Artemis selbst aus dem Mädchen gesprochen? „Du bist ausersehen, ihr heute das Opfer darzubringen, ein weißes Lamm, das du auf ihrem Altar schlachten wirst.“ „Töten, ich?“, wunderte sich Kleopatra. Das Tierchen wartete schon. Es zitterte, aber es wehrte sich nicht. Es hatte sich mit seinem Schicksal längst abgefunden. Dann ging alles sehr schnell. Blut, das von der Altarplatte tropfte. Das Lecken der Flammen an dem blondgelockten Fell. Der Geruch verbrannten Fleisches, das Knistern des heiligen Feuers. Und wieder Stille. Aphasia bedeutete Kleopatra nun, ihr zu folgen. Wie im Rausch, als hätte sie keinen eigenen Willen mehr, lief die Königstochter dem Tempelmädchen nach, fand die im Reigen tanzenden Frauen. „Sei gegrüßt, Kleopatra!“, riefen sie ihr zu. „Willkommen, liebe Schwester!“ Aber Kleopatra war unfähig, den Gruß zu erwidern. Als hätte es ihr die Sprache verschlagen. Sie nickte ihnen nur freundlich zu und reihte sich ein in den fröhlichen Kreis, tanzte und sang. Flötenspielerinnen begleiteten den festlichen Akt. Wieder verlor Kleopatra das Gespür für die Zeit. Wann war sie hierhergekommen? Vor einem Tag, vor zwei Monden oder einem Jahr? Alles um sie herum versank. Apollodoros kam ihr entgegen, auch Imhotep erkannte sie, zwei strahlende Jünglinge, beide rank und schlank. Und dann erschien er, Ptolemaios, der nicht länger ihr Vater, sondern – wer war? Sie wusste es nicht. Staunend stand sie neben sich, eine Fremde. Freudig sah sie sich ihm entgegen eilen, auch er ein junger Mann, dessen Augen Wärme und Liebe verströmten. Eng umschlang er sie, berührte sanft ihre Brüste und Scham …
Die rosenfingrige Morgenröte verstreute gerade ihr erstes diffuses Licht, als sich Kleopatra an der Schwelle des Tempels wiederfand. Sie trug die Kleider, in denen sie – wann? – hierhergekommen war. Was war geschehen? „Heute Nacht bist du zur Frau geworden, Königstochter vom Nil.“ Es war die dunkle, bereits vertraute Stimme, die hinter ihr sprach. „Bald werden dir die mächtigsten Männer der Welt zu Füßen liegen. Du wirst heiraten, Kinder haben und herrschen, Kleopatra. Und die Menschen werden deiner in Ewigkeit gedenken. Die gnädige Göttin hat deine Gebete erhört. Aber vergiss nie, dass das Leben auf dieser Erde ein endliches ist! Und jetzt eile zu deinem Vater und packe deine Sachen zusammen! Denn in wenigen Stunden schon wirst du dich auf den Weg in deine Heimat machen.“ Kleopatra drehte sich um. Aber niemand war zu sehen.
Was war geschehen? Der römische Senat hatte die Flüchtlinge aufgefordert, Rom zu verlassen und Lentulus nach Kleinasien zu begleiten, um dort die Entscheidung Roms abzuwarten. Widerwillig nur war der König der Aufforderung gefolgt. Es waren bereits zwei Jahre vergangen, seit er sein Königreich verlassen hatte und es hatte nicht den Anschein, als könne er bald dorthin zurückkehren. Erst im folgenden Frühling – in Rom schrieb man das Jahr 698 a.u.c. – bat Pompeius den Statthalter von Syrien, A. Gabinius, mit dem er befreundet war, Ptolemaios nach Ägypten zu begleiten. Ein gütiger Himmel hatte die Stellung des großen Generals gestärkt. Er hatte nicht nur das Triumvirat gefestigt, sondern auch zu Beginn des Jahres das Konsulat angetreten.
Dennoch musste Ptolemaios weiterhin Überzeugungsarbeit leisten. Nach der Zahlung von 5000 Talenten und dem Versprechen von weiteren 5000 im Falle des Erfolgs sah der Vertreter der römischen Staatsmacht in Syrien von seinen Plänen, Thronstreitigkeiten im Partherreich zugunsten Roms zu nutzen, ab, um sich der ägyptischen Frage zu widmen. Doch würde die römische Invasion gelingen?
Die Gerüchte von der unmittelbar bevorstehenden Rückkehr des rechtmäßigen Königs waren bis in den Palast gedrungen und raubten der selbst ernannten Königin den Schlaf. Ohnehin war sie nicht beliebt. Die Alexandriner wollten sich mit der Alleinherrschaft einer Frau nicht abfinden, schon gar nicht mit einer, die sie nur unterdrückte. Rat suchen konnte Berenike nun bei niemandem mehr. Ihre Mutter, die mit mehr Recht als sie selbst den Titel „Königin vom Nil“ getragen hatte – war sie doch immerhin mit dem König verheiratet und sogar dessen Halbschwester gewesen – war bald nach Berenikes Thronbesteigung den Entbehrungen des ungeliebten Exils und ihrer Schwäche erlegen – manche munkelten auch von ihr heimlich verabreichtem Gift – und hatte die junge Frau schutzlos zurückgelassen. Im Angesicht der Gefahr für Thron und Leben stimmte Berenike der Heirat mit einem Angehörigen der seleukidischen Königsfamilie zu, einem ungehobelten Klotz ohne Manieren und Bildung, dessen sie sich schon bald nach der Hochzeit in bewährter Familientradition entledigte. Sie ließ ihn kurzerhand erdrosseln. Der nächste Bräutigam, Archealos, entsprach mehr ihrem exquisiten Geschmack. Pompeius selbst hatte ihn als Priesterfürsten am Pontus eingesetzt. Er wusste, wie sehr die Menschen am Nil Helden verehrten und so gab er sich stolz als Sohn Mithridates’ VI. Eupator aus, des letzten hellenistischen Königs, der die Römer das Fürchten gelehrt hatte. Drei Jahre, nachdem Berenike den Thron bestiegen hatte, wurde ihr Gemahl Mitregent.
Aber diese Lösung gefiel den Römern erst recht nicht. Hier musste Abhilfe geschaffen werden, so viel stand fest. Doch Gabinius zögerte. Der Einmarsch in Ägypten mit römischen Truppen hätte seine Befugnisse weit überschritten. Unter seinen Leuten befand sich jedoch ein junger Reiteroffizier, der schon viel von sich reden gemacht hatte. Er hieß Marcus Antonius und war für seine draufgängerische Art bekannt. Es war für ihn nicht allzu schwer, Gabinius von der Notwendigkeit einer militärischen Intervention zu überzeugen. Schnell und entschlossen stieß der junge General mit seiner Reiterei bis Pelusion vor. In zwei blutigen Gemetzeln besiegte er Archealos, der tot auf dem Schlachtfeld blieb. Berenike wurde gefangen genommen. Damit war der Weg frei für die Wiedereinsetzung Ptolemaios’. Noch ahnte Marcus Antonius nicht, dass er sich mit seinem forschen Vorgehen die Grundlage der eigenen Herrschaft in diesem Teil der Welt geschaffen hatte und eine Ptolemäerin sein Schicksal werden sollte.
Nach unendlichen Mühen und Entbehrungen war die Gefahr nun endlich gebannt und Ptolemaios konnte daran denken, seine Familie nach Hause zu holen. Er hatte zunächst beabsichtigt, sich selbst auf den Weg zu machen. Doch Marcus Antonius hatte davon abgeraten. Die Königin, meinte er, hätte gewiss Verständnis dafür, dass es in diesen unsicheren Zeiten nicht ratsam wäre, Alexandria wenn auch nur für wenige Tage zu verlassen. Denn noch habe man nicht alle Anhänger Berenikes dingfest machen können, und er selbst, Marcus Antonius, werde sich nicht mehr lange um Ptolemaios’ Sicherheit kümmern können. Er müsse bald nach Rom zurückkehren, wo sein Freund Gaius Iulius Caesar seiner Unterstützung dringend bedürfe.
So ungeduldig der König auch das Wiedersehen mit den Seinen ersehnte, war er doch froh, nicht seinem Schwiegervater gegenübertreten zu müssen und sich vielleicht noch vorhalten zu lassen, er habe sich feige aus dem Staub gemacht und die Sache Ägyptens zu einer römischen gemacht. Also schickte er eine Gesandtschaft nach Memphis, reich beladen mit Geschenken für das Heiligtum des Apis und mit dem Auftrag, die Königin und seine drei Kinder zu holen. Als sich das königliche Prunkschiff dem Hafen von Alexandria näherte, stand er am Kai. Wenige Augenblicke später fielen sich die Gatten in die Arme und küssten sich leidenschaftlich. Dann nahm Ptolemaios seine Kinder auf den Arm und staunte, wie groß sie geworden waren. Auch Kleopatra warf sich ihrer Mutter entgegen, tränenreich um Verzeihung bittend.
„Wie sagst du, Vater, ist sein Name?“ Kleopatra flüsterte ganz leise an Ptolemaios’ Ohr. „Er heißt Marcus Antonius, mein Kind. Und man erzählt sich die wildesten Geschichten über ihn. Man lobt sein militärisches Genie, das überragend sein soll, obwohl er noch so jung ist. Er soll übrigens Gaius Iulius Caesar sehr nahe stehen.“ Der König lächelte. „Es heißt in Rom, er sei einmal wie ein Verrückter mit seinem Wagen durch die römischen Gassen gejagt und das Gefährt sei von vier Löwen gezogen worden. Viele Menschen seien aus Furcht schimpfend und fluchend in ihre Häuser geflohen. Aber es habe auch welche gegeben, die das einmalige Schauspiel genossen hätten. Er scheint wirklich ein wenig verrückt zu sein, dieser Antonier.“ Der König, zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder glücklich, da ihm sein Königreich und seine Familie zurückgegeben worden waren, prostete dem römischen Gast zufrieden lächelnd zu. „Auf Ägypten und auf Rom!“ „Auf Rom und seine Bundesgenossen!“, gab Marcus Antonius freundlich zurück.
Gabinius konnte sich nicht lange in Ägypten aufhalten, da in Syrien Unruhen ausgebrochen waren, die seine Anwesenheit erforderten. So entschloss er sich, zur Sicherheit des Königs römische Truppen am Nil zurückzulassen und sie dem Oberbefehl des Marcus Antonius zu unterstellen. Der tüchtige Offizier sollte bleiben, bis Ptolemaios die Hauptstadt wieder ganz unter seiner Kontrolle hätte.
Ptolemaios’ Wiedereinsetzung in seine angestammten Rechte wurde mit einem großen Festmahl begangen, bei dem Marcus Antonius einen Ehrenplatz erhielt. Der König wusste, was er der Beharrlichkeit und dem Mut des jungen Mannes zu verdanken hatte. Ab und zu wagte Kleopatra, die während des Essens neben ihrem Vater lag und der kein Wort der lebhaften Unterhaltung entging, dem Vertreter Roms einen verstohlenen Blick zuzuwerfen. Sie hatte schon manchen Römer kennengelernt: einfache Seeleute, die sich im Hafenviertel herumtrieben, Händler, die ihre Waren bis in den Palast brachten, und auch den einen oder anderen Neugierigen, der die Sehenswürdigkeiten ihres Landes besuchte, eines Reiches, dessen Hochkultur schon geblüht hatte, noch ehe ein zivilisierter Mensch seinen Fuß an Latiums raue Gestade setzte. Von ihrem Lehrer Apollodoros hatte sie erfahren, dass Reisen an den Nil bei den Vornehmen Roms längst zum guten Ton gehörten. Noch nie aber war sie einem römischen Soldaten begegnet, der sich schon in seinem Äußeren so auffällig von den einheimischen Kriegern unterschied. Und dann kam er, der sich Marcus Antonius nannte, und lag mit ihr und ihrer Familie an dieser großen Festtafel, als gehöre er längst dazu, und scherzte und zog die Blicke der Damen auf sich! Ob er sich dessen bewusst war? Wie alt er wohl sein mochte, dieser Römer? Ob er zu Hause Frau und Kinder hatte? Schön war er nicht, so viel stand fest. Für ihren Geschmack waren seine Züge ein wenig zu derb, war seine Gestalt zu untersetzt. Da kannte sie andere, besser aussehende Männer. Und doch! Er strahlte etwas aus, das sie noch nicht einordnen konnte, einen unbeugsamen Willen vielleicht oder eine Autorität, die alles um ihn herum verstummen ließ. Er war zweifellos der Mittelpunkt dieser abendlichen Gesellschaft, die die glückliche Heimkehr des Königs feierte. Und doch blieb er inmitten all dieser Fröhlichkeit ein Fremder mit einem bitteren Zug um den zugegeben schönen Mund.
Sie hatte ihren Blick gesenkt und als sie erneut aufschaute, trafen sich ihre Augen. Schnell sah die Königstochter weg und fühlte, dass eine bisher unbekannte Hitze in ihr aufstieg, fühlte, wie sich ihr Puls beschleunigte und ihr Gesicht errötete. Ich bin jetzt fast 15 Jahre alt, dachte sie bei sich. Die meisten Ägypterinnen sind in meinem Alter schon verheiratet. Und auch in Rom, wie man mir sagte. Aber wie komme ich jetzt darauf? Was hat mein Alter mit diesem Menschen zu tun? Ich spüre, dass er mich ansieht. Und ich kann nicht einmal sagen, dass es mir unangenehm wäre. Nein, ich genieße es. Aber nur nicht zurückschauen. Was bildet der sich überhaupt ein?
Die Freudenhymnen waren verklungen, der Alltag war wieder eingekehrt im alten Reich am Nil. Der Großteil der römischen Truppen war abgezogen, auch Marcus Antonius hatte Ägypten verlassen. Kleopatra hatte ihn längst vergessen. Aber hatte sie das wirklich? Nachts, wenn alles in den weitläufigen Palastanlagen schlief, doch sie selbst auf ihrem Lager keine Ruhe fand, war ihr, als stiege er blutüberströmt aus den Tiefen einer vergangenen Zeit. Tausend Schwerter erhoben sich blitzend gegen ihn, bohrten sich tief in sein Fleisch. Wankend kam er auf sie zu und brach vor ihren Augen tot zusammen. Und mit seinem Ende wurde ihr das eigene schmerzlich bewusst. „Du hast zu schwer zu Abend gegessen, kein Wunder, wenn dich so mancher Albtraum drückt“, hätte Nefer gesagt und sie hätte sicherlich recht gehabt. Wie sollte sie ausgerechnet diesen strahlenden römischen Helden je wiedersehen?
Bald machte sich Ptolemaios daran, in seinem Reich kräftig aufzuräumen. Ein fürchterliches Blutgericht erwartete all jene, die es gewagt hatten, sich auf Berenikes Seite zu schlagen. Allen voran sollte die Königstochter selbst hingerichtet werden. Kleopatra versuchte zwar, ihren Vater umzustimmen, die Halbschwester zu verschonen, auch wenn sie für Berenike keine große Sympathie hegte. Aber Schwester blieb Schwester. Daran gab es nichts zu rütteln. Doch alle Bitten Kleopatras halfen nichts. Ptolemaios war nicht davon abzubringen, seine älteste Tochter des Hochverrats anzuklagen und sie ein für alle Mal zu beseitigen. Konnte es nicht sein, dass am Hof noch mancher Sympathisant der Untreuen lebte, der nur auf eine günstige Gelegenheit wartete, den König wieder zu vertreiben und sie erneut zu inthronisieren? Und hätte Berenike gezögert, den Vater aus dem Weg zu räumen, wenn sie gesiegt hätte und seiner habhaft geworden wäre?
Noch hatte Phoebus Apollo seinen Sonnenwagen nicht aufgezogen. Über Alexandria herrschte noch nächtliche Stille. Dämmeriges Halbdunkel lag auch über dem Innenhof des Palasts. Nur die königliche Familie war bereits wach. An der Hand ihres Vaters stolperten die beiden kleinen Prinzen schlaftrunken zum Richtplatz, wo der Scharfrichter mit verhülltem Haupt bereits wartete. Vergeblich hatte Kleopatra Ptolemaios angefleht, ihr und den jüngeren Geschwistern den grausigen Anblick der Hinrichtung ihrer Schwester zu ersparen. Doch der Vater wollte davon nichts wissen. Ptolemaios liebte seine Kinder, gewiss. Und er vermochte sich kaum vorzustellen, dass jemals eines von ihnen … Aber hatte er bei seiner Erstgeborenen je geahnt, wie schändlich sie ihn einmal verraten würde, auch wenn sie wahrscheinlich den bösen Einflüsterungen ihrer Mutter, der verstoßenen und auf Rache sinnenden Gattin, erlegen war? Es bestand immer die Gefahr, höfischen Intrigen zum Opfer zu fallen und zu unbedachten Taten verführt und von ihm verstoßen zu werden, ob seine Kinder nun Kleopatra, Arsinoë oder wie seine Söhne nach dem Vater Ptolemaios hießen. Was einen Verräter erwartete, konnte man ihnen nicht früh genug vor Augen führen.
Am Fuße der Richtstätte stellte sich die Familie auf. Noch hatte Kleopatra die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, der Vater werde im letzten Augenblick Gnade vor Recht ergehen lassen und das Todesurteil in lebenslängliche Verbannung umwandeln. Doch die strenge Miene des Königs verriet, dass er nicht daran dachte. Sie warf Arsinoë einen verstohlenen Blick zu. Schön, als wäre sie dem Meißel eines überaus begabten griechischen Künstlers entsprungen, eines Phidias gar, tänzelte das Mädchen von einem Bein auf das andere, betrachtete bewundernd ihre mit Henna gefärbten Handrücken und zupfte an ihrem Gewand, das rot und schreiend vor dieser Kulisse völlig fehl am Platz war und den Eindruck erweckte, als wolle das junge Mädchen nicht gleich einer Familientragödie beiwohnen, sondern zu einer Festlichkeit eilen, wo sie allen Männern den Kopf zu verdrehen gedachte. Für einen Augenblick kam Eifersucht in Kleopatra auf. Nicht nur wegen Arsinoës fast überirdischer Schönheit, sondern auch wegen der unbekümmerten Art, mit der sie durch das Leben ging, ohne sich über irgendetwas ernsthafte Gedanken zu machen. Warum nur konnte die Natur nicht einmal eine Ausnahme machen und Schönheit und Geist in einer Person vereinen? Aber wollte sie wirklich Arsinoë sein, dieses naive Geschöpf, das über die Spiele der Kindheit nie hinauszukommen schien?
Quietschend öffnete sich die schwere Eisentür, die zum unterirdischen Verlies des Palastes führte. Heraus kam als Erste Berenike, dicht gefolgt von zwei Wächtern, grobschlächtigen Kerlen, die das Mädchen festhalten wollten. Unwirsch schüttelte Berenike sie wie lästige Insekten ab. Kleopatra hätte die Schwester beinahe nicht erkannt. Nach der Verkündung des Todesurteils und nur einer Nacht Kerkerhaft schien sie um Jahrzehnte gealtert zu sein. Es sah fast aus, als führe man nicht sie zum Schafott, sondern ihre Mutter, die längst verstorbene Kleopatra Tryphaina. „Tod, Tod und nochmals Tod!“, hatten die Ankläger gestern gefordert. Einmal für den Hochverrat, dann für Kleopatra Tryphaina, deren frühem Ableben, so hieß es plötzlich, Berenike mit einem schleichenden Gift nachgeholfen habe, und schließlich für die Ermordung des ungehobelten Seleukidensprosses. Bereitwillig hatten sich die Richter in vorauseilendem Gehorsam dieser Forderung angeschlossen, ohne weitere Beweise zu erheben oder der Angeklagten auch nur Gelegenheit zur Verteidigung zu geben. Hatte doch der König nickend allen Anklagepunkten zugestimmt. Nur die Art der Hinrichtung war in sein Ermessen gestellt worden. Nach langem Überlegen hatte er sich für die ‚menschenwürdigste‘ Tötung entschieden, den Tod durch das Schwert, auf den auch römische Bürger Anspruch hatten. Ptolemaios wollte die Hochverräterin vernichten, nicht leiden sehen. Dass sie möglicherweise auch seine frühere Gattin auf dem Gewissen hatte, interessierte ihn am allerwenigsten.
Auch angesichts des unmittelbar bevorstehenden Endes hatte die Königstochter ihren Stolz nicht verloren. Hoch erhobenen Hauptes ging sie auf die erhöhte Richtstätte zu und stieg scheinbar gelassen die wenigen Stufen hinauf, als schritte sie nicht zu ihrer Hinrichtung, sondern zu ihrer Hochzeit, sah sich, oben angekommen, interessiert um, als wolle sie die zählen, die an dem Schauspiel teilnahmen, und warf dem Vater einen Blick zu, in dem sich Triumph und Mitleid die Waage hielten. Zum ersten Mal entdeckte Kleopatra in der Schwester die Frau, ihr ebenbürtig von Blut und Geburt, sah die blasse Schönheit, die der Mondgöttin Selene glich, die schlanke Gestalt in dem schwarzen Büßergewand und bewunderte die Haltung, die einer Königin würdig war. Noch einmal schweifte der Blick der Verurteilten in die Runde: zu den Beamten des Hofstaats, die der König ebenfalls zur Anwesenheit verpflichtet hatte, zu ihrer Dienerin, die die Tränen nicht zurückhielt, und zu Kleopatra, der ungeliebten, aber doch eben Schwester, und ein zynisches Lächeln umspielte Berenikes volllippigen Mund. Dann kniete sie nieder.
Kleopatra sah in der jetzt aufgehenden Sonne die silberne Schneide des Schwertes blitzen und schloss ihre Augen. Als sie sie wieder öffnete, rollte Berenikes Haupt über das Blutgerüst. Der Scharfrichter nahm es schnell mit einem schwarzen Tuch auf. Aus dem leblosen Körper spritzte das Blut, sammelte sich in Lachen, schlängelte sich in Rinnsalen und kleinen Bächen. Es war, als verströme die Getötete sich selbst, damit aus ihrem Schoß neues Leben sprieße. Kleopatra betrachtete das Gesicht ihres Vaters. Über Ptolemaios‘ feiste Wangen rannen Tränen. Sie erinnerte sich nicht, wann sie den König je hatte weinen gesehen.
Neben der verirrten Tochter wurden auch alle ihre Anhänger exekutiert, ja viele der reichsten Männer des Landes. Ptolemaios hatte sich in Rom ungeheuer verschuldet. Seine Gläubiger drängten immer dreister auf Rückzahlung. Und es war von jeher Brauch gewesen, das Vermögen von Verrätern oder solchen, die man dafür hielt, zugunsten der Staatskasse einzuziehen. Auch Ägyptens römische Freunde pflegten so zu verfahren. Doch er mochte sich noch so viel unter den Nagel reißen, allen Forderungen konnte er nicht genügen. Vor allem Rabirius Postumus wollte von einem Zahlungsaufschub nichts wissen.
In weiser Voraussicht war er als Privatmann im Gefolge des Gabinius an den Nil gekommen. Nach dessen Abzug übernahm er – ganz im Sinne der hinter ihm stehenden römischen Großmacht – die Wirtschafts- und Finanzverwaltung Ägyptens und begann, das Land systematisch auszuplündern. Ptolemaios blieb nichts übrig, als diesem Treiben, das von Pompeius selbst gedeckt war, ohnmächtig zuzusehen. Die Einkünfte aus den wichtigsten ägyptischen Exportgütern, Papyrus, Leinen und Glas, flossen nun in die Kassen der habgierigen Römer, die damit einen Fuß in das alte Reich gesetzt hatten. Kein Geringerer als der berühmte Redner Marcus Tullius Cicero rechtfertigte das Vorgehen. Schließlich, verkündete er, habe Ptolemaios selbst Rabirius die Verwaltung der Finanzen nahezu aufgedrängt, um sein, des Königs, Vermögen zu sichern. Denn er habe keine andere Möglichkeit gesehen.
Kleopatra, die auf ihr 16. Lebensjahr zuging, sah dies alles mit großer Sorge. Wie es aussah, würde sie dem geliebten Vater auf den Thron folgen. Arsinoë taugte nicht für ernsthafte Aufgaben und ihre Brüder Ptolemaios XIII. und Ptolemaios XIV. waren noch zu jung. Und der Thronwechsel würde nicht mehr lange auf sich warten lassen. Deutliche Zeichen kündigten Ptolemaios’ baldiges Ableben an. Er hatte seit seiner Rückkehr gewaltig an Gewicht zugelegt. Seine Beine trugen ihn kaum mehr und er rang mühevoll nach Atem. Die Aufregungen der letzten Jahre hatten ihm mehr zugesetzt, als er sich und anderen eingestehen wollte. Kleopatras Kummer war groß. Wie lange noch würde er bei ihr sein, der geliebte Vater? Und wie würde sich ihre eigene Zukunft entwickeln?