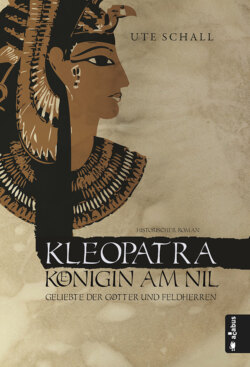Читать книгу Kleopatra. Königin am Nil - Geliebte der Götter und Feldherren - Ute Schall - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеErste Regierungsjahre
Nur wenige Jahre nach ihrer Rückkehr aus Memphis wurde die Königin, Ptolemaios’ große Liebe, krank. Die Ärzte waren ratlos. „Eine Krankheit der Seele, Herr, nicht des Körpers“, meinten sie, „gegen die jede ärztliche Kunst vergeblich ist. Möglicherweise geht der Zustand der Königin auf die Strapazen der Flucht und des jahrelangen Exils zurück.“ Ptolemaios wich seiner Frau nicht von der Seite. Er hatte Heiler aus dem ganzen Reich an den Hof geholt und jedem eine stattliche Belohnung versprochen, der der Königin ihre Gesundheit zurückgäbe. Er flößte ihr selbst kräftige Brühen und manchen Zaubertrank ein und ermahnte sie immer wieder mit liebevollen Worten, ihn nicht im Stich zu lassen. „Erinnerst du dich?“ Mit blumigen Worten breitete er die Vergangenheit vor ihr aus. Und er beschwor sie, des Versprechens zu gedenken, das sie sich einstmals im Haus ihres Vaters gegeben hatten, miteinander alt zu werden. Aber die Kranke lächelte nur und drückte müde seine Hand. „Ich bitte dich, nicht zu verzweifeln, mein Herr und König!“, hauchte sie ihn an. „Du weißt doch, gegen das Schicksal kämpfen selbst die Götter vergebens. Wir werden uns wiedersehen. Und nichts, mein Gemahl, wird uns dann je wieder trennen können.“ Und eines Morgens schlummerte sie, die Gesichtszüge entspannt, vor seinen Augen hinüber in jenes Reich, von dem es keine Wiederkehr gab.
Es hatte lange den Anschein, als verkrafte der König den herben Verlust nicht. Er versuchte zwar, vor seinen Kindern den Schmerz zu verbergen, um ihnen den Abschied von der geliebten Mutter nicht noch schwerer zu machen, aber vor allem Kleopatra ahnte, was in ihm vorging, und sah, dass auch er immer schwächer und ihm die große Verantwortung, die er für das Reich trug, allmählich zur Last wurde.
Ptolemaios fühlte selbst, dass seine Kräfte schwanden. Trotz aller Versprechen, die er den heimischen wie den griechischen Göttern gab, trotz aller Opfer, mit denen er sie gnädig zu stimmen hoffte, wurde ihm doch bald bewusst, dass seine Tage gezählt waren. Er wollte aber diese Welt nicht verlassen, ohne sein Haus bestellt zu haben. So verlieh er den vier Kindern den Titel „Neue geschwisterliche Götter“. Dann machte er Kleopatra zur Mitregentin.
Auch das Problem Rabirius Postumus schien vorerst wenigstens teilweise gelöst zu sein. Der habgierige Römer hatte sich mit seinen erpresserischen Verwaltungsmaßnahmen gewissermaßen selbst vertrieben. Der Widerstand in der alexandrinischen Bevölkerung gegen den unbeliebten Mann wuchs und steigerte sich bald zu grenzenlosem Hass. Nur mit knapper Not war es ihm gelungen, dem wütenden Mob zu entkommen, der ihm ans Leben wollte. Ausgerechnet bei Ptolemaios hatte er Schutz und Zuflucht gesucht. Dem König war der Aufstand gegen Rabirius nicht einmal unrecht, festigte die Unzufriedenheit mit dem Fremden doch nur seine eigene Herrschaft. Aus Sorge um Leib und Leben kehrte der Römer Ägypten umgehend den Rücken. Ptolemaios hoffte, die vermutlich letzten Jahre seines Lebens nun ohne die römische Vormundschaft einigermaßen sicher verbringen zu dürfen.
Andere Sorgen quälten ihn. Da war die Frage der Nachfolge, die nach einer Antwort schrie. Kleopatra, gewiss. Sie war klug und er hatte sie längst in die Regierungsgeschäfte eingeweiht. Er war davon überzeugt, dass sie das in sie gesetzte Vertrauen niemals enttäuschen würde. Aber sie war eine Frau. Die Vorbehalte gegen Berenike hatten erst vor einigen Jahren gezeigt, was die Ägypter von einer Frau auf dem Thron hielten. Er hatte zwei gesunde Söhne. Aber sie waren noch jung, zu jung, um Regierungsverantwortung zu übernehmen. Es blieb nichts anderes übrig, als auf einen alten Trick zurückzugreifen, den einige seiner ptolemäischen Vorgänger und vor diesen die ägyptischen Gottkönige bereits bemüht hatten: Kleopatra musste ihren älteren Bruder heiraten, den zehnjährigen Ptolemaios, und mit ihm gemeinsam die Herrschaft ausüben. Nach den Gesetzen Ägyptens war eine Geschwisterehe möglich, ja in den Zeiten der großen Pharaonen sogar üblich gewesen, um das königliche Blut rein zu halten. Aber was würden die Römer dazu sagen? Hatten sie doch ihre begehrlichen Blicke von Ägyptens Reichtümern noch keineswegs abgewandt. Und was hielt Kleopatra selbst von den väterlichen Plänen?
„Eine Heirat mit diesem Kindskopf? Vater, das ist nicht dein Ernst! Würde sie mich doch im ganzen Reich blamieren und meine Autorität untergraben“, wetterte sie, als Ptolemaios ihr seine Absicht vortrug. „Nein, Vater, da wirst du dir schon etwas anderes überlegen müssen. Lieber verzichte ich auf den Thron.“
„Nun ja, dein Bruder ist ein unmündiges Kind, das lieber mit seinen Schiffchen spielt als sich um seine große Schwester oder gar die Belange des Staates zu kümmern. Gerade deshalb wirst du allein herrschen, ich befürchte aber, unsere lieben Untertanen werden deine Herrschaft nur dulden, wenn dir ein Ptolemaios zur Seite steht. Und auch die Römer werden sich kaum mit der Regentschaft einer Kleopatra, einer so jungen zumal, abfinden. Ich habe ja in Rom selbst gegen die ‚Weiberwirtschaft‘ gekämpft, als deine Halbschwester auf dem Thron saß. Zwar darf ich mich nicht ohne Stolz, ich gebe es ja zu, Freund und Bundesgenosse des römischen Volkes nennen, aber wie die Römer mit uns trotz aller Freundschaftsbekundung umspringen, nun, das hast du ja selbst erfahren, als wir als Vertriebene auf römisches Wohlwollen angewiesen waren. Diesmal wirst du dich fügen müssen, um unsere Unabhängigkeit von Rom zu retten, mein liebes Kind, so leid es mir für dich tut. Ich sehe dem Ende meines Lebens entgegen. Die Götter haben es mir durch allerlei Vorzeichen angekündigt. Und einen anderen Nachfolger, der Ägypten in meinem Sinne weiterregieren könnte, habe ich nicht.“ Damit streichelte er seiner Tochter sanft über das pechschwarze Haar und verließ eilig die Gemächer der Prinzessin, ohne Kleopatras Widerrede abzuwarten.
Es kam jetzt nur noch darauf an, die Römer vor vollendete Tatsachen zu stellen. In einem Staatspapier legte Ptolemaios seinen letzten Willen fest. Ein Dokument wurde in Alexandria aufbewahrt, ein weiteres Exemplar nach Rom geschickt, wo sich sein Freund Pompeius höchstpersönlich der Urkunde annahm. Zufrieden blickte der König nun auf sein Leben zurück, das zuletzt doch noch eine so glückliche Wendung genommen hatte. Der Tod mochte kommen. Er war bereit.
Nur wenige Wochen später, im zeitigen Frühjahr, saß seine Tochter Kleopatra, die siebte Ptolemäerin dieses Namens, auf dem Thron; eine trotz ihrer Jugend – sie war gerade achtzehn Jahre alt geworden – selbstbewusste Frau. Zu ihren Füßen kauerte Ptolemaios, der ihr aufgezwungene Brudergemahl, der dreizehnte Namensträger, winzig, unscheinbar, in der einen Hand ein kleines Schiffchen, das er auf unsichtbarem Gewässer gleiten ließ, in der anderen einen aus Holz geschnitzten, bunt bemalten Seemann, der der Mannschaft seine Befehle gab. Kleopatra schämte sich für das Verhalten des kleinen Prinzen. Ob er vielleicht sogar schwachsinnig war? Sie beugte sich zu dem Kind hinunter und nahm ihm das Spielzeug weg, was mit einer lauten Äußerung des Unmuts quittiert wurde. „Das gehört sich nicht für einen ägyptischen König“, fuhr sie den Jungen an, womit sie sowohl das Spielen als auch seine Reaktion auf ihren Tadel meinte. „Du wirst dich jetzt gefälligst benehmen, wie es das Hofzeremoniell verlangt.“ Damit gab sie ihm einen leichten Klaps auf den Hinterkopf. Als sie wieder aufschaute, begegnete sie dem eisigen Blick des Eunuchen Potheinos, eines Menschen übelster Sorte, den noch ihr Vater dem jungen König zur Seite gestellt hatte. Er gehörte im Augenblick neben dem Feldherrn Achillas und dem Rhetoriklehrer Theodotos zu den einflussreichsten Männern des Reiches. Potheinos’ Verhältnis zu seinem Schützling war so eng, dass die Römer ausschließlich ihn für den Erzieher des Prinzen hielten. Er gab sich gern selbst als wichtigster Mann Ägyptens aus und tatsächlich hatte er die Zügel der Staatsverwaltung fest in der Hand. Kleopatra machte sich keine Illusionen. Sie würde es schwer haben, sich gegen diese eingeschworene Dreimännerherrschaft durchzusetzen. Aber sie war fest entschlossen, den Kampf aufzunehmen.
Nach Art der alten Gottkönige gekleidet, geschminkt und mit den Insignien der Macht – Bart, Krummstab und Geißel – angetan, die Krone Ober- und Unterägyptens auf dem stolz erhobenen Haupt, fuhr sie fort, nicht nur die Huldigung der Abgesandten der größten Städte ihres Landes, sondern auch die vieler benachbarter Völker entgegenzunehmen. Man würde einen Weg finden müssen, überlegte sie, sich des lästigen Brudergemahls und seiner verdammten Ratgeber für immer zu entledigen. War denn ihr Vater davor zurückgeschreckt, seine eigene Tochter zu töten, nachdem sie sich gegen ihn gestellt hatte? Die Geschichte ihrer Familie zeigte doch, dass es bei den Ptolemäern Tradition war, sich von machtgierigen Verwandten zu befreien, auch wenn es nur dem Staatswohl und den Interessen des Thrones diente. Doch hatte sie nicht einst ihrer längst verstorbenen Mutter versprochen …? Zählte überhaupt ein Versprechen, das man gleichsam unter Zwang als Kind gegeben hatte? Nichts würde sie unterlassen, um die Herrschaft ganz an sich zu reißen, und es gab bereits genügend einflussreiche Leute in ihrer Umgebung, die das begriffen hatten.
Nur wenige Monde waren nach Ptolemaios’ Tod vergangen, da setzte ihr der Priester Onnophris, der für den Isiskult verantwortlich war, eine Stele, die ausschließlich ihren Namen trug. Von ihrem Brudergemahl war darauf nicht die Rede. Auch auf Verträgen und Münzen sollte künftig Ptolemaios’ XIII. Namen allenfalls nach dem der Königin stehen. Das würde helfen, ihren Bruder mit der Zeit im Bewusstsein des Volkes auszulöschen. „Thea Philopator“, nannte sie sich jetzt gelegentlich, die vaterliebende Göttin. Noch war sie nicht sicher, ob sie diesen Titel auch offiziell führen sollte. Es musste vorsichtig zu Werke gegangen werden und sie musste erkunden, wie weit sie in ihrem Streben, den Bruder auszuschalten, überhaupt gehen konnte.
Gelegenheit, ihre Lage bis auf den Grund zu erforschen, hatte sie indes vorerst nicht. Die Finanzen des Staates befanden sich in einem desolaten Zustand, die politische Abhängigkeit Ägyptens von Rom verletzte den Stolz ihrer Untertanen. Eine Lösung dieser Probleme sah Kleopatra nicht. Zudem spielte sich vor allem der unangenehme Eunuch Potheinos immer öfter als der wahre Herr des Reiches am Nil auf. Sie wusste, wie gefährlich er war, und sie wusste auch, dass es ihr bei diesem Feind nie gelingen würde, ihn für sich einzunehmen. Manchen anderen, der sich ihr in den Weg gestellt hatte, hatte sie rasch von ihren weiblichen Qualitäten überzeugt. Eine Nacht in den Armen der jungen Königin und die Hoffnung, bald an der Macht teilhaben zu dürfen, trieben ihr viele Gegner zu und sie verstand es, sich die Bewunderung ihrer Liebhaber zu erhalten. Sie mochte nicht besonders schön sein, diese Königin vom Nil, aber sie war heißblütig und leidenschaftlich und wer einmal ihren Verführungskünsten erlegen war, blieb ihr für immer verfallen. Sie verstrickte ihre Opfer in Netze, hieß es, die einer Circe alle Ehre gemacht hätten. Die Kunde von ihrem lebhaften Unterleib drang bis nach Rom, wo man teils über die Methoden Kleopatras schmunzelte, teils sie als unmoralisch und damit verwerflich anprangerte. Bald erzählte man sich in der Hauptstadt der Welt, sie hielte jeden, der sich ihr nicht bedingungslos verschrieben hätte, für einen gefährlichen Gegner. Als Eunuch hatte Potheinos freilich keine Möglichkeit, in den inneren Kreis der Günstlinge Kleopatras aufgenommen zu werden. Er galt der Königin deshalb als besonders gefährlich.
Der Beginn der Überschwemmung des Nils stand bevor und damit der Anbruch eines neuen Jahres, das die Ägypter seit Menschengedenken stets mit großer Freude und Dankbarkeit begrüßten. Brachte die Nilschwelle doch den fruchtbaren Schlamm auf die Felder, und je mehr sich davon in dem schmalen Uferstreifen ablagerte, desto ergiebiger versprach die Ernte auszufallen. Nach dem Vorbild aller ptolemäischen Könige opferte Kleopatra gemeinsam mit ihrem Volk. Oft genug hatte sie ihrem Vater bei den heiligen Handlungen beigestanden, die für die unbewusste Beleidigung der Götter um Verzeihung baten und den Segen des Himmels für die Früchte der Erde erflehten. Doch diesmal erwiesen sich die Götter Ägyptens als nicht so gnädig. Voller Ungeduld erwartete Kleopatra die Boten, die ihr den Beginn des für ihr Land so lebenswichtigen Ereignisses melden sollten: das Anschwellen der braunen, zähflüssigen Fluten, die träge aus dem angestammten Flussbett krochen und sich wochenlang über die staubtrockenen Felder ergossen, die ausgedörrte Erde tränkten und sich langsam wieder zurückzogen. Niemand vermochte zu sagen, woher dieser Segen spendende Fluss kam und welche Macht ihn alljährlich anschwellen, verharren und wieder abnehmen ließ. Ein jeder war fest davon überzeugt, dass es sich um ein Geschenk der Götter handelte, die ihr Geheimnis bewahren wollten. Stand nicht der Nil stellvertretend für den wunderbaren Kreislauf des Lebens, für das immerwährende Werden, Wachsen und Vergehen, war er nicht Sinnbild der Ewigkeit?
„Du erzählst mir nichts Neues, mein Freund. Die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern.“ Apollodoros berichtete, dass die Unzufriedenheit mit ihr in der Stadt wuchs. Aus den tiefen Sorgenfalten von Apollodoros’ Stirn tropfte unablässig der Schweiß. Nach dem Tod ihres Vaters war der verdiente Lehrer Kleopatras innigster Ratgeber geworden, ja er hatte geradezu die Rolle des Vaters bei seiner einstigen Schülerin eingenommen. Er blickte allerdings auf eine stattliche Reihe von Jahren zurück und die junge, noch unerfahrene Königin mochte nicht daran denken, dass er ihr womöglich nicht mehr lange zur Verfügung stünde. Sie liebte diesen gebeugten, grauhaarigen Mann, der einen Großteil seines Lebens in ihrer Nähe verbracht hatte und vielleicht gerade deshalb in ihr nicht das Weib sah, die Verführung schlechthin, sondern die Tochter, die ein ungnädiger Himmel ihm selbst versagt hatte.
„Es ist furchtbar heiß heute, findest du nicht?“ Der Alte wischte sich den Schweiß von der Stirn. „Gestattest du, dass ich mich setze?“, keuchte er. Kleopatra zog ihn auf einen Stuhl. „Du hast recht, Apollodoros“, fuhr sie fort, „ich erinnere mich kaum an eine ähnliche Hitze.“ Und nach einer Weile des Schweigens begann sie: „Die Nilschwelle ist diesmal sehr dürftig ausgefallen, um nicht zu sagen, ganz ausgeblieben. Das wolltest du mir doch sagen, nicht wahr? Meine Ägypter werden im nächsten Winter vermutlich hungern müssen. Und sie machen mich dafür verantwortlich, mich, ihre Königin. Als stünde es in meiner Macht, einem Fluss zu befehlen, über die Ufer zu treten oder es nicht zu tun. Nicht das Schicksal oder die Götter seien schuld daran, sagen sie in der Stadt, sondern ich, die die Natur beleidigt, ja verhext habe. Schon gäbe es Stimmen, die meinen Tod fordern …“ Kleopatra wandte dem Alten den Rücken zu und ging langsam zum Fenster. Er sollte ihre Tränen nicht sehen. Im Palastgarten deutete nichts auf die schlechte Stimmung in Alexandria hin. Die herrliche Anlage atmete Frieden. Die hohen Palmen warfen mit ihren mächtigen Fächerkronen dunkle Schatten. Rosen und Jasmin dufteten. Nur das plätschernde Wasser unterbrach die friedliche Stille. Eine Weile schwieg Kleopatra, ganz in die Idylle versunken. Dann nahm sie den Faden wieder auf. „Sie wollen Ptolemaios als ihren alleinigen König. Ausgerechnet meinen kleinen Bruder, der sich übrigens auf seine neue Rolle schon vorbereiten soll. Das jedenfalls verbreitet dieser schmierige Eunuch. Natürlich unterlässt dieser Widerling auch nichts, den Jungen gegen mich aufzuhetzen. Ich schwöre dir, Apollodoros“, drehte sie sich plötzlich um, als wäre ihr alter Kampfgeist wieder erwacht, „wenn ich je als Königin ohne meinen Bruder herrschen werde – und ich vertraue fest darauf, dass mir das eines vielleicht gar nicht mehr so fernen Tages gelingen wird –, dann werde ich mich furchtbar rächen. Es wird ein Blutgericht über Alexandria hereinbrechen, von dem noch unsere Kinder und Kindeskinder mit Schaudern erzählen werden.“ In ihrem Zorn merkte Kleopatra nicht, wie sehr der Alte bei dieser Drohung erschrak. War das vielleicht das zahme Täubchen, das ihm vor noch gar nicht langer Zeit aus der Hand gefressen hatte? Oder hatte sein Schützling nur einen schlechten Tag? Er antwortete der Königin nicht, sondern beugte demütig das ergraute Haupt und bat, sich für heute entfernen zu dürfen.
Ohne besondere Aufforderung war Potheinos in das Gemach des kleinen Königs getreten, wo er eine lasche Verbeugung andeutete. „Unser Plan scheint aufzugehen, Majestät“, wandte er sich an das Kind, ohne zum Sprechen aufgefordert worden zu sein. Ptolemaios sah nicht einmal auf. Er war beschäftigt. Auf einem großen Brett hatte er mit seinen Spielzeugschiffchen zwei Flotten aufgebaut, Griechen und Perser, wie er seinen Erzieher belehrte, rot die einen, schwarz die anderen. Er hatte gerade im Geschichtsunterricht von der Seeschlacht von Salamis gehört und davon, dass es den Griechen gelungen war, die weit überlegene persische Flotte zu vernichten. „Ich bin stolz darauf, griechischer Abstammung zu sein“, warf sich der Knabe in die Brust. „Es waren doch meine Vorfahren, die Griechenland und die abendländische Welt gerettet haben, sag, Potheinos, habe ich recht?“ „Sehr wohl, Majestät“, antwortete der Vormund kühl. Es war nicht zu übersehen, dass er sich über Ptolemaios ärgerte. Hatte man je einen König gesehen, und war er auch noch so jung, der sich nahezu ausschließlich für seine Spielsachen interessierte? Vater Ptolemaios hätte zweifellos eine strengere Hand haben müssen, schoss es dem Eunuchen durch den Kopf. Aber er, Potheinos, der am Hof von so vielen verachtet wurde, würde schon noch dafür sorgen, dass sich der kleine König daran erinnerte, was seine Aufgabe war. Inzwischen musste eben er selbst nach dem Rechten sehen.
„Es kommt unseren Wünschen sehr entgegen“, fuhr er, scheinbar unbeeindruckt von der mangelnden Reaktion des Kindes, fort, „dass sich sogar die Natur mit uns verbündet hat. Gegen die Schwestergemahlin, gegen Kleopatra. Da der Nil nicht so über die Ufer getreten ist, wie das eine ertragreiche Landwirtschaft erfordert, wird im ganzen Reich das Korn knapp“, stellte er nicht ohne eine gewisse Befriedigung fest. „Wir haben uns erlaubt, dein Ein-Verständnis unterstellend, Herr, einen Erlass herauszubringen, dass alles verfügbare Getreide in der Hauptstadt abzuliefern ist. Auch die für die Ernährung unseres Volkes so wichtigen und gesunden Hülsenfrüchte dürfen nicht mehr nach Ober- oder Unterägypten gebracht werden. Alexandria hungert und nichts ist für unser Vorhaben ungünstiger als die Unzufriedenheit des Mobs in der Hauptstadt, wo Unruhen immer zuerst ausbrechen. Und wohin ein Aufstand vor unserer Haustüre führen kann, das haben wir ja in den letzten zehn Jahren immer wieder gesehen. Ich habe übrigens veranlasst, dass jedem, der gegen diese Anordnung verstößt, die Todessstrafe droht. Und ich werde nicht zögern, von ihr Gebrauch zu machen, wenn es die Lage erfordert.“
„Noch etwas? Hast du mir noch etwas zu sagen?“, unterbrach ihn der kleine König, ohne allerdings von seinem Schiffchen-Versenken-Spiel abzulassen. Die beiden feindlichen Flottenverbände hielten inzwischen scharf aufeinander zu. Auf dem imaginären See stand die Entscheidungsschlacht unmittelbar bevor.
„Mit Verlaub, Herr, ich habe den Namen deiner Schwestergemahlin in dem Erlass erst nach dem deinigen genannt. So wird es das Volk von Alexandria dir zugute halten, wenn die ersten Nahrungslieferungen eintreffen. Du allein wirst der große Held sein. Kleopatra ist derzeit ohnehin bei den Alexandrinern nicht sonderlich beliebt. Man schiebt ihr die Schuld an den Launen der Natur zu und einige fordern bereits ihren Tod. Aber soweit ist es noch nicht. Du musst noch ein wenig Geduld haben, Herr! Ich verspreche dir, nichts zu unterlassen …“
„Siehst du, Potheinos!“, unterbrach ihn Ptolemaios überglücklich, „die kleinen roten Schiffe, die der Griechen, sind viel wendiger als die Ungetüme, die die Perser ins Rennen geschickt haben und die sich in dem inselreichen, engen Gewässer nur selbst im Weg stehen. Nur noch wenige Stunden, Potheinos, und wir werden über unsere Feinde einen fulminanten Sieg davontragen. Und ich, Ptolemaios, der dreizehnte Träger dieses Namens, werde auf dem Deck stehen und stolz die Siegesfahne schwingen.“ Der düstere Eunuch deutete eine flüchtige Verbeugung an und entfernte sich eilig und kopfschüttelnd aus den königlichen Gemächern.
Die politischen Ereignisse in Rom erschütterten derweil die Welt und die Wellen der hohen Politik sollten auch bald das alte Land am Nil erreichen. Im Jahr 700 a.u.c. war dort das Triumvirat, die gemeinsame Herrschaft der drei mächtigsten Männer des Abendlandes, durch Crassus’ Tod zerbrochen. Auf entwürdigende, ja unehrenhafte Weise war Crassus ums Leben gekommen. Nie zuvor war einem Römer, einem der bedeutendsten zumal, derartige Schmach widerfahren. Anders als seine beiden Kollegen hatte sich dieser Crassus noch keinen militärischen Ruhm errungen, sondern seinen Reichtum überwiegend aus dem Handel mit Sklaven geschöpft. Um diesem Mangel abzuhelfen, hatte er beschlossen, den Kampf gegen die Parther, die Erzfeinde Roms, zu wagen. Bei Carrhai in Mesopotamien hatte sich ihm ein gewaltiges Reiterheer des Feindes entgegengestellt. Unerfahren, wie er auf dem Schlachtfeld und in der Einschätzung der heimtückischen Parther war, wurde er vernichtend geschlagen und zu Friedensverhandlungen in einen gemeinen Hinterhalt gelockt. Zeitlebens hatte er wie kein anderer nach Gold gegiert. Jetzt sollte es ihm zum Verhängnis werden. Verflüssigt goss man es ihm in die Kehle. Dann schlug man ihm den Kopf ab. Die blutige Trophäe wurde bei einem Festgelage am Hofe des fremden Königs als Spielball von Gast zu Gast gereicht und verhöhnt, ehe sie im Kuriositätenkabinett der Parther verschwand.
Crassus war es gewesen, der in dem gespannten Kräfteverhältnis der beiden anderen Kollegen immer wieder den versöhnlichen Ausgleich gesucht hatte. Einst hatte der Julier, Caesar, dem großen Pompeius sogar seine Tochter Julia, sein einziges legitimes Kind, zur Frau gegeben, um ihre Beziehung zueinander zu festigen. Aber Julia starb und ihr tragischer Tod löste das letzte Band, das zwischen Caesar und Pompeius bestand, nachdem ihre Freundschaft schon lange zerbrochen war. Der Streit der beiden bedeutenden Männer eskalierte, als sich sein Gegner, was Caesar schon lange befürchtet hatte, der Senatspartei anschloss. Als er im Jahr 701 a.u.c. auch noch mit dem Konsulat (sine collega) ausgestattet wurde, schien Pompeius am Ziel seiner Wünsche angelangt zu sein. Eine Reihe von ihm initiierter, durchaus vernünftiger Gesetze stellte die Ordnung in der Hauptstadt wieder her, war aber auch, für politisch Interessierte leicht durchschaubar, gegen Caesar und dessen Pläne für die eigene Zukunft gerichtet. Hatte der nicht erst kürzlich öffentlich verkündet, er wolle lieber in jedem Dorf der Erste als in Rom nur der Zweite sein? Eine Äußerung, die viele Stadtväter durchaus ernst nahmen und sogar als Drohung betrachteten. Was war dem fast krankhaft ehrgeizigen Julier nicht alles zuzutrauen! Tatsächlich ließ sein erster Schritt auch nicht lange auf sich warten.
Caesars Statthalterschaft in Gallien neigte sich ihrem Ende zu und er beschloss, sich für das Jahr 705 a.u.c. um das Konsulat zu bewerben. Doch war es ihm unmöglich, als Privatmann nach Rom zurückzukehren. Nicht immer hatte er in Gallien im Einklang mit der ungeschriebenen römischen Verfassung gehandelt. Als hoch verschuldeter Mann war er einst in den Norden gezogen, als einer der reichsten Männer des Imperiums würde er in Kürze seine Statthalterschaft beenden. Gewiss warteten in Rom, wo er nicht nur Freunde hatte, schon manche darauf, ihm den Prozess zu machen. So stellte er den Antrag, sich entgegen den Gepflogenheiten als Abwesender um das Amt des Konsuls bewerben zu dürfen. Aber der heimische Senat lehnte das Ansinnen entrüstet ab. Er möge doch, so ließen ihn die eingeschriebenen Väter wissen, sein Heer entlassen und zur persönlichen Kandidatur in Rom erscheinen. Nach langer Hinhaltetaktik teilte Caesar dem Senat mit, er werde die von ihm eroberten Provinzen abgeben und seine Soldaten entlassen, wenn Pompeius das gleiche tue.
Dieses Angebot löste in Rom derartige Empörung aus, dass Pompeius noch weitere Vollmachten erhielt. Da gab Caesar an seine Truppen den Marschbefehl. Er wusste um die Tragweite dieses Entschlusses und auch, dass es jetzt kein Zurück mehr gab. An der Grenze zwischen der Gallia Cisalpina und dem Mutterland Italien überschritt er den Rubikon. „Alea iacta est!“, verkündete er seinen Männern. Der Bürgerkrieg war eröffnet. Angst und Schrecken lähmten die Hauptstadt, als der verwegene Feldherr mit nur einer Legion auf Rom zuhielt. Der größere Teil der ihm unterstehenden Streitkräfte verharrte in Gallien in Wartestellung.