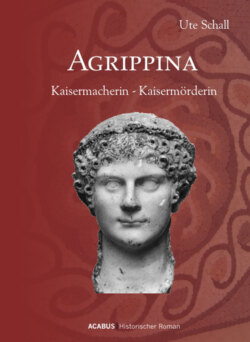Читать книгу Agrippina. Kaisermacherin - Kaisermörderin - Ute Schall - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der mysteriöse Tod
ОглавлениеBald nach Pisos Abreise forderten neue Aufgaben den offiziellen Vertreter der römischen Staatsmacht im Norden des Ostreichs heraus. Die Bewohner von Bithynien und Pontus, die die römische Zivilisation zwar kennen gelernt hatten, aber von ihr noch immer nicht restlos überzeugt waren, hatten eine Feuerwehrgruppe gegründet, und der Präfekt hatte bei Germanicus angefragt, ob das mit den römischen Gesetzen zu vereinbaren sei. Es war allgemein bekannt – und hatte sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt –, dass in der rauen Bergregion südlich des Schwarzen Meeres jede noch so kleine Vereinigung ein potentieller Unruheherd war. Es gab immer wieder Unzufriedene, die sich bei jeder Gelegenheit zusammenrafften und den mühsam errungenen Frieden nachhaltig störten.
Mit den Orientalen war in dieser Hinsicht ohnehin nicht zu spaßen. Anders als die eher nüchternen Bewohner der westlichen Reichshälfte sprühten sie geradezu vor Temperament und Leidenschaft und liefen jedem Volksverhetzer nach, wenn er ihnen nur das Blaue vom Himmel versprach. Dabei verhielt sich die römische Staatsmacht gerade ihnen gegenüber äußerst tolerant. Sie durften nicht nur ihre eigenen Sitten und Gebräuche weiterhin pflegen, sondern auch zu ihren heimischen Göttern beten, die Rom sogar bereitwillig in den eigenen Götterhimmel aufnahm. Bedingung für diese Großzügigkeit war nur, dass sie die römische Oberhoheit anerkannten, römische Gesetze achteten und die ihnen auferlegten Abgaben pünktlich entrichteten.
Nur widerwillig hatte Agrippina ihren Gatten ziehen lassen, der Abschied von ihm fiel ihr von Mal zu Mal schwerer. Schreckliche Träume und dunkle Vorahnungen hatten sie geplagt. Sie hatte dem Zug mit den hoch beladenen Maultieren und den ratternden Pack-und Reisewagen von einer Anhöhe aus lange nachgesehen, bis Germanicus’ in der Sonne glitzernde Helmspitze am fernen Horizont verschwand. Dann war sie weinend zu Boden gefallen und hatte mit Kopf und Fäusten laut klagend auf die ausgetrocknete Erde geschlagen. Sie war erschöpft, ausgelaugt, fühlte sich alt, obwohl ihr das Spiegelbild noch immer ein strahlendes, von den Spuren der Zeit verschont gebliebenes Gesicht vorgaukelte.
„Lug und Trug“, schluchzte sie. „Die Welt besteht nur noch daraus. Sie ist von Grund auf schlecht. Und deshalb wird sie untergehen. Sie hat es nicht anders verdient.“
Die Tage ohne ihren Mann wurden ihr lang. Sehnsüchtig erwartete sie die Postreiter, die ihr wöchentlich Grüße und kleine Geschenke des Geliebten brachten. Der Mond hatte schon einige Male gewechselt, als Germanicus endlich wieder vor ihr stand. Aber er war nicht mehr der Mann, der sie vor einiger Zeit verlassen hatte. Er wirkte müde und grau, als zehre an ihm ein unheimliches Gift. Und doch sollte er sich wenig später noch einmal erholen …
Der Aufenthalt auf Rhodos neigte sich zu Ende. Germanicus hatte beschlossen, mit seiner Familie entlang der Küste Kleinasiens zu segeln, noch einmal die alten, zum Teil zerstörten Griechenstädte zu besuchen und schließlich nach Ägypten zu reisen, von dem er Agrippina soviel erzählt, das sie aber selbst noch nicht kennen gelernt hatte. Es war, als wollte er von all den schönen Orten, die er kannte, Abschied nehmen.
Während der anstrengenden Reise durch die asische Provinz blieben Treffen mit Piso nicht aus. Dabei kam es Germanicus vor, als sei der syrische Statthalter noch mürrischer, noch unfreundlicher geworden. In seiner düsteren Art erinnerte er sogar an Tiberius, den finsteren Claudier, wie seine Römer ihn ein wenig verächtlich nannten, und Germanicus war bald davon überzeugt, dass sich jener keinen besseren Repräsentanten seiner selbst hätte aussuchen können. Nur die versöhnliche Art des Prinzen verhinderte Streit und das endgültige Zerwürfnis mit dem fremden, unheimlichen Mann.
Zweifellos wusste der junge Prinz, dass er nahezu göttliches Recht übertrat, als er sich nach Ägypten einschiffte. Wohl absichtlich provozierte er den römischen Staatsführer in der Annahme, dass ihm nichts geschehen werde, da dieser doch gleichen Blutes war. Kaum kann Germanicus einfältig genug gewesen sein zu glauben, kaiserliche Verordnungen gälten für Mitglieder des Herrscherhauses nicht.
Als Augustus (der sich damals noch Octavian nannte) auf dem Boden des alten Reiches am Nil seinen Rivalen Marcus Antonius vernichtend geschlagen hatte, machte er das Land zur kaiserlichen Provinz. Seit jeher hatte Ägypten als Tor zum Osten gegolten und bei seinen Herrschern Begehrlichkeiten geweckt, die zwangsläufig gegen römische Interessen verstießen. Jeder Römer von Stand war vom Gedanken der Herrschaft über ein eigenständiges Ostreich fasziniert. Zuletzt hatte sich Marc Anton als König vom Nil aufgespielt, unterstützt von Cleopatra, seiner Gemahlin, zu der er ein nicht nur erotisches Verhältnis unterhalten hatte. Hatten nicht beide ganz offen davon geträumt, Octavian auszuschalten, gemeinsam den Osten zu beherrschen und dann langsam ihre Hände nach Westen auszustrecken, nach der geheiligten Roma selbst, wo Cleopatra „bald auf dem Capitol zu Gericht sitzen“ wollte, wie sie angeblich immer beteuerte? Das Schicksal hatte es anders bestimmt; Apoll, der Gott des klaren Verstandes, war seinem Schützling Octavian zu Hilfe geeilt, und die Möchtegern-Herrscher von Alexandria hatten ihre Kühnheit mit dem Verlust nicht nur der Macht, sondern auch ihres Lebens bezahlt. Seitdem war es jedem Römer senatorischen Standes bei Todesstrafe verboten, den Boden des geschichtsträchtigen Landes ohne Sondergenehmigung des Princeps zu betreten.
Mag sein, dass Germanicus’ absichtlicher oder unbewusster Verstoß gegen die kaiserliche Verordnung jene Katastrophe einleitete, die schließlich zur Auslöschung seiner ganzen Familie, ja des gesamten julisch-claudischen Geschlechts führen sollte.
Ägypten selbst galt als die geheimnisvollste Region des Reiches. Noch vor Menschengedenken und lange, bevor Aeneas das brennende Troja verlassen hatte, hatte dort eine Hochkultur geblüht, deren Zeugnisse selbst Rom in Erstaunen versetzten. Da ragten westlich des gewaltigen Stromes, gegen den sich der Tiber wie ein erbärmliches Rinnsal ausnahm, Steinburgen in den Himmel, Grabstätten für Gottkönige, wie man sie sonst nirgendwo sah und wie sie auch die geschicktesten römischen Baumeister nicht hätten errichten können. Da erhoben sich im Reich der Lebenden und in dem der Toten gewaltige Tempel zu Ehren der Götter, und noch immer sangen Priester dunkle Lieder, deren Sinn freilich niemand mehr verstand. Da verfielen an den Ufern des Leben spendenden Flusses herrliche Paläste, die noch im Untergang ihre einstige Pracht ahnen ließen. Ägypten. Wer brachte dieses Land nicht mit dem Urwissen der Menschheit in Verbindung, mit Philosophie und Religion, dem Kampf gegen Krankheit und der Auferstehung der Toten? Hatte nicht vor Caesars Einfall in Alexandria die größte Bibliothek der Welt gestanden, die das gesammelte Wissen aller Zeitalter barg? Die ruhmreiche Hauptstadt des Landes, das vom makedonischen Heroen Alexander gegründete Alexandria, hatte sich in wenigen Jahrhunderten zu einem Zentrum der Gelehrsamkeit entwickelt, das gleichberechtigt neben Athen stand und die geheiligte Roma weit überragte.
Doch auch Ägyptens Natur war verlockend. Alljährlich trat der Nil pünktlich über die Ufer, tränkte das Land und lagerte fruchtbaren Schlamm ab, sodass es prächtig blühte und gedieh.
In den Sümpfen des Deltas wuchs die begehrte Papyrusstaude, wie sie auf italischem Boden nur auf Sizilien zu finden war. Die Ägypter verstanden es, durch geschickte Verarbeitung aus den Stengeln Papier herzustellen, das wegen seines im Vergleich zum Pergament geringen Preises auch in Rom zum Beschreiben äußerst beliebt war. Und besonders wichtig war dieses Land für seine Getreidelieferungen an die Hauptstadt, ohne die diese den bei der Staatsführung so gefürchteten Hungersnöten ausgesetzt war.
Germanicus selbst befand sich auf der Höhe seiner Beliebtheit und seines Ruhmes. Sein Ruf eilte ihm voran, und wo immer er das Schiff verließ und an Land ging, strömten Neugierige herbei, hießen ihn willkommen und erwiesen ihm alle erdenkliche Ehre.
Es hatte sich längst herumgesprochen: In Ägypten herrschte Hungersnot, und der hohe Gast hatte angeordnet, die staatlichen Getreidespeicher zu öffnen. Niemand zweifelte ernsthaft daran, dass diese Maßnahme kaum im Sinne der römischen Staatsführung sein konnte, denn das Getreide Ägyptens sollte schließlich die Hauptstadt vor Mangel bewahren, und jedermann fragte sich, woher der Feldherr den Mut nahm, sich über die Anordnungen seiner Regierung so leichtfertig hinwegzusetzen. In der Tat stieg der Brotpreis in Rom und in Italien sprunghaft an, und Tiberius hatte Mühe, zu Hause das Volk zu beruhigen.
Nie zuvor war Agrippina stolzer auf ihren Mann gewesen, hatten seine Kinder mit mehr Bewunderung an ihm empor geschaut, ihrem Vater, der, fern aller offiziellen Pflichten, ein ganz anderer war.
Germanicus hatte sich nach Landesart gekleidet. Sein Oberkörper, von der gleißenden Sonne gebräunt, war fast nackt und mit glänzendem Öl eingerieben. Um den Hals trug er einen mit Edelsteinen besetzten, goldbestickten Kragen. Seine Lenden umschlang ein weißes schalartiges Tuch, das bis zu den Füßen hinabfloss. Diese, ebenfalls nackt, steckten in zierlichen Sandalen, die die Zehen frei ließen. Besonders die kleine Agrippina hing an ihrem Vater und wurde nicht müde, ihn ihrer besonderen Zuneigung zu versichern. Selten hatte sich Germanicus für seine Kinder mehr Zeit genommen, ihnen interessantere Geschichten erzählt und auf ihre Fragen mit größerer Zuwendung reagiert. Die Familie genoss diese Reise, die ihr als willkommene Abwechslung erschien. Und doch lag auf allem die Ahnung eines großen Unglücks, das ihrer aller Leben mit einem Schlag verändern würde.
„Vater!“ Die kleine Agrippina zog Germanicus am Arm. „Sieh doch, diese Statue sieht aus wie die, die das Atrium unseres Hauses in Rom schmückt!“
„Es ist die Göttin Isis, mein Kind, die Lieblingsheilige der Ägypter.“ Germanicus nahm seine Tochter an der Hand.
„Und was sucht sie dann bei uns in Rom?“, wollte das Mädchen wissen.
„Dumme Göre!“, mischte sich Gaius in der altklugen Art, die ihm eigen war, ein. „Das weiß doch am Tiber jedes Kind. Wir Römer nehmen alle fremden Götter bei uns auf, solange sie sich nicht in die Politik mischen. Die Soldaten erzählen, dass es bei uns bereits viele Menschen gibt, die Isis als ihre Schutzheilige anrufen und Gottesdienste für sie abhalten.“
„Dein Bruder hat Recht, Agrippina“, stimmte Germanicus den Ausführungen seines Sohnes zu. „Isis gilt als besonders freundliche Göttin, die sogar Tote zum Leben erweckt. Man sagt, sie habe einst ihren Gemahl Osiris, der von seinem eifersüchtigen Bruder Seth getötet und zerstückelt worden war, nach mühsamer Suche wieder zusammengesetzt und ihm neues Leben eingehaucht.“
„Aber Vater. Gaius’ Erzieher lehrte uns, die Toten seien tot und lebten nur noch als Schatten in der Unterwelt fort, und niemand könne sie je wieder lebendig machen. Aber wir dürften sie nie vergessen, sagt er, wir müssten sie in unserem Herzen bewahren, dann hätten sie in der anderen Welt ein erträgliches Los.“
„Gewiss, mein Kind.“ Germanicus gab seiner kleinen Tochter Recht. „Das ist der Glaube der Römer. Die Ägypter sind aber davon überzeugt, dass es ein Weiterleben gibt, auch wenn sie gestorben sind. Natürlich nicht für alle. Die Toten müssen für dieses andere Leben gut vorbereitet werden, nach ganz strengen Regeln. Das kostet Zeit und viel, viel Geld, sodass nur die weiterleben werden, die es sich leisten können.“ Mit seinen freundlichen Augen sah er das Mädchen an.
„Können wir es uns leisten, Vater?“, wollte die Kleine wissen.
„Wir sind Römer, Agrippina. Und wir werden sterben und in die Unterwelt gehen, wie es uns unsere Vorfahren gelehrt haben. Charon, der Fährmann, wird uns über den Styx begleiten, den Fluss, der die Lebenden vom Totenreich trennt. Das kostet nur eine kleine Münze, die wir unseren Verstorbenen in den Mund legen und die man uns in den Mund legen wird, wenn es soweit ist. Dann können wir nur hoffen, dass hier auf Erden weiterhin jemand an uns denkt, damit wir nicht ganz ausgelöscht werden.“
„Ich werde dich nie vergessen, Vater, damit du es in der Unterwelt gut hast.“ Dem Kind zuckte es schmerzlich um den Mund. „Ich habe dich nämlich sehr lieb. Und eines Tages werde ich zu dir kommen, und dann wirst du nie mehr allein sein.“ Dabei drückte sie fest die Hand, an die sie sich geklammert hatte, und als sie zu ihrem Vater aufblickte, standen in seinen Augen dicke Tränen. Da war ihr, als blicke sie der schakalköpfige Anubis an, von dem man ihr erzählt hatte, er hüte am Nil das Totenreich, und sie fürchtete sich sehr.
Auch Agrippina Maior genoss die scheinbar unbeschwerten Stunden, die sie zeitweise sogar die Schrecken der Zukunft vergessen ließen. Endlich gehörte der Gatte nur ihr und den Kindern, und Rom war weit weg. Wie schön waren die fruchtbaren Felder entlang des Stromes, der träge und gleichmäßig dahinfloss, die Ibisse, die auf den satten Wiesen nach Nahrung suchten, und die schwarzen Wasserbüffel, die träge am Ufer den Tag verdösten. Wie herrlich waren die Sonnenuntergänge, das glühende Abendrot hinter Pyramiden und Palmen, das Feuer auf den Tempeldächern, das alles in ein unwirkliches Licht tauchte! Gelb und Rot und schließlich das nächtliche Schwarz, das alles auflöste und in sich aufnahm. Nur auf Attika in Griechenland hatte sie vergleichbare Naturschauspiele gesehen. Und dann die Wüste! Man musste sie gesehen haben, um sich vorstellen zu können, was Wüste bedeutet. Hitze und Kälte, Leben und Tod und das unendliche Schweigen.
Bei aller Bewunderung für die Einzigartigkeit des Landes vergaß sie Vorsichtsmaßnahmen nie. Sie hatte angeordnet, dass Germanicus stets von einer Schar besonders zuverlässiger Sklaven umringt war, den kräftigsten, die sie hatte auftreiben können, auch wenn er sich über soviel Fürsorge gern lustig machte. Selbst nachts standen sie schwer bewaffnet vor seiner Kabinentür und verwehrten jedem, auch dem Schiffsführer, den Einlass. Sie hatte Anweisung gegeben, dass alle Speisen und Getränke, die man ihrem Mann reichte, zuvor von Sklaven gekostet wurden, und es war tatsächlich schon vorgekommen, dass der eine oder andere nach der Verkostung tot umgefallen, in den Nil geworfen und von den hungrigen Krokodilen zerrissen worden war.
„Die Sonne“, erklärte Germanicus seinen Kindern. „In Griechenland und bei uns in Rom wird sie von Helios in einem vierspännigen Wagen über den Himmel gezogen. Er ist Gott und die Sonne selbst, zudem ein Meister seines Fachs. Helios hatte einen Sohn, Phaeton. Der sich nach Art der Söhne nach nichts anderem sehnte, als es seinem Vater gleichzutun. Und nach Art der Väter verwehrte dieser dem Jungen den Wunsch, denn er liebte Phaeton sehr und wollte nicht, dass ihm etwas zustieße. Es gehörte nämlich große Erfahrung dazu, den Wagen mit den wilden Rössern in seiner Bahn zu halten, und das geringste Abweichen hätte nicht nur den Lenker das Leben gekostet, sondern auch die Welt unwiederbringlich verbrannt und zerstört.
Mit einem Trick brachte sich der leichtfertige Junge schließlich in den Besitz des Gefährts, allen väterlichen Warnungen zum Trotz. Helios sah ihm sorgenvoll nach, konnte aber nicht mehr eingreifen. Zu weit war sein Sohn bereits davongeflogen. Und es blieb dem erschrockenen Vater nichts als zu beten und zu weinen und die anderen Götter anzuflehen, das große Unglück zu verhindern.
Zunächst schien das Schicksal dem leidgeprüften Helios gnädig. Phaeton war geschickt, manövrierte den Wagen durch mancherlei Gefahr, ohne Schaden anzurichten, und nicht ohne Stolz verfolgte sein Vater das ungewöhnliche Spiel.
Doch plötzlich glitten dem Jüngling die Zügel aus der Hand. Die fliegenden Pferde verloren die Orientierung und näherten sich auf Tuchfühlung der Erde, sodass Städte und Länder in Brand gerieten und die Welt unterzugehen drohte. Da sah sich Jupiter selbst zum Eingreifen verpflichtet. Er wollte nicht, dass die Erde zerstört würde und die Menschen auf ihr jämmerlich umkämen. Denn was war ein Gott ohne die Menschen, die zu ihm beteten? Also schleuderte er Blitz und Donner, Fahrer und Wagen stürzten in einen großen Fluss. Phaeton ertrank. Die Rosse aber konnten sich und den Sonnenwagen retten, und am nächsten Morgen erschien er wieder, von Helios gelenkt und freilich trauriger, da dieser ja sein Liebstes verloren hatte, Phaeton, den Sohn, am östlichen Horizont.“
Aufmerksam hatten die Kleinen der Geschichte des Sonnengottes gelauscht.
„Glück gehabt!“ Agrippina Minor atmete auf. „Lehrer Demosthenes sagte uns, ohne Sonne könnten wir nicht leben. Wenn also der Wagen und die Pferde auch ertrunken wären, oh ihr Götter! Gibt es hier in Ägypten auch einen Sonnenwagen?“, wollte das Mädchen wissen.
„Ägypten lebt vom Nil“, belehrte sie Germanicus. „Hier gibt es an Stelle des Wagens ein Boot, das Sonnenbarke heißt. Morgens erscheint es im Osten, durchpflügt tagsüber das Firmament, um abends im Westen, dort, wo die Wüste ist, zu verschwinden. In der Nacht setzt es dann unter dem Nil seine beschwerliche Reise fort, wir können nichts mehr sehen, wegen der Dunkelheit. Es ist ein ewiger Kreislauf der Natur, Tag und Nacht, Monat und Jahr, Leben und Tod.“ Und mit der Hand führte der Vater kreisende Bewegungen aus, um den Sonnenverlauf nachzuvollziehen.
„Bist du auch ein Gott?“ Die Kleine hätte sich so sehr gewünscht, dass auch ihr Vater zu den Göttern gehörte, denen die Menschen hier am Ufer des Nils so riesige und herrliche Tempel errichtet hatten, dass sie sich in deren Schatten noch unbedeutender vorkam als in den Palästen Roms, der marmornen Stadt, die, wie jedermann wusste, von ihrem Urahnen Augustus so herrlich ausgeschmückt worden war. Sie stellte sich vor, wie sie in den Säulenwäldern mit ihren Geschwistern Versteck spielte, vor allem mit Gaius, den sie wie keinen anderen bewunderte und liebte. Sie sah sich in den sprudelnden Wasserbecken plantschen oder auf den Wellen des Nils schwimmen. Oh ja, sie schwamm mit ihren jetzt fünf Jahren besser als Stiefelchen, und das machte sie ein wenig stolz, besonders wenn sie merkte, dass er sich darüber ärgerte.
Alles war so gewaltig in diesem Ägypten. So ungewohnt, beeindruckend und fremd. Alles zog sie an. Nie im Leben würde sie diese Reise vergessen, dieses Land mit den seltsamen Namen, Alexandria, Theben und Philae, den sonderbaren Gottheiten, deren Aufagaben sie nicht unterscheiden konnte. Man sagte ihr, sie sei dafür noch zu jung.
„Wenn ich groß bin, komme ich bestimmt wieder“, versicherte sie.
„Wenn du groß bist“, stimmte ihr Germanicus aufmunternd zu.
Die glücklichen Tage gingen allzu schnell vorüber. Als sich die Reisegesellschaft nach Syrien einschiffte, wurde Germanicus krank. Übelkeit und Bauchkrämpfe quälten ihn. Er schrieb seinen Zustand der für die Jahreszeit ungewöhnlich rauen See zu. Doch Agrippina war beunruhigt. Einen Gutteil seines Lebens hatte ihr Gatte auf dem Wasser verbracht, und es erschien ihr ungewöhnlich, dass ihm das bisschen Seegang derartige Beschwerden verursachen sollte. Sein Gesicht war grün, und er erbrach einen zähen, Ekel erregenden Schleim. Auch als sie wieder festen Boden unter den Füßen hatten, änderte sich an seinem Zustand nichts. Der einst gestählte Körper des Feldherrn verfiel zusehends, wurde weich, löste sich auf. Seine Kraft ließ von Tag zu Tag nach. Auch in Daphne bei Antiochia, wo sie endlich an Land gegangen waren, gab es keine Veränderung. Im Gegenteil!
Leibarzt Philokratos verordnete Theriak und Bettruhe, was Agrippina stutzig machte. Immer, wenn Roms Ärzte mit ihrem Latein am Ende waren, griffen sie auf diese altüberlieferte Therapie zurück. „Medicus curat“, hieß es dann. „Natura sanat“. Der Arzt pflegt, doch heilen muss sich der Organismus selbst. Aber allzu oft war die Natur zu schwach, um sich gegen die Krankheit durchzusetzen, und Germanicus’ Tage schienen gezählt zu sein …
Wo immer der Zustand des beliebtesten Mitglieds des Kaiserhauses bekannt wurde, strömten die Menschen auf den Stufen der Tempel zusammen, um für seine Genesung zu beten.
Agrippina fand keinen Schlaf mehr. Tag und Nacht wachte sie am Lager ihres Mannes, drückte seine fiebrige Hand, als ließe sich ihre Kraft auf den Kranken übertragen, kostete selbst die Speisen, die ihm vorgesetzt wurden, und bemerkte nicht einmal, dass sich die Kinder am Fuße des Bettes kauernd niedergelassen hatten und ratlos, sprachlos und entsetzt das Trauerspiel verfolgten, und, die Gesichtchen greisenhaft blass, den Kranken beobachteten, der ihr Vater und doch nicht ihr Vater war, ihr kürzlich noch strahlender Held, ihr Idol, ihr Gott, neben dem alle anderen Götter verblassten. War das der Mann, der neulich in Rom Jupiter gleich auf dem Triumphwagen gestanden und den Beifall der Massen entgegen genommen hatte? Oder etwa der, der so spannende Geschichten zu erzählen wusste von Göttern, Helden, Sonnenbarken und Unterwelt? Vor ihnen lag der Tod in seiner irdischen Gestalt: kalt, ausgezehrt, abstoßend und fremd.
Doch eines Tages schien sich der Zustand des Feldherrn zu bessern. Auf den fahlen Wangen zeigte sich ein wenig Farbe. Er setzte sich aus eigener Kraft auf, bat, ihm den Rücken mit Kissen zu stützen, und befahl seinem Leibsklaven, seine Kinder ans Krankenlager zu bitten. Agrippina, einerseits über die plötzliche Besserung hoch erfreut, wunderte sich andererseits doch sehr. Was mochte ihren Gatten veranlassen, seine Kinder zu rufen, die doch ohnehin fast ohne Unterlass zu seinen Füßen kauerten und erst vor ein oder zwei Stunden von ihr zu Bett geschickt worden waren? Zögernd betraten sie, Schlafwandlern gleich und Unheil ahnend, sein Schlafgemach, und erst auf sein Zeichen hin näherten sie sich seinem Bett.
Mit festem Blick sah Germanicus, Stiefsohn des Princeps und dessen designierter Nachfolger, seine Angehörigen nacheinander an.
„Mein Leben neigt sich zu Ende“, sagte er mit fester Stimme. „Ich habe es nicht verdient, die Welt so früh verlassen zu müssen. Es ist Gift und ein so heimtückisches, dass selbst der kluge und mir treu ergebene Philokratos kein Gegenmittel kennt. Ich weiß nur von drei Feinden: Piso, Plancina und Tiberius. Kümmere dich um unsere Kinder, Agrippina! Und euch, meine Lieben, bitte ich, lasst euere Mutter nicht im Stich!“
Damit sank Roms berühmtester Feldherr in die Kissen zurück und hauchte sein Leben aus, das nur 33 Jahre gedauert hatte.
Schaum floss aus seinem Mund, der Körper übersäte sich mit blauen Flecken, und das Herz des Toten versteinerte. Bald würde sich herausstellen, dass diesem Herzen, da es von Gift durchtränkt war, das Feuer des Scheiterhaufens nichts anhaben konnte.