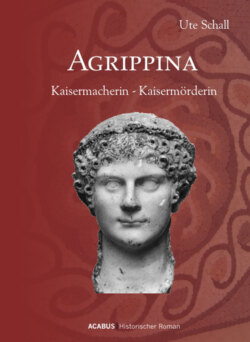Читать книгу Agrippina. Kaisermacherin - Kaisermörderin - Ute Schall - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Germanien
ОглавлениеAufregung herrschte im Legionslager am Rhein. Die Ubier, ein einstmals wilder Volksstamm, den Marcus Vipsanius Agrippa vor mehr als einem Menschenalter gezähmt und am linken Ufer des Stroms angesiedelt hatte, taten wieder einmal ihre Unzufriedenheit mit der römischen Provinzial- und Militärverwaltung kund. Eine ansehnliche Abordnung der Stammesältesten stand vor den Toren des Kastells, forderte lautstark Einlass und eine Unterredung mit dem Präfekten.
Das neu gegründete Oppidum Ubiorum galt als eines der gelungensten Beispiele für die Symbiose von Einheimischen und römischer Präsenz. Wie andernorts hatte sich auch hier um die befestigte römische Niederlassung ein Lagerdorf gebildet. Der Handel blühte, und manche zarte Bande sorgten dafür, dass ein friedliches Zusammenleben zwischen derart unterschiedlichen Kulturen möglich war. Nachts hörte man das Lachen der Verliebten, und die Alten, die sich mit zunehmendem Genuss von Met und Wein immer mehr öffneten, lachten mit.
Viele Jahre lang war es sogar überflüssig gewesen, die Tore der Festung zu schließen. Doch seit den Römern im unseligen Jahr 761 a.u.c. nicht allzu weit von hier bei jenen dunklen Wäldern und Sümpfen im Norden Germaniens, denen bisher niemand einen Namen gegeben hatte, eine der schändlichsten Niederlagen ihrer Geschichte zugefügt worden war – nicht weniger als drei stolze Legionen mit den dazu gehörenden Hilfstruppen waren dort nahezu aufgerieben worden und die Legionsadler verloren gegangen – war das Ansehen der vermeintlich unbesiegbaren Weltmacht heftig beschädigt und das Selbstbewusstsein der Barbaren beträchtlich gestärkt. Rom, das war nicht länger der legendäre Mythos, von dem man nur flüsternd sprach. Wenn es auch immer noch über eine nahezu unvorstellbare Macht verfügte, war es doch verletzlich geworden. Und immer wieder erhoben sich hier in Germanien bereits unterworfen geglaubte Völkerschaften, um die am Tiber das Fürchten zu lehren. Vor allem jener in Rom erzogene und zum Ritter gekürte Arminius, jetzt einer der angesehensten germanischen Stammesführer, dessen Weitblick Rom zum Verhängnis geworden war, wurde nicht müde, den Hass auf die Besatzungsmacht zu schüren und die Stämme seiner Heimat zu Eintracht und Geschlossenheit aufzurufen.
„Was soll das Geschrei?“, herrschte Aulus Caecina Largus, Statthalter wider Willen, seinen zitternden Diener an. „Stehen etwa die Germanen vor den Toren?“ Auf seiner Stirn hatten sich tiefe Sorgenfalten gebildet.
„Die Ubier wünschen den Herrn zu sprechen“, gab der Mann verunsichert zurück.
„Zum Teufel mit dem Pack!“, murrte Caecina. Er hatte seinem Dienstherrn Augustus nie verziehen, dass er in das ferne Land abkommandiert worden war, in die Einöde, unter den ewig trüben Himmel, wo die Sonnentage gezählt waren, in die undurchdringlichen Wälder, die selbst dem mutigsten römischen Soldaten Furcht einflößten, und in eine Welt, in der es keinerlei Abwechslung gab. Und alles nur, weil er, Caecina, gewagt hatte, sich mit einer verheirateten Frau der Nobilität auf eine kurze Affäre einzulassen, eine belanglose Liebelei, die längst beendet war, als die um die Moral ihrer Untertanen besorgte Staatsführung davon erfuhr. Wegen Verstoßes gegen die Sittengesetze hatte man ihn angeklagt, als hätte er allein in ganz Rom sich über sie hinweggesetzt, als hätte nicht der Princeps, wie jedermann wusste, sie Tag um Tag für sich selbst aufgehoben. Die Strafe erschien ihm unangemessen hart. Ein Jahr Verbannung in den Norden des Reiches, als ehrenhafter Posten des Statthalters deklariert. Und viele hatten ihn in der Tat um diese Stellung beneidet.
Wie sehr sehnte er sich nach den immergrünen Gärten Italiens, den plätschernden Brunnen und den vielen schönen Frauen, die in ihren pastellfarbenen Gewändern durch Parks und Straßen flanierten und den Männern den Kopf verdrehten! Zum Glück würde er, so es den Göttern gefiele, wieder nach Hause zurückkehren können, ehe das Jahr sich neigte, und ein anderer römischer Offizier, der vielleicht ehrgeiziger oder auch nur jünger war als er, würde sich hier im hohen Norden kalte Füße holen dürfen.
Caecina seufzte und nahm einen kräftigen Schluck des unvermischten Falerners, den er von zu Hause mitgebracht hatte, betrachtete den Becher mit den kunstvoll aus dem Silber getriebenen Ornamenten, stand von der Kline auf, auf der er geruht hatte, und wandte sich erneut an seinen Diener:
„Sie mögen eintreten und ihr Anliegen vorbringen!“, sagte er gereizt. „Aber höchstens drei Mann. Hörst du? Nicht mehr als drei“, rief er dem bereits Davoneilenden nach.
Er war vorsichtig geworden, seitdem ihm vor einigen Wochen einer der abgesandten Ubier zu nahe gekommen war, ein Bär von einem Kerl mit zotteligem Bart und ungepflegtem Haupthaar, in dicke Felle gewickelt, offensichtlich betrunken und von widerwärtig stechendem Geruch. Vier seiner Kammerdiener hatten Mühe gehabt, den Mann zu überwältigen und aus dem Kastell zu schaffen, aber noch Tage danach schien ihm dieser Mensch schon durch seine tierische Ausdünstung drohend präsent.
Es war ungemütlich und kalt. Wider Erwarten war nach einer Reihe für die Jahreszeit und diese Gegend ungewöhnlich warmer und freundlicher Tage, die einen vorzeitigen Frühling anzukündigen schienen, der Winter mit Macht zurückgekehrt. Der Schnee lag knöchelhoch, war schwer und nass, und die Kälte kroch den Römern über die nackten Beine bis ans Herz. Anfangs hatten sie über die seltsame Bekleidung der Germanen gelacht: Felle, die mit gekreuzten Bändern um den ganzen Körper geschnürt waren, die ebenfalls aus Tierhäuten gefertigten turmartigen Mützen und die Füße in hohen Lederstiefeln, die sie mit Heu, Stroh und Moos zum Schutz gegen den Frost ausgestopft hatten. Menschen, die von Kopf bis Fuß wie die Affen behaart waren und eher an wilde Tiere als an zivilisierte Wesen erinnerten.
Galt es für einen Römer auch als unschicklich, sich nach Barbarenart zu kleiden und die vor allem von den Galliern bevorzugten Hosen zu tragen, so begannen doch zumindest diejenigen, die den Unbilden dieses Klimas schon Jahre ausgesetzt waren, die Vorteile der heimischen Tracht zu schätzen. Caecina sah es zunächst mit Unbehagen, empfahl seinen Männern, häufig das Kastellbad aufzusuchen, um Gicht und Rheuma vorzubeugen, schritt aber nicht gegen die ganz und gar unrömische Kleidung disziplinarisch ein, um den guten Ruf, den er bei den Soldaten genoss, nicht zu gefährden. Mochte sich sein Nachfolger mit solchen Kleinigkeiten herumärgern. Für ihn, Caecina, kam es nur noch darauf an, diesen Abschnitt seines Lebens möglichst schnell hinter sich zu bringen und nach Rom zurückzukehren, zu Fabia, seiner geliebten Frau, und all den anderen, die er nicht weniger begehrte, den beiden Söhnen und in seinen weiträumigen Palast, den er zu Hause auf dem vornehmen Caelius, einem der sieben Hügel, besaß.
„Was willst du?“ Der Römer bemühte sich um Höflichkeit. Steif und ablehnend stand er dem Fremden gegenüber. Vorsorglich umfasste seine Rechte den Knauf seines Schwerts. Der ubische Bote, dessen Alter schwer zu schätzen war, blieb in angemessener Entfernung stehen, verbeugte sich und begann in schlechtem Latein:
„Herr, der Rat der Ältesten hat mich beauftragt, dir eine Beschwerde über einen deiner Kompanieführer vorzutragen. Das Oppidum Ubiorum wurde überfallen. Wieder einmal. Es ging alles ziemlich schnell, und so wissen wir nicht genau, wer es war. Wir vermuten, die Chatten. Zehn unserer Krieger wurden getötet, einige Frauen und Kinder verschleppt. Was aber am schlimmsten ist, sie haben einen Großteil unseres Viehs gestohlen. Wie sollen wir unserer Tributpflicht an euch nachkommen, wenn wir selbst nichts mehr haben? Als Stammesältester habe ich sofort einen Centurio zu Hilfe gerufen. Er sollte uns wenigstens bei der Verfolgung der frechen Diebe helfen, was uns, wie du weißt, vertraglich zugesichert ist. Aber der Mann ließ mir nur ausrichten, er denke gar nicht daran, einzugreifen. Die Bekämpfung von Stammesfehden gehöre nicht zu seinen Aufgaben. Im Übrigen sei ihm das Wetter zu schlecht, und er wolle nicht, dass sich noch mehr seiner Leute einen Schnupfen holten.“
Caecina hörte den Mann geduldig an, ohne ihn zu unterbrechen.
„Ich werde der Sache nachgehen“, versicherte er. „Du hast mein Wort.“
Der Ubier verbeugte sich und kehrte zu der Gruppe seiner wartenden Stammesgenossen zurück.
Wenn ich mir hier auch keine großen Sporen verdienen will, ging es dem Statthalter durch den Kopf, so soll man mir doch nicht nachsagen können, ich hätte meine Pflicht vernachlässigt. Es will mir auch scheinen, dass in den wenigen Monaten, in denen mir die Verantwortung für die Ordnung in dieser Weltecke anvertraut ist, die Disziplin immer mehr zu wünschen übrig lässt. Wie soll ich Germanicus begegnen, der für die nächsten Tage seinen Besuch angekündigt hat? Und womit soll ich mich rechtfertigen, wenn sich die Barbaren bei ihm, gewissermaßen als dem Stellvertreter des Princeps, beklagen? Ich werde den verantwortlichen Centurionen einbestellen und ihn fragen, wie sich die Sache tatsächlich verhalten hat. Audiatur et altera pars! Warum vom bewährten römischen Rechtsgrundsatz abweichen? Und wenn der Ubier Recht hat? Nun, vielleicht sollte man doch wieder einmal von der bewährten Dezimierung Gebrauch machen. Sie hat noch immer geholfen, die Truppen an ihre Pflicht zu erinnern.
Ein schrecklicher Gedanke, den er sogleich wieder verwarf.
„Nein“, sagte er zu sich selbst. „Es fließt genug Blut. Ich will nicht dazu beitragen, dass noch mehr davon unnötig vergossen wird.“
Nach der mühseligen Reise durch das winterliche Bergland war Agrippina die römische Befestigung am Rhein fast wie der kaiserliche Palast auf dem Palatin vorgekommen. Die Geburt ihrer Tochter hatte nicht lange auf sich warten lassen, und nicht nur sie, auch Germanicus war überglücklich, und er fand, die jüngere Agrippina sei das schönste Kind, das ihm seine Gattin bisher geschenkt hatte. Sie hatte ein liebliches Gesicht mit Grübchen in den Wangen, leuchtende Augen, deren Farbe täglich zu wechseln schien, dunkelbraunes, fast rötliches Haar, das sich so fein wie Spinnennetz um das wohlgeformte Köpfchen schmiegte, ein leicht vorstehendes Kinn und eine hohe Stirn. Ihre Stimme war angenehm kräftig und ließ starke Willenskraft erkennen.
Auguren und Haruspices waren zum Schicksal der Neugeborenen befragt worden, wie es Brauch war, und sie hatten versichert, Agrippina, die Tochter, werde größte Höhen erreichen, um in unendliche Tiefen zu stürzen.
Die düstere Vorhersage hatte die Mutter für eine Weile erschreckt. Aber Germanicus hatte sie in der unbeschwerten Art, die ihm eigen war, getröstet. Was hätten sie nicht schon alles von sich gegeben, diese römischen Möchtegern-Propheten, und was davon sei wirklich eingetroffen? Wenn es nach ihnen ginge, stünde Rom schon lange nicht mehr. Nein, er sei gewiss, es könne so schlimm nicht kommen. Der getreue Pentulus, der in seinem Auftrag das Orakel von Delphi befragt habe, habe ganz andere Botschaft mitgebracht: Pythia, die Priesterin des Gottes Apoll, habe geweissagt, Agrippina werde einst neben dem mächtigsten Mann des Imperiums sitzen und ihr Reich selbst in sicheren Händen halten. Und es werde für alle eine glückliche Zeit sein.
Die junge Familie hatte sich hier am Ende der Welt oder dessen, was Rom dafür hielt, behaglich eingerichtet. Aber die Freude über das gemeinsame Glück währte nicht lange. Es waren erst wenige Wochen vergangen, als ein Postreiter erschien, den kein Geringerer als der kaiserliche Großvater an den Niederrhein geschickt hatte, um den beliebten Feldherrn um einen Gefallen zu bitten. Germanicus, der, nun dürfe er es ja wissen, nach Tiberius zum Nachfolger im Principat bestimmt worden sei, möge sich doch an die Stelle des nationalen Unglücks begeben, in die Nähe jenes unheimlichen namenlosen Waldes, der für Rom vor fünf Jahren und mehr zum Schicksal geworden sei. Dort möge er die Gefallenen oder das, was von ihnen nach dieser langen Zeit geblieben sei, bestatten, und die Embleme der Centurien und Kohorten und vielleicht auch einen der verloren gegangenen Legionsadler suchen, damit wenigstens sie nach Rom zurückkehrten. Ihn, Augustus, verfolgten nachts die Schreie der Sterbenden, und er werde erst dann ruhig ins Schattenreich hinüberwechseln können, wenn er gewiss wäre, dass sie alle ein Römern würdiges Grab gefunden hätten. Quinctili Vare, schreie er, redde legiones – gib mir die Legionen wieder! Doch die Götter hätten sein Flehen bisher nicht erhört.
Und noch etwas habe er auf dem Herzen: Arminius, der, in Rom erzogen, undankbar seine einstigen Gönner in jenen feigen Hinterhalt gelockt habe, laufe noch immer frei herum, lasse sich von seinen Gesinnungsgenossen als Held und Befreier feiern und schmähe Rom mit jedem Atemzug. Doch er, der Princeps, habe sichere Kunde, dass sich besonders unter den Verwandten des Sprüche klopfenden Germanenführers der erste Unmut breit mache, Neid aufkomme und bereits überlegt werde, wie man den Jüngling von dem hohen Ross, das er ritt, wieder auf den Boden der Tatsachen holen könne. Germanicus möge also getreu der römischen Devise: divide et impera! dafür sorgen, einen Keil ins germanische Lager zu treiben, besonders zwischen Armin und Segestes, dessen Schwiegervater, der noch immer mit der Weltmacht am Tiber sympathisiere und sicherlich leicht für die Sache Roms zu gewinnen sei.
Germanicus gefiel zunächst der Gedanke nicht, seine Frau und die beiden Kinder für längere Zeit der Obhut des Statthalters zu überlassen, den er als schwach und launisch kennen gelernt hatte. Aber er war als Mitglied der julisch-claudischen Gens dem Stiefgroßvater, dessen bloße Wünsche mittlerweile Gesetzeskraft hatten, zu absolutem Gehorsam verpflichtet. Und die Aussicht, einmal selbst die Geschicke des Weltreichs lenken zu dürfen! Sie hätte Stärkere als Livias zurückhaltenden Enkel verlockt.
Im Übrigen wusste er, dass er kein Familienmensch war. Er liebte Frau und Kinder, gewiss. Und er hätte für sie sein Leben gegeben. Aber hatte er nicht bereits begonnen, sich zu langweilen, unentwegt das Lager zu inspizieren, an dem er nichts auszusetzen fand, sooft er auch seine Runden drehte, und seinen Männern auf die Nerven zu gehen, sodass ihn schon mancher fluchend in den Hades wünschte? Stand auch kein richtiger Feldzug an, bei dem es um Ruhm, Ehre und Beute ging, so erwartete ihn doch immerhin eine Aufgabe, zu der ihn auch seine Neugierde trieb. Wie hatte es geschehen können, dass ausgerechnet Quinctilius Varus, einer der erfolgreichsten Feldherrn der daran reichen römischen Armee (wenn ihn die öffentliche Meinung neuerdings auch als schwach und unfähig verurteilte), der sogar Statthalter der schwierigen Provinz Syrien gewesen war, in den Untergang stolperte wie ein Ochs ins Schlachthaus? Und warum hatte er sich in auswegloser Lage in sein Schwert gestürzt, anstatt für seine Niederlage vor den Göttern und der Welt die Verantwortung zu übernehmen, wie es Rom von jedem seiner Heerführer erwartete? Es konnte also durchaus interessant sein, die näheren Umstände dieser Katastrophe vor Ort zu erforschen.
Was Arminius betraf, der am Mittelpunkt der Welt erzogen worden war, um die Römer mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, kursierten bereits die wildesten Gerüchte. Es hieß, da stünde zwischen ihm und Segestes noch eine alte Rechnung offen. Der Alte wollte dem ungeliebten Schwiegersohn einfach nicht verzeihen, dass sich dieser vor Jahr und Tag bei Nacht und Nebel Thusneldas, Segestes’ einziger Tochter, bemächtigt, sie entführt und geschwängert hatte, obwohl sie vom Vater bereits einem anderen, weit hoffnungsvolleren Heiratskandidaten versprochen worden war. Und auch der bald nach diesem Aufsehen erregenden Raub geborene Enkel habe den väterlichen Zorn auf die beiden jungen Menschen nicht zu besänftigen vermocht. Überall heize Segestes die Stimmung gegen den Sieger über drei römische Legionen an, poche an das Ehrgefühl der Stammesfürsten, einem Verräter und Mädchenschänder keinen Unterschlupf zu gewähren, und mahne sie, sich der Verträge mit der fremden Schutzmacht zu erinnern. Arminius, so hieß es, sei bereits ein toter Mann, an den man nicht mehr viel Aufmerksamkeit verschwenden müsse, und er fiele Germanicus gewiss in den Schoß wie ein reifer Apfel vom Baum.
Gaius Caligula, das Stiefelchen, verstand sicher die Aufregung nicht, die plötzlich im Lager herrschte. Aber er stapfte seinem Vater in den viel zu großen Schuhen, die er sich auszuziehen lautstark weigerte, auf Schritt und Tritt nach, als ahnte er, dass geheimnisvolle Dinge im Gange waren. Als die Pferde gesattelt, die Wagen beladen und die Männer gerüstet waren, beharrte er darauf, seinen Vater zu begleiten, strampelte und schrie und war nur mit großer Mühe davon zu überzeugen, dass er im Lager bleiben und seine kleine Schwester beschützen müsse, mit der er aber nicht allzu viel anfangen konnte, da sie unentwegt schlief.
Der Mond schwoll an und schwand, wechselte erneut und tauchte das Kastell in ein fahles, gespenstisches Licht. Wölfe umkreisten heulend das Lager, und in der Ferne sangen fremde Frauen Klagelieder.
Drei Monate waren vergangen, und Agrippina hatte von Germanicus nichts gehört. Sie hatte nächtelang auf dem lehmigen Boden gelegen, nur in ein dünnes Gewand gehüllt, zitternd vor Sorge und Kälte, und die Götter beschworen, ihr den, der ihr als einziger geblieben war und mit dem sie seit früher Kindheit eine leidenschaftliche Liebe verband, doch lebend zurückzugeben. Als die Götter ihre Gebete endlich erhörten und er müde durch die Porta Praetoria ritt, sah sie einen gebrochenen Mann. Er lebte, aber unversehrt war er nicht. Seine Augen hatten ihren Glanz verloren, und ein bitterer Zug lag um den schönen, einst volllippigen Mund. Es war, als säße ihm noch das Grauen im Nacken, und es dauerte Tage, ehe er seine Sprache wiederfand. Doch eines Abends breitete er vor ihr seine Erinnerungen aus, das schmerzhafte Andenken an die Fremde.
„Wen die Götter verderben wollen“, sagte er nachdenklich, „den schlagen sie mit Blindheit. Und so bewirken sie, dass das, was geschieht, mit vollem Recht zu geschehen scheint, und tiefes Unglück verwandelt sich in tiefste Schuld.“
Überrascht sah Agrippina von dem Himmelbettchen auf, vor dem sie, ihr Kind in den Schlaf wiegend, gekauert war. Sie trat auf Germanicus zu und legte ihm sanft die Hand auf die Schulter.
„Ich bin froh“, sagte sie, „dass du wieder reden kannst, und ich will dir geduldig zuhören, was immer du von deinen Erlebnissen auch preisgeben wirst.“
„Arminius!“, seufzte Germanicus und schlug die Hände vors Gesicht, damit sie seine Trauer nicht sähe. „Er muss ein Meister der Verstellkunst sein. Ich habe Überlebende jener Tragödie getroffen, Männer, die noch nach all den Jahren ihre Tränen nicht zurückhalten konnten, die in den feuchten Wäldern hausen und jede menschliche Berührung scheuen, die mühsam nach Worten rangen und erst beschworen werden mussten, mir zu berichten, was damals vorgefallen ist.
‚Arminius‘, stammelte einer, der sich Paterculus nannte, ‚Arminius aus dem Stamm der Cherusker, das ist kein Mensch. Das ist ein Dämon, den Pluto, der Gott der Unterwelt, selbst für eine Weile beurlaubt hat, um Rom zu verderben. Ein Hüne von Gestalt. Ein scheinbar strahlender junger Mann von rascher Auffassungsgabe und einer genial bösen Klugheit, die jenseits der Begabung eines Barbaren liegt, stets auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Als Varus’ Mundschenk hatte ich lange Gelegenheit, ihn an der Tafel des Gastgebers zu beobachten. Schon sein Gesichtsausdruck und seine Augen verrieten das verderbliche Feuer des Geistes.
Selbst Segestes hat unseren Statthalter vor diesem Menschen, seinem Schwiegersohn, gewarnt. Aber den hat Varus nur ausgelacht. Niemals, so meinte er, würde sich ein römischer Ritter, den man im Zentrum der Macht mit Ehren geradezu überhäuft habe, gegen seine Gönner erheben. Ränkespiele, meinte Varus verharmlosend, nichts als üble Ränkespiele. Ich kenne sie aus der Zeit meiner Statthalterschaft in Syrien, wo am benachbarten Hof von Judäa, an dem ich oft zu Gast war, in König Herodes’ Familie jeder gegen jeden intrigierte, sodass zuletzt der König selbst völlig verunsichert war. Nichts scheint mir unüberwindlicher zu sein als der Hass Verwandter gegen Verwandte. Wer wüsste nicht, dass Arminius und Segestes seit Jahren aufs Tiefste verfeindet sind und es da nur naheliegend ist, dass sie einander schlecht machen? Nein, sagte er mit dem Brustton der Überzeugung, für Arminius lege ich meine Hand ins Feuer. Er hätte sich verbrannt, der gute Varus, er hätte sich verbrannt.‘
Der Alte sah sich ängstlich um und bedeutete mir, näher zu treten. ‚Die Geister‘, flüsterte er. ‚Überall böse Geister. Es ist nicht gut, wenn sie geweckt werden. Ich habe versucht, vieles von dem, was ich gesehen und erlebt habe, zu verdrängen. Versucht, verstehst du? Aber es hat sich in meine Seele gefressen und mein Inneres vergiftet. Nachts fahre ich aus unruhigem Schlaf auf, in Schweiß gebadet, und glaube meinen eigenen Träumen nicht.‘
Nach einer Weile fuhr er mit glühenden Augen, Augen des Wahnsinns, fort:
‚Soweit ich mich erinnere, hat sich folgendes zugetragen:
Varus befindet sich noch im Sommerlager, als ihm Armin, der Cherusker, die Empörung eines weit entfernt siedelnden Stammes meldet. Der Statthalter hegt keinen Verdacht. Er bemerkt die Falle nicht. Er will den Aufstand während des Rückzugs ins Winterlager am Rhein niederschlagen, eine Kleinigkeit, wie er meint. Arglos bricht er auf, mit den drei ihm anvertrauten Legionen, den Hilfstruppen und dem diesmal besonders schwerfälligen Tross. Sind es 20000 Menschen, die ihm folgen, Männer und Frauen, sind es mehr? Wer will es so genau wissen? Er hat mitgenommen, was ging. Man will schließlich auch während der kalten Jahreszeit nicht auf Annehmlichkeiten verzichten. Nein, da erst recht nicht. Durch die Porta Praetoria verlässt er das Kastell, wie es Brauch ist, heißt es doch, dass sie geradewegs ins Glück führe.
Armin hat unterdessen alles gut vorbereitet. Die Germanenführer, die den Marsch der Römer begleiten, melden sich ab. Angeblich wollen sie Truppen holen und die Niederwerfung des Aufstands unterstützen.
Schon lodert, was Varus nicht weiß, denn seine Späher wurden umgebracht, ganz Germanien in hellem Aufruhr. Varus ist blind. Blind für die römischen Posten, die entlang des Weges niedergemetzelt daliegen, blind für die germanischen Krieger, die hinter jedem Busch, in jedem Hain lauern. Da setzt Regen ein. Heftiger Wind kommt auf. Die germanischen Götter greifen ein in die Schlacht. Die üblichen Herbststürme, kräftiger als man sie je erlebt hat, künden ihre Bereitschaft zur Befreiung Germaniens an.
Umgestürzte Baumstämme und der aufgeweichte Boden behindern den Vormarsch unserer Truppen. Vereinzelt greifen Germanen an. Aber Varus hat Scheuklappen vor den Augen. Erst als die ersten getroffenen Römer fluchend niedersinken, erwacht er aus seiner Lethargie. Man versucht offensichtlich, seine Reihen aufzusplittern, seine Ordnung zu verwirren. Und schon bricht die Dunkelheit herein.
Er befiehlt die Errichtung eines Nachtlagers mit dem üblichen Wall und Graben, was die Moral seiner Leute noch immer gestärkt hat. Und am nächsten Morgen setzt er, nicht ohne einen Rest von Hoffnung, seinen schweren Weg, seinen Todesmarsch fort.
Wieder wird es Abend, und wieder lässt er das Nachtlager aufschlagen. Aber für die Schanzarbeit reicht die Kraft der Männer nicht mehr aus. Zu sehr ist ihnen schon zugesetzt worden.
In Bächen stürzt am dritten Tag der Regen aus dem wolkenschweren Himmel herab, die Sicht beträgt nur wenige Ellen. Schon zeichnet sich der Untergang ab. Die Unsrigen sind in ein Sumpfgebiet geraten. Von überall her tönt jetzt der Schlachtgesang der Germanen. Das Horn, das sie so lange nicht gehört haben, ruft zum Vernichtungskampf auf. Einer der Adlerträger stürzt sich in den Morast. Er will wenigstens verhindern, dass das geheiligte Symbol seiner Legion in die Hände der Aufständischen fällt. Ein Gefangener erwürgt sich selbst mit Hilfe der Ketten, die sie ihm angelegt haben. Andere ermutigen sich zu gegenseitigem Mord. Und Varus stürzt sich in sein Schwert.
Ich war unter den wenigen, die sich ins Kastell an den Rhenus retten konnten. Aber immer wieder kehre ich, als Germane verkleidet, an den Schauplatz des Schreckens zurück und beneide die Toten, die Ruhe gefunden haben. Ich lebe, ja, aber gerettet bin ich nicht, im Gegenteil, im Gegenteil!‘
Ehe ich den Alten weiter befragen konnte, war er in dem dunklen Wald verschwunden. Die ihm sogleich nachgesandten Soldaten vermochten ihn nicht mehr aufzufinden. Er hatte sich, ein Spuk, im Nichts aufgelöst, ein Gespenst in finsterer Nacht.
So beunruhigend und grauenhaft sich die Geschichte auch angehört hatte, das, was er geschildert hatte, lag doch Jahre zurück, und Rom hat viel von seinem Selbstbewusstsein wiedergefunden. Was uns aber auf unserem weiteren Weg erwartete, stellt jede noch so grässliche Phantasie in den Schatten.
Auftragsgemäß nähern wir uns der trauerreichen Stätte. Ich habe einen Tribun vorausgeschickt, den mutigsten meiner Männer, den verfluchten Ort zu erkunden. Leichenblass, stotternd und seiner Sinne offenbar nicht mehr mächtig, kehrt er nach einigen Tagen zurück.
‚Die Zeit hat nur mehr ihre Gebeine bewahrt‘, murmelt er mit blödem Lachen. ‚Ha, ha, ihre Gebeine. Knochen, soweit das Auge reicht. Da ein römisches Skelett, da ein germanisches Skelett, ein römisches, wieder ein germanisches …‘ Dazu vollführt er einen irren Tanz um das Lagerfeuer, sodass uns ganz seltsam zu Mute wird.
Ich befehle, den Mann in sein Zelt zu bringen und ihm ein starkes Schlafmittel zu verabreichen. Jemand soll Wache halten. Am nächsten Morgen mache ich mich mit meinen mutigsten Leuten auf, nur mit Freiwilligen, ich will keine unangenehme Überraschung.
Das erste Lager des Varus zeugt noch von der Sorgfalt der Schanzarbeit dreier Legionen. Schon im zweiten Lager überall nur bleichendes Gebein und Anzeichen dafür, dass sich viele in die Büsche geschlagen haben. Doch auch Hinweise auf erbitterten Widerstand. Fragmente von Waffen und Pferdegerippe. An vielen Baumstämmen befestigte Schädel. Und in den umliegenden Hainen Altäre, an denen die Barbaren ihren Göttern die Tribunen und Centurionen geopfert haben. Dann die Orte, wo die höchsten Offiziere gefallen und die Adler verloren gegangen sind. Wo Varus die erste Wunde empfangen und den Entschluss gefasst hat, den Tod durch sein eigenes Schwert dem Zorn Roms vorzuziehen.
Ich gab Anweisung, alle Gebeine mit gleicher Ehre zu bestatten, ohne Unterschied, ob wir fremde Reste oder die der Unsrigen verscharrten, alle als Verwandte, Blutsfreunde im Unglück, Brüder im Tod betrachtend.
Unbändiger Zorn stieg in mir auf. Wir verweilten nicht lange auf dem unheimlichen Friedhof. Ich beschloss, den Verräter zu stellen, koste es, was es wolle, Arminius das Vieh, Arminius den Schlächter, der Rom um drei seiner stolzesten Legionen gebracht hatte. Aber Varus kann offenbar keine Ruhe finden. Es ist er, der unseren Vormarsch stört. Immerzu spukt er in den düsteren Wäldern fort, taucht er jäh auf aus dem schwarzen Morast, entschlüpft er blutverschmiert dem Moor und streckt uns gierig die Hände entgegen, um uns mitzureißen in den Untergang. Und dreist, als trieben sie mit uns ein lustiges Spiel, beschwören die Anführer der Feinde die unterirdischen Schatten. ‚Hier, Varus!‘, fordert ihn der Cherusker noch einmal zum Kampf. Und von weit her durchschneidet ein Leidensruf Raum und Zeit und durchdringt Mark und Bein. „Quinctili Vare, redde legiones!“
Germanicus zitterte so heftig, dass ihn Agrippina bat, sich jetzt ein wenig Ruhe zu gönnen. Er nahm einen Schluck mulsum aus dem goldgetriebenen Becher, den er in der Hand hielt, umklammerte das leuchtende Metall, als müsse er sich daran festhalten, und sah seine Frau mit blutunterlaufenen Augen an.
Agrippina erschrak. Sie wusste plötzlich – woher, von wem? –, dass ihr Gatte niemals Princeps würde. Die Götter hatten seine Tage gezählt. Voll Mitgefühl betrachtete sie das Kind, das in seiner Wiege nichtsahnend einer vaterlosen Zukunft entgegenschlummerte.
Nur wenige Jahre später machten sich Gerüchte im Römerreich breit. Arminius, so hieß es, sei seiner gerechten Strafe zugeführt worden. Die eigenen Verwandten hätten ihn, seines Hochmuts überdrüssig, erschlagen. Seine Frau Thusnelda und sein kleiner Sohn Thumelicus befänden sich bereits auf dem Weg nach Rom, wo sie als Sklaven ein trauriges Los erwartete.