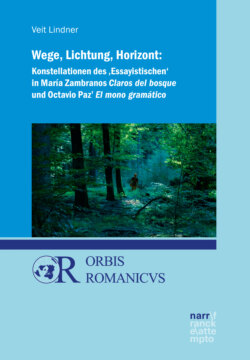Читать книгу Wege, Lichtung, Horizont: Konstellationen des 'Essayistischen' in María Zambranos Claros del bosque und Octavio Paz' El mono gramático - Veit Lindner - Страница 13
3 Über Montaignes Essais – eine Apologie der Sinnesvermögen
ОглавлениеWer sich mit dem Schrift- und Kulturphänomen ,Essay‘ beschäftigt, sollte seinen Blick zunächst auf den großen Sieur de Montaigne richten. Denn die Kunst des intellektuellen Aufsatzes in der spekulativen Dimension, die hier im Vordergrund stehen soll, hat in dem Gascongner seinen Ausgangspunkt.188 Quell des breit gefassten ,Essay‘-Begriffs ist ein Missverständnis, das auf der Übertragung aus dem französischen in den englischsprachigen Raum fußt. So ist Michel de Montaigne zwar der Erste, der seine Prosastücke unter dem Titel Essais 1580 veröffentlicht; in England jedoch beginnt schon bald darauf ebenfalls eine Tradition des Aufsatzes, die nach dem französischen Vorbild als ,essay‘ bezeichnet wird. Wegweisend dafür ist Francis Bacon mit seinen 1597 erschienenen Essayes or Counsels, civill and morall. Bacon jedoch hatte zwar den Begriff von Montaigne übernommen, aber nicht die Textform. Bei seinen Essayes handelt es sich, wie Klaus Weissenberger bemerkt, eigentlich um eine „grundsätzlich entgegengesetzte Spielart des Essays“,189 die von der empiristischen Distanz des Autors geleitet ist. Damit sind Bacons Stücke eher Traktate, die ihr Augenmerk weniger auf die Ästhetik als auf die Ethik legen. Der Essay französischer Prägung hingegen bietet etwas anderes als moralische Unterweisung. Seine empirischen Ansätze bleiben innerhalb des Ideals einer ,docta ignorantia‘ und gehen gleichzeitig über den Anspruch des Empirismus hinaus. Adorno sieht dieses Hinausgehen in Montaignes radikaler Kritik am Systematischen schlechthin begründet und argumentiert: „Selbst die empirischsten Lehren, welche der unabschließbaren, nicht antizipierbaren Erfahrung den Vorrang vor der festen begrifflichen Ordnung zumessen, bleiben insofern systematisch, als sie mehr oder minder konstant vorgestellte Bedingungen von Erkenntnis erörtern.“190 Die Erkenntnisbedingungen selbst aber sind für Montaigne stets im Wandel; er betrachtet sie als ,zu Suchende‘ und reflektiert den Prozess dieser Suche im Individuum. Während also Bacon von einem deduktiven Wahrheitsbegriff ausgeht und seine Erkenntnis aus der Position eines abgeschlossenen Bewusstseinsprozesses heraus formuliert, bleibt Montaigne beim „Eingeständnis der eigenen Unwissenheit“ und dem „Weg der Erkenntnissuche“191 selbst.
Dem heutigen Leser erscheint Montaigne oft als Freund, der immer wieder tröstende Einblicke in die Größe und die Allzumenschlichkeiten eines klaren und gebildeten Verstands gewährt. Stets scheint es, als erwarte uns Montaigne an seinem angestammten Platz in unserem Regal, um bereitwillig eine heitere und wache Plauderei über die Welt, das Leben und die Menschen anzubieten, von der wir uns gut unterhalten fühlen dürfen. Wer sich darauf einlässt, bemerkt jedoch schnell, dass dieser Mensch uns etwas sehr Persönliches und Tiefgehendes zu sagen hat, und wird immer wieder das Gespäch mit ihm suchen. Das Leseerlebnis der Essais ist dabei auch immer eines der Verblüffung über die Modernität, die uns einen Menschen in seinen privaten Ansichten und Problemen über 400 Jahre hinweg so unglaublich nah erscheinen lässt. Die zeitgenössischen Leser jedoch hat Montaigne stark polarisiert: Als Montaigne seine Essais im Zeitraum von 1572 bis zu seinem Tod 1592 schreibt, ist Europa noch von der mittelalterlichen Scholastik geprägt, mit ihrer deduktiven Beweisführung und strengen Dialektik. Dagegen musste allein schon das assoziativ gestaltete Spiel mit Zitaten, Weisheiten, Anekdoten und Sprichwörtern, die Montaigne in Bezug zu politischen und persönlichen Fragestellungen setzt, geradezu verstörend wirken. Nicht seine Ideen und Urteile selbst waren es, gegen die sich die Empörung richtete – die fest katholische Einstellung Montaignes bezweifelte wohl niemand, noch vertrat er in Moral und Politik unerhörte Meinungen;192 vielmehr war es die Form seines Schreibens, die gerade in gelehrten Kreisen den Unwillen weckte. Seine Gegner warfen ihm, wie Pierre Villey schreibt, eine gewagte Unwissenheit vor sowie die Arroganz, ohne wissenschaftliche Methode und vernünftigen Aufbau über alles zu urteilen.193 Montaigne, so also der Vorwurf, maßt sich eine Kompetenz an, welche der Ton und die Form seines Schreibens nicht rechtfertigen. Vor allem aber hat Montaigne Schwierigkeiten, Autoritäten anzuerkennen. Sein Widerwille gegen alles hierarchisch und systematisch Gegliederte lässt ihn vorgefertigte Meinungen hinterfragen und gegen ein didaktisch geordnetes ,Erstens, zweitens, drittens‘ anschreiben.194 Damit will Montaigne Werturteile von jeglicher Autorität und Vorurteilen befreien.195 Wir hätten unsere Meinungen nur von alten Philosophen übernommen, urteilt er im Essay über die Physiognomie (III, 12). Es gelte schlicht als schick, ihnen aufgrund ihrer Autorität Beifall zu zollen, um selbst für gelehrt und kundig gehalten zu werden; selbst wenn ihre Ideen weder dem eigenen Geschmack noch der eigenen Lebensführung entsprächen. Dabei würden die Lehrmeinungen in immer prunkvollere Sätze gegossen. Es gelte jedoch, das eigene Urteil und den eigenen Blick zu schulen, ohne auf den Putz und Pomp rhetorischer Raffinessen und altehrwürdiger Namen hereinzufallen:
Wir nehmen Reize nur noch wahr, wenn sie künstlich sind: gestelzt, gebläht und aufgedonnert. Geht der Liebreiz im Gewand natürlicher Schlichtheit einher, wird er von einem so groben Blick wie dem unseren leicht übersehn, denn seine Schönheit ist zart und verborgen. Um dieses geheime Leuchten zu entdecken, bedarf es eines zur Klarheit geläuterten Auges.196
Montaigne wendet sich nicht nur hier polemisch gegen die Figur des späthumanistischen Gelehrten, der er diesen klaren Blick nicht zutraut und unter denen er dementsprechend wenig Freunde findet. Er kritisiert eine wissenschaftliche Praxis, die sich in den humanistischen Kompendien seiner Zeit oder, im Bereich der ,Naturwissenschaft‘, in den Wissenskompilationen austobe. Der Humanismus läuft sich in den humanistisch gebildeten Augen Montaignes tot, weil er zunehmend darin bestehe, Maximen antiker Autoren unkritisch aneinanderzustückeln; „es reichte schon das Vorwort irgendeines deutschen Schriftstellers, um mich mit Zitaten vollzustopfen.“197 Einer schreibt vom Nächsten ab und reproduziert ein Wissen, dem wirkliches Verständnis und Substanz fehlen, und scheint daher nicht mehr fähig, Neues hervorzubringen.
Dergleichen Sammelsurien abgedroschener Gemeinplätze, mit denen so viele Leute ihr Studium betreiben, ohne sich in geistige Unkosten zu stürzen, sind kaum für andere, als für abgedroschene Themen brauchbar. […] Ich habe gesehn, wie Bücher über Dinge gemacht wurden, die der Autor weder studiert noch verstanden hat.198
Anders als der Vorwurf der Beliebigkeit und Unwissenschaftlichkeit, der Montaigne von zeitgenössischen Gelehrten gemacht wurde (und dem sich Essayisten bis heute stellen müssen), sind die Essais Ausdruck des Versuchs einer Ordnung: Was ist relevant, in welchem Zusammenhang? Dabei richtet sich Montaigne gerade gegen die Vielwisserei199 und gegen die Überschwemmung durch gelehrte Zitate und unreflektierte Versatzstücke. Die Literatur, aus der sich die Essais herausbilden und die sie gleichzeitig kritisieren, war, wie Pierre Villey schreibt, eine der Popularisierung antiker Weisheiten.200 Darunter fallen vor allem Adaptionen antiker Schriften: moralische Sentenzen und, nach dem Vorbild Plutarchs, ,exempla‘ von Lastern und Tugenden großer Männer der Geschichte, Anthologien und Nachdrucke, vermischt mit Bonmots und erstaunlichen Anekdoten. Villey spricht von einer „quantité des maximes et de réflection mal digérées“201 – von schlecht verdauten Reflexionen. Der Hunger nach Literatur über moralische Fragestellungen war brandaktuell, gleichzeitig waren die zeitgenössischen Schriften scheinbar zum Vergessenwerden verdammt, da sie kaum imstande waren, etwas wirklich Neues zu schaffen. Villey weist darauf hin, dass auch Montaigne wahrscheinlich nicht geplant hatte, eine neue literarische Form zu kreieren. Vor allem die frühen, um 1572 entstandenen Essais folgen noch sehr dem Stil der damals in Mode geratenen ,leçons‘. Sie sind eher unpersönlich, präsentieren wenig eigene Gedanken und ähneln dem literarischen Substrat, aus dem sie hervorgegangen sind. Doch schon bald verselbstständigt sich Montaignes Schreiben, und er beginnt, die antike ,Rezeptphilosophie‘ in moralischen Fragestellungen den realen Bedingungen des Individuums gegenüberzustellen und sie dem Praxistest des eigenen Lebens zu unterziehen. Folgte Montaigne dabei anfangs vage stoizistischen Idealen (Que Philosopher, c’est apprendre à mourir, I, 20), entwickelt sich sein Schreiben schon bald fort. Er folgt keiner bestimmten Denkrichtung, sondern macht sie sich alle zu eigen und unterzieht sie einer Kritik, die als modern gelten kann.202 Seine Moral ist dabei nicht mehr an einem göttlichen Wesen ausgerichtet, sondern allein an der menschlichen Vernunft.203
Eine andere Art zeitgenössischer Literatur waren die naturwissenschaftlichen Kompilationen als Ausdruck, wie Claire de Obaldia schreibt, einer kollektivistischen Tradition.204 In diesen Nachschlagewerken wurde kritiklos alles zusammengeführt, was über einen Gegenstand der Natur, etwa ein Tier, bekannt war. Ein besonders anschauliches Beispiel solcher Kompilationen ist durch Michel Foucault einem breiteren Publikum bekannt geworden: die Historia serpentum et draconum des italienischen Naturforschers Ulisse Aldrovandi. Aldrovandi kategorisiert sein Kapitel über Schlangen in Rubriken, die für uns heute kurios erscheinen, wie etwa: Anatomie, Bewegung, Vorkommen, aber ebenso Doppeldeutigkeit, Synonyme, Heilmittel, Lehrfabeln, Symbole, rätselhafte Wunder, Träume etc. Die Essais lassen sich auch als Reaktion auf solche Kompilationen lesen. Wie Claire de Obaldia schreibt, kritisiert Montaigne die Willkür einer solchen Wissensorganisation und konfrontiert sie mit Kritik und Reflexion.205 Für Montaigne sind die Kompilationen Ausdruck des utopischen Gedankens, einen göttlichen Bauplan des Universums in einer allumfassenden und zugleich menschenverständlichen Weise begreifen zu können. In diesem Sinne hat die rigorose innere Organisation eines abstrakten Wissenssystems Montaigne wohl nicht etwa gelangweilt, wie der argentinische Literaturwissenschaftler Walter Mignolo schreibt,206 sie musste ihm vielmehr als Phantasmagorie (oder ,fantaisie‘) erscheinen.
der Arten Zahl ist unbekannt, und keiner hat sie je benannt. Die Wissenschaftler sind es, die ihre Ideen [fantaisies] zergliedern und bis ins kleinste mit spezifischen Begriffen umgrenzen. Ich hingegen, der ich nicht mehr Einblick habe, als die Alltagserfahrung mir völlig reglos zukommen läßt, lege die meinen, mich vorantastend, nur in groben Zügen dar – so auch hier, wo ich meine Meinungen in unverbundenen Sätzen ausspreche, wie man es bei Dingen zu tun pflegt, die sich nicht auf einmal und im ganzen [à la fois et en bloc] sagen lassen.207
Der Illusion des wissenschaftlichen Systems, innerhalb dessen alle Aussagen bereits angelegt sind und somit zumindest theoretisch ,à la fois et en bloc‘ genannt werden können, erteilt er eine Absage. Es gibt keine Vollständigkeit, keine letztgültige Kategorisierung – daher bleibt das Wissen immer Fragment und Provisorium, das sich auf die individuelle Erfahrung gründet. Radikale Skepsis übernimmt die Regie über Montaignes Denken. Die Unsicherheit gegenüber allen Urteilen – auch den eigenen – lässt ihn nur tastend voranschreiten (à tâtons).
Symbol dieser Skepsis ist die Medaille, die Montaigne 1576 prägen lässt: darauf eine Waage mit gleichgerichteten Schalen mit dem Wahlspruch darüber „Que scay-je“ – was weiß ich. Bildlich gesprochen, besitzt jede Medaille – ebenso wie die Waage – zwei Seiten. Gerhard Haas interpretiert Montaignes Wahlspruch sehr treffend als eine solche Ambivalenz. So sei jenes „Qué scay-je“ einerseits „Rechenschaftsablegung eines wachen Geistes“,208 der sein Wissen inventarisiert, es organisiert, Zusammenhänge ergründet und nach Relevanz anordnet. Andererseits aber beinhalte diese Frage auch den Zweifel an der Bewältigungskraft des eigenen menschlichen Verstands: Montaignes Medaille beinhaltet also eine doppelte Fragestellung: Einerseits: Sind alle Möglichkeiten erwogen? Andererseits: Sind alle Möglichkeiten überhaupt erwägbar?209
So wenig wie Montaigne in die Wissenssysteme und -schulen seiner Zeit eintaucht, so wenig arbeitet er sich auch an dem ab, was wie kaum etwas anderes die Totalität dieser Systeme suggeriert: das Buch. Seine Lesepraxis bleibt die eines Müßiggängers in den Schriften, eher aufmerksam blätternd als sich in die Lektüre versenkend. Wie Hugo Friedrich schreibt, liest Montaigne interessiert, aber nüchtern. „Das Ringen mit großen Autoren mag er nicht.“210 Stattdessen kokettiert er mit der eigenen Durchschnittlichkeit und einem angeblich schlechten Gedächtnis. Die Bücher dienen ihm nicht wie den Humanisten als belehrende Autorität, sondern als Anregung. Hans Blumenberg, der sich in Die Lesbarkeit der Welt mit dem ,Buch‘ als Metapher für die Erfahrbarkeit der Welt beschäftigt, spricht von der Metapher des „Buchs der Natur“, mit der Nikolaus von Cues das Bibliotheks- und Bücherwissen konfrontiert hatte: Von dem Übermaß der Schriften befreie das eine Buch der Natur, dessen Erkenntnisse auch dem illiteraten Laien zur Verfügung stünden. Die Gestalt des ,Idiota‘, des unkundigen, aber mit Weltklugheit und Selbstbewusstsein ausgestatteten Stadtbewohners, „antwortet dem gelehrten Redner auf die Frage, woher er denn seine Wissenschaft der Unwissenheit (scientia ignorantiæ) habe: Nicht aus deinen Büchern, sondern aus Gottes Büchern, die er mit eigener Hand geschrieben hat.“211 Nach Blumenberg muss der Cusaner die Metapher von den ,beiden Büchern‘ (Die Natur und die Schriften) wohl von dem katalanischen Humanisten Raymund von Sabunde gekannt haben. Dessen Theologia Naturalis (1436) war in Montaignes Übersetzung ins Französische (1568) einem größeren Publikum bekannt geworden. Sabunde vertrat die Auffassung, Gottes Buch der Natur sei im Grunde fälschungssicherer als die Heilige Schrift, da es nicht falsch ausgelegt werden könne. Somit habe der Laie, der in diesem Buch lese, einen unmittelbareren Zugang zur Weisheit. Montaigne hatte sich über seine Übersetzungsarbeit intensiv mit Sabunde auseinandergesetzt, wovon auch der mit Abstand umfangreichste Text seiner Essais, die Apologie de Raimond Sebond (II, 12), zeugt. Blumenberg ist der Auffassung, dass die Metapher des Buchs der Natur, in welchem der ,Idiota‘ mehr Erkenntnis findet als der Gelehrte und in dem Weisheit gegen Wissenschaft steht, Jahrhunderte später „Selbstdenken“ genannt werden wird:212 Das Bücherwissen kann die Erfahrung nicht ersetzen. Die Essais sind dem Ideal des ,Idiota‘ und seiner ,scientia ignorantiæ‘ verpflichtet. Doch Montaigne deutet Sabundes Metapher gleichzeitig um: „Montaignes Begriff der Welt steht den Erscheinungen des Menschen näher als denen der Natur und die Menschenwelt ist Repertoire der Reflexion, der Selbstentdeckung des Subjekts.“213 Das heißt: Montaigne hat einen wesentlichen Anteil daran, dass wir uns mit der Vokabel ,Welt‘ nicht nur auf die ,Natur‘, sondern besonders auf den Menschen und seine Kulturleistungen beziehen. In dieser Tradition steht essayistisches Schreiben bis heute. Es ist überhaupt nur aus einer Kulturfülle heraus vorstellbar und existiert nur dort, wo sich sprachliche Zeichen der Zivilisation herausgebildet haben. So ist auch, wie Gerhard Haas schreibt, die Nichtoffenlegung der Zitate nicht als Plagiat zu werten. Vielmehr drückt sich genau darin ein „souveränes Verfügen über einen reichen Kulturbestand“214 aus. ,Das Essayistische‘ konstituiert das Individuum nicht aus sich heraus, sondern betrachtet es als ein Kulturprodukt, das mit den Kulturleistungen, mit den Äußerungen anderer verschmelze, ja die es überhaupt erst hervorbringe. Das ,Essayistische‘ betrachtet ,Kultur‘ und ,Geschichte‘ nicht als etwas Sekundäres, von der ,Natur‘ Abgeleitetes, sondern als die Natur des Menschen selbst. Adorno betont diesen Aspekt, wenn er schreibt, ein Essayist versenke sich in Kulturphänomene wie in eine zweite Natur, doch: „Unterm Blick des Essays wird die zweite Natur ihrer selbst inne als erste.“215
Die beiden Texte von Zambrano und Paz sind nicht zuletzt Symbole für die essayistische Sicht auf die Kultur als ,erste Natur‘ des Menschen. María Zambranos biografisch reale Waldspaziergänge, die sich im Schreiben der Waldlichtungen spiegeln, beschreiben Wege durch das wahre Habitat des Menschen – den Wald von Zeichen, in dem der Mensch selbst als unwirkliche, nicht zu betretende Lichtung erscheint (wer Wald ist, kann die Lichtung nicht betreten). Und Octavio Paz’ ebenso historisch wirkliches Schlendern durch das Tempelareal von Galta ist Weg durch die halb verfallenen Schriftarchitekturen und Symbolkonstruktionen, die mit der Natur verschmelzen, von ihr verschluckt und überwuchert werden: Der Mensch, der darin haust, wird selbst zur Schriftruine, die niemals ein Ganzes beschreibt, sondern bröckelt, immer wieder ausgebessert und schließlich ganz verschluckt wird: mächtige Bilder für die Zivilisation als Natur des Menschen und ihre ständige Bedrohung der Auslöschung durch eine Gegenkraft, die schon im Mythos Babylon aufscheint. Das ,Essayistische‘ selbst hat Anteil an diesem Mythos. Montaignes Turm, Borges’ labyrinthische Bibliothek von Babel, Octavio Paz’ halb verfallene chimärische Tempelarchitektur von Galta – all diese Metaphern sind Aspekte des Mythos von der Ambivalenz des Menschen zwischen der Erhabenheit und dem Wahn, zwischen der Anstrengung des Aufbaus und dem ,Sic transit gloria mundi‘; nicht zuletzt des katastrophistischen Mythos der fatalen Verstrickung in die eigenen Schöpfungen. Der Wald der Zeichen und die Wüste der Signifikation reihen sich in die Metaphernwelt des mythischen Babylon ein, die, mit den Worten des Kunsthistorikers Sébastien Allard, das „allgegenwärtige Spannungsverhältnis zwischen Dekonstruktion und (Re)konstruktion“ beschreiben.216 Wald und Wüste, wie sie in den Texten von Zambrano und Paz erscheinen, übertragen den Mythos Babylon von der Architektur auf die Natur, sodass von ,erster‘ oder ,zweiter‘ Natur im Sinne Adornos überhaupt nicht mehr gesprochen werden kann. Das ,Essayistische‘ ist nicht zuletzt ein Weg, diese Natur zwischen Selbstbehauptung und Entmächtigung in sich selbst zu ergründen, dem Mythos der Zivilisation in sich selbst nachzuspüren.
Für Montaignes Zeitgenossen war das Projekt der Erkundung der eigenen Subjektivität ein Novum. Die Faszination dafür brachte ihm zwar zahllose Bewunderer ein – allein von 1580 bis 1669 wurden die Essais in 37 Auflagen gedruckt –, doch selbst diese verstanden ihn im Grunde nicht. Wie Pierre Villey schreibt, war Montaigne seiner Zeit um 150 Jahre voraus. Erst im 18. Jh. hätte sein Denken wirklich erblühen können.217 Folgten die ersten beiden Bände der Essais noch einem breiteren Geschmack, zeigten sich selbst Freunde Montaignes vom dritten Band irritiert. Einig waren sich selbst wohlmeinende Leser in der Zurückweisung der ,peinture du moi‘, der exzessiven Präsenz des ,Ich‘ in den Texten, die in den späteren Essays ein immer größeres Ausmaß annimmt. Gewohnt und ,erlaubt‘ war die Darstellung von Handlungen öffentlicher Personen, die Teil der Geschichte waren und zu einer staatsmännischen Bildung beitragen konnten. Die Darstellung eines privaten ,Ich‘ hingegen war ein regelrechter Skandal, und so sah sich Montaigne mit dem Vorwurf der Eitelkeit konfrontiert, der „vanité de se mettre en scène“; die Essais waren für viele „un livre puéril, vain, pervers“.218 Dabei spielten nicht zuletzt auch religiöse Gründe eine Rolle, denn der Entwurf des eigenen ,Ich‘ im Duktus des Müßiggängers konnte als Abkehr von Gott aufgefasst und in die Nähe der Todsünden gerückt werden. Vor allem aber war es schlicht unschicklich.
Freilich war Montaigne innerhalb der christlichen Welt nicht der Erste, der über sich selbst schrieb. Eines der prominentesten Beispiele für die Darstellung eines ,Ich‘ sind wohl die Confessiones des Augustinus. Doch besitzt das ,Ich‘ hier einen ganz anderen Status: Augustinus spricht von seinen Fehlern, um sich Gott zu unterwerfen; Selbsterkenntnis ist hier die Erkenntnis der Erlösbarkeit durch Gott. Daher gibt Augustinus nur wieder, was in Zusammenhang mit dem Gnadenereignis steht. Hugo Friedrich spricht von einer teleologischen Praxis, bei der es um ein schrittweises Ins-Reine-Kommen mit Gott und dem Heilsplan geht.219 Montaigne hingegen sucht kein Gnadenereignis. Er spricht über seine Wirkung auf Frauen, seine Gallensteine und das Schuheschnüren. Friedrich schreibt, die „Essais sind ein tagebuchähnlicher Monolog, bei dem man nie genau weiß, wen sich der Verfasser, außer sich selbst, als Mithörer denkt; Gott ist es jedenfalls nicht“.220 Obwohl Montaigne in seinen Ideen katholisch konservativ bleibt, zieht er auch den Zorn der Kirche auf sich, sodass seine Essias 1676 auf den vatikanischen Index verbotener Bücher gesetzt werden. Dabei dürfte wohl seine antidogmatische, radikal skeptische und für seine Zeit damit in gewisser Weise rebellische Grundhaltung eine Rolle gespielt haben, die in Verbindung mit einer rein weltlich ausgerichteten Moral die Autoritäten auf den Plan gerufen hatte. Bernhard Teuber liest die Essais als Auseinandersetzung mit den Dispositiven der Macht, in der das Subjekt sich selbst entmächtigt, um aus einer Position der ,faiblesse‘ heraus dieser Macht immer wieder trickreich auszuweichen. Dies führe letztlich zu einer subtilen Subversion der Macht selbst: „Bei Montaigne jedenfalls lassen sich die Figurationen der Entmächtigung durchwegs lesen als Defigurationen der Macht.“221 Das grundlegende Sprachspiel dieser Operation ist die Verteidigungsrede oder Apologie als „rhetorische Inszenierungen der Machtlosigkeit“.222
Wie sich zeigt, ist ,der Essay‘ als apologetischer Diskurs selbst der Apologie bedürftig; vielleicht ist dies ein Grund dafür, dass seine Verteidigung gegen die Anfeindungen der Wissenschaft oft ihrerseits essayistisch ausfällt. Verteidigen jedenfalls muss sich ,der Essay‘ nicht nur gegen den Vorwurf einer eitlen ,peinture du moi‘; er ist auch schon immer Ziel der Kritik vonseiten des Vernunftmächtigen. Schon unter den Gelehrten seiner Zeit stand er unter Anklage fehlender Wissenschaftlichkeit und Methode. Ein knappes Jahrhundert später ist es dann Nicolas Malebranche, der in seiner Recherche de la vérité (1675) die gängigen Vorwürfe gegen Montaigne pointiert formuliert: Er habe mit den Essais eine Sprache geschaffen, die Vernunftpositionen unterlaufe.223 Ohne an dieser Stelle auf die lange Reihe von Kritikern einzugehen: Der Vorwurf bleibt bestehen, sodass Adorno in seiner berühmten Apologie des Essays (Der Essay als Form) von 1958 noch dagegen mobil macht: Dem Positivismus nach solle, so Adorno, jede Darstellung des Ausdrucks eine Objektivität gefährden, die „nach Abzug des Subjekts herausspränge“. Die Reinheit der Sache selbst hoffe man durch ihre Indifferenz gegenüber dem Ausdruck gewährleisten zu können. Damit läuft der szientifische Geist jedoch Gefahr, zum „stur dogmatischen [sic]“ zu verkommen, schreibt Adorno, um dann noch einmal mächtig gegen die Verächter des Essays auszuholen: „Das unverantwortlich geschluderte Wort wähnt, die Verantwortlichkeit in der Sache zu belegen, und die Reflexion über Geistiges wird zum Privileg des Geistlosen.“224
Adorno plädiert keineswegs für eine Wiederzusammenführung von Wissenschaft und Kunst. Im Verlauf einer Entmythologisierung seien die beiden auseinandergedriftet; eine Einheit sei weder wiederherstellbar noch erwünscht. Dennoch sei der Gegensatz auch nicht zu hypostasieren: Wer jegliche Vermischung ablehne, sorge für eine „nach Sparten organisierte Kultur“, die den Verzicht auf „die ganze Wahrheit“ in sich berge: „Die Ideale des Reinlichen und Säuberlichen, die dem Betrieb einer veritablen, auf Ewigkeitswerte geeichten Philosophie, einer hieb- und stichfesten, lückenlos durchorganisierten Wissenschaft und einer begriffslos anschaulichen Kunst gemein sind, tragen die Spur repressiver Ordnung.“225
In der Paraphrase jener berühmten Apologie des Essays wird ein Aspekt essayistischer Haltung deutlich, der auch die beiden Texte von Zambrano und Paz stark prägt: ein Plädoyer für den Gebrauch sämtlicher Sinnesvermögen des Menschen, um dem ,repressiv Systemhaften‘ zu entkommen. Denn bei aller Skepsis geht es der Essayistin/dem Essayisten um die Erkenntnis einer ,ganzen Wahrheit‘; um ein Wissen, das nur unter Einbezug sinnlicher Kapazitäten einer ,imaginatio‘ erlangt werden könne. Beide Texte sprechen aus der Position einer Machtlosigkeit, da sie herrschende Diskurse unterlaufen; nicht indem sie sie angreifen, sondern indem sie sie erweitern und durch den Rückbezug auf die Dichtung mit ihrem ,anderen‘ konfrontieren.
Besonders stark hatte María Zambrano unter den Machtdispositiven zu leiden: zunächst als Verteidigerin der unterlegenen politischen Sache, anschließend aufgrund ihres philosophischen Stils, der sich der Mystik annähert. Wie Zambrano in den Claros del bosque andeutet, hatte sie selbst damit zu kämpfen, von einem Teil des akademischen Establishments als ,Mystikerin‘ oder ,Poetin‘ nicht für voll genommen zu werden.226 Schließlich musste sich Zambrano auch des allgegenwärtigen ,Machismo‘ erwehren, wie Octavio Paz in seiner Hommage an die Philosophin schreibt. So sei die Lehrtätigkeit Zambranos an der Casa de España (später Colegio de México) vor allem am Widerstand ihrer männlichen Kollegen gescheitert, die es ablehnten, mit einer Frau zusammenzuarbeiten: „¡una mujer profesora de filosofía!“227 Daraufhin sei sie ohne Vorbereitung kurzerhand in die Provinzstadt Morelia geschickt worden, wo sie sich einsam und verlassen in einem Umfeld gefühlt habe, das ihren geistigen Anliegen eher fernstand. Dieser Art von Problemen war Octavio Paz als renommierter Diplomat und bereits früh anerkannter Dichter nicht ausgesetzt. El mono gramático ist dennoch ein Werk, das die „Exklusionsmechanismen der diskursiven Logik“228 unterläuft. Der bloßen Einordnung als ,Prosagedicht‘ entgeht die tiefe und sehr persönliche Reflexion über den Vorgang des Dichtens und Schreibens. Sie entzieht sich jeglicher Macht, die versucht ist, mittels einer wissenschaftlichen Metasprache über den Text zu verfügen, und das Poem aus ihrem Sprachspiel ausschließt. Sein Konzept einer kritischen und historischen Poesie oder einer ,pasión crítica‘ steht daher unter dem Zeichen einer Apologie der Dichtung, die seit Platon unter dem Verdacht steht, der Vernunft entgegengesetzt zu sein. Sowohl Zambrano als auch Paz sehen sie jedoch als Instrument jenes unmittelbaren Weltverständnisses, wie es dem Laien im ,Buch der Natur‘ zur Verfügung steht. Dabei konfrontieren sie jedoch auch die Dichtung mit dem wissenschaftlichen Diskurs. Nicht die Erhöhung des ,Buchs der Natur‘ ist ihr Projekt, sondern die Problematisierung des Dechiffrierens aller Bücher. Denn Zambranos Lichtung ist genauso wie Paz’ Tempelruine unter diesem Gesichtspunkt vor allem eine Metapher für mangelhafte Lesbarkeit.
„Das komplizierte Ineinander von Dichterischem und Wissenschaftlichem im Essay“, schreibt Gerhard Haas, „hat immer wieder herausgefordert, sein Verhältnis zu diesen beiden Erkenntnis- und Aussageweisen näher zu bestimmen.“229 Beide Texte akzentuieren in der Metathematik die Interrelation von Philosophie und Mystik/Dichtung, die bei Paz als Verknüpfung von Text und Bild zusätzlich auf intermedialer Ebene gedacht und umgesetzt ist. Damit geraten die Texte zum Untersuchungsfeld für das Essayistische selbst, das sich auf seine Konstitutionsmechanismen hin prüft. In der Apologie ganzheitlicher Erkenntnisvermögen lässt sich das ,Essayistische‘, wie Müller-Funk schreibt, als „Absetzbewegung von den vertrauten Formen und Figuren des rationalen Denkens bestimmen: Definition, Eindeutigkeit, Kausalität, Verständlichkeit durch explizite Erklärung, die Wirksamkeit des Kausalgesetzes, Fußnoten, linearer Aufbau, eine strenge und tendenziell statische Distanz von Subjekt und Objekt, Einhaltung der Regeln der ,Disziplin‘.“230 Das ,Essayistische‘ schafft einen Raum, wo Diskurse atmen können, denen die szientifische Aussagepraxis ihre Sprache entzieht. Weil das ,Essayistische‘ sich jedoch dabei selbst infrage stellt, delegitimiert es Wissenschaft nicht, sondern unterhält einen kritischen Dialog mit ihr durch den Einbezug von Imagination und Phantasie, von Erfahrung und Sinnlichkeit.231