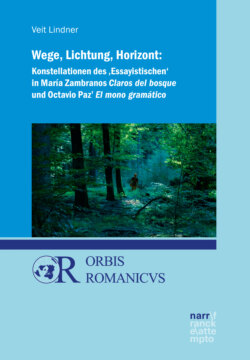Читать книгу Wege, Lichtung, Horizont: Konstellationen des 'Essayistischen' in María Zambranos Claros del bosque und Octavio Paz' El mono gramático - Veit Lindner - Страница 7
II. Theorie 1 Der Essay und das ,Essayistische‘ 1.1 Der Essay als Gattungsproblematik
ОглавлениеOb als populärwissenschaftlich marginalisiert, als Philosophie für Faule belächelt oder als (pseudo-) intellektuelles Machwerk angefeindet: Der Essay erscheint als niedere Form im literarischen Gattungsgefüge oder als behelfsmäßige Theorie und wird noch immer gern als mehr oder weniger gefährliche Subversion des wissenschaftlichen Geistes angesehen. Dabei nimmt er durch seine Lust an allem, was der Systemhaftigkeit zuwiderläuft, einen schwierigen Stand zwischen – oder jenseits von – Literatur und Wissenschaft ein. Der Essay ist das Nichtidentifizierbare, ,Unreine‘ und irgendwie Störende im hübsch geordneten philologischen Vorratsschrank; das Glas mit dem immer falschen Etikett. Von der Geringschätzung, die dieser Form des Schreibens besonders hierzulande lange entgegenschlug,38 zeugt nicht zuletzt Th.W. Adornos hartes Urteil über die Verächter des Essays, denen er Obrigkeitshörigkeit vorwirft, welche sich der teutonische Geist aufgrund der lediglich „lauen Aufklärung seit Leibnitzschnen Tagen“ bewahrt habe: „In Deutschland reizt der Essay zur Abwehr, weil er an die Freiheit des Geistes mahnt.“39 Gerade im akademischen Betrieb ist, folgt man Adorno, der Vorwurf des essayistischen Ausdrucks ein schwerer. Argwöhnisch wacht die gestrenge Wissenschaft über ihre Hoheitsgebiete, um mögliche Übertretungen, erfolgen sie nun von innen oder von außen, missgünstig als ,Literatur‘ zu denunzieren. Der Vorbehalt gegen ihn ist nicht zuletzt dem laxen Umgang mit dem Begriff des Essays geschuldet, der ein allzu weit gefasstes Verständnis von der Zeitungskolumne über den Schulaufsatz bis hin zum naturwissenschaftlichen Traktat alle möglichen Textformen duldet, die nicht eindeutig genug entweder als literarische Prosa oder als Forschungslektüre zu identifizieren sind.
Essays können kurz sein oder lang, sie können von allem handeln, das kulturelle Zusammenhänge erschließt. Allein der Streit um eine gültige Thematik kann befremdliche Züge annehmen, wenn etwa Adorno urteilt, ein guter Essay handle nicht von Personen, während zum Beispiel Stefan Zweig oder in Spanien José Ortega y Gasset oder Ramón Gómez de la Serna40 dieses Diktum längst eindrücklich entkräftet hatten. Einige Essays sind in ihrem Anspruch des Zugriffs auf Welt umfassender, andere kommen als flüchtige Detailbeobachtung daher, wieder andere rücken eine intime Selbststudie in den Vordergrund, die den Charakter eines Bekenntnisses hat. Essays sind politisch, philosophisch, anthropologisch, soziologisch, philologisch etc. oder alles zusammen, denn sie integrieren meist mehrere Teilbereiche des Wissens sowie unterschiedliche Stile, Ausdrucks- und Erkenntnismittel. Die Schwierigkeiten einer Definition liegen an der Auswahl geeigneter Kriterien für die Klassifikation eines Texts als Essay: thematische oder formale Aspekte, Grad gesellschaftlicher Relevanz, stilistische Besonderheiten, Wirkungsdispositionen. Gehen wir von einem Modell aus, das mehrere Kriterien berücksichtigt, stellt sich das Problem ihres lediglich graduellen Vorhandenseins. So ist etwa die Spanne zwischen tentativer und explikatorischer Darstellungsart sehr weit. Manche Essays gleichen aleatorischen Einfällen, andere deuten ganz bewusst auf einen hohen Grad von Elaboration hin. Wo liegt die Grenze, ab wann ist ein Essay kein Essay mehr?
Die maximale Freiheit der Autoren beim Verfassen von Essays scheint diese an ihre persönlichen Vorstellungen und an die Umstände ihrer Epoche anzupassen, sodass sie als Ausdruck individueller Sensibilität gelten. Juan Marichal spricht daher von einer „Biegsamkeit“ oder Anpassungsfähigkeit einer Form, die man schon „chamäleonisch“41 nennen könne. Und Juan Loveluck prägt das schöne Wort vom Essay als dem „frechen Gnom der Literatur“, der sich mal hier, mal dort versteckt und immer neue Volten der Ablenkung schlägt, wenn jemand seiner habhaft werden möchte.42 Versuche zur Bestimmung gibt es zahlreiche, die zwar gewisse Charakterzüge richtig erfassen, dabei jedoch oft im Allgemeinen verharren. So erklärt etwa Gerhard Haas, der Essay sei unsystematisch, ohne Ableitung von Prinzipien, daher ziele er nicht auf Vollendung, oder bleibende Resultate. Die logische Gedankenbewegung sei durch intuitive Einfälle unterbrochen, so entstehe der Essay aus dem Zusammenarbeiten von Instinkt und Intelligenz.43 In einer Untersuchung neueren Datums geht zum Beispiel Claire de Obaldia auf die Gattungsproblematik ein und nimmt folgende Bestimmung vor:
an essentially ambulatory and fragmentary prose form. Its direction and pace, the tracks it chooses to follow, can be changed at will; […] the essay develops around a number of topics which offer themselves along the way. And this sauntering from one topic to the next toghether with the way in which each topic is informally 'tried out' suggests a […] randomness which seems to elude the unifying conception […] of a recognizable generic identity.44
Doch auch damit kommt keine stabile Definition zustande. Obaldia selbst führt weiter aus, die schiere Unendlichkeit der möglichen Themen für den Essay mache eine Klassifikation fast unmöglich, und dies umso mehr, als die Bezeichnung ,Essay‘ selbst den Erwartungshorizont des Lesers zerstreue. Denn einerseits stelle sie eine Autorität und Authentizität eines Menschen in Aussicht, der in seinem eigenen Namen spricht, andererseits aber scheine dieser gleichzeitig alle Verantwortung für das Gesagte abzuwälzen mit dem Hinweis darauf, es sei eben nur ein beiläufiger Versuch.45 Ohne im Rahmen dieser Arbeit auf die einzelnen definitorischen Anstrengungen eingehen zu können, halte ich Birgit Nübels Einschätzung für richtig, der Essay habe sich bislang „sowohl in literarhistorischer wie in systematischer Hinsicht jeder noch so umfangreichen deskriptiven Anstrengung sowie allen definitorischen Zugriffen entzogen“.46 So erschöpften sich Forschungsarbeiten zum Thema in einer „additiven Aufzählung von Merkmalen, wobei die zahlreichen Klassifikationsvorschläge durch phänomenologische Beschreibungen und Paraphrasierungen der vielzitierten Metaessays von Georg Lukács, Max Bense, Theodor W. Adorno und einschlägiger Passagen aus Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften (1930/32) ergänzt werden“.47 Sowohl die metaphorischen Umschreibungsversuche, als auch die formalistischen Abstraktionen zeigten die Schwierigkeit, wissenschaftlich mehr als die Minimalformel „Essay = ein nicht-fiktionales [sic] Prosastück mittlerer Länge“48 zu erzielen. Auch Claire de Obaldia bemerkt, es gebe ohnehin nur eine einzige Tatsache, die allgemein am Essay akzeptiert werde, und diese laute: „indeterminacy is germane to its essence.“49 Bei näherer Hinsicht besteht jedoch weder Einigkeit über die Universalität der Unbestimmtheit, noch über den nichtfiktionalen Status. Und selbst wenn wir etwa etwa mit Klaus Weissenberger den Essay grob als „nicht-fiktionale Kunstprosa [sic]“50 betrachteten, so ergäbe sich immer noch die Schwierigkeit einer Abgrenzung zu zahlreichen Nachbarformen, wie dem Brief, dem Aphorismus, oder der Autobiografie. Der Sinn einer klassifikatorischen Herangehensweise erscheint immer zweifelhafter. So stellt etwa Gerhard Haas gleich zu Beginn seiner Studien zur Form des Essays die entscheidende Frage: „[G]ibt es denn die Gestalt des Essays überhaupt?“51 Und wie soll es möglich sein, eine Form zu bestimmen, die sich gerade durch die Freiheit der Form auszeichnet und nicht nur darstellerische Qualität, Sachnähe, Rundung, Rhythmik, Geistesoffenheit, Fragegier und lyrische Präzision, sondern auch Magie und Transzendenz in sich vereinigen soll?52 Durch die fehlende Zuordnung zu einer eindeutig identifizierbaren Gattung gerät der Essay jedoch in die Gefahr, als „sub-literarisch“ marginalisiert zu werden.53 Als Hybrid oder Mischform schlechthin verführt er außerdem zu einer exzessiven Verwendung des Begriffs. Und so bedauert etwa auch Gerhard Haas, der Essay werde auf diese Weise nichts als ein „bequemer Sammelbegriff“.54
Genauso entzündet sich daran jedoch auch ein Bedürfnis nach genauerer Einordnung und einem Ausweg aus der Beliebigkeit. Schon seit Beginn des 20. Jh. existiert ein Bewusstsein dafür, dass es auf irgendeine Art und Weise ,richtige‘ und ,falsche‘ Essays geben müsse. So besteht z.B. Georg Lukács in seinem Brief an Leo Popper darauf, sich nur auf die „wahrhaftigen Essays“ beziehen zu wollen und nicht auf „jene nützlichen, aber unberechtigterweise Essays genannten Schriften, die uns nie mehr geben als Belehrung und Data und ,Zusammenhänge‘“.55 Der „wahrhaftige Essay“ zeichnet sich für Lukács dadurch aus, dass er nicht an Wert verliert, wenn sein historischer Augenblick vergangen ist. Entscheidend für den „wahrhaftigen Essay“ sind aber weniger äußere Kategorien, als vielmehr eine innere Einstellung des Autors: Nur durch seine Ernsthaftigkeit rette er sich aus dem Wertlosen. Tatsächlich ist die Ernsthaftigkeit einer Wahrheitssuche im Gestus aufrichtiger Rede zentral für eine Charakterisierung essayistischen Schreibens; als Kriterium für eine Gattungsbestimmung ist sie freilich nicht geeignet. Der grundlegende Ansatz, das Textphänomen ,Essay‘ auf dynamischere Art zu erfassen, erscheint zielführender, als einem kaum in den definitorischen Griff zu bekommenden und extrem heterogenen Textkorpus eine bestimmte Gattungszugehörigkeit abringen zu wollen.