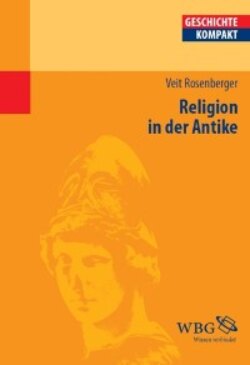Читать книгу Religion in der Antike - Veit Rosenberger - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Q
ОглавлениеDeisidaimonia
(Theophrast, Charaktere 16)
Wenn eine Maus einen Lederbeutel voll Gerste anknabbert, geht er zu einem Zeichendeuter und fragt ihn, was er tun solle; und wenn jener antwortet, er solle ihn dem Gerber zum Flicken geben, so hört er nicht darauf, sondern bringt ein schadenabwendendes Opfer dar.
In diesem sicherlich überzeichneten Charakterbild sieht der Abergläubische in jedem Ereignis ein Vorzeichen. Angesichts der gefräßigen Maus denkt er nicht an eine Katze, eine Falle oder an eine sichere Lagerung des Getreides, sondern geht zum Zeichendeuter. Als selbst dieser das hungrige Haustier nicht zum Zeichen erklärt und einen pragmatischen Ratschlag gibt, wendet sich der Abergläubische dennoch den Göttern zu.
Aberglaube und Andersartigkeit
Kulte der fremden Völker konnten – bei aller prinzipiellen Offenheit der Römer – als superstitio gelten, ebenso die Magie. Nach römischer Vorstellung bedienten sich die Feinde der Römer der superstitio, gleich ob es sich um barbarische Germanen, überkultivierte Ägypter oder unrömisch gewordene Bürgerkriegsgegner handelte. Auch die Christen waren der superstitio verfallen, wie aus dem Briefwechsel zwischen Plinius und Kaiser Traian hervorgeht. Umgekehrt bezichtigten die Christen die Paganen der superstitio. In den Gesetzen des späten 4. Jahrhunderts n. Chr. gebrauchten die nunmehr christlichen Kaiser den Begriff superstitio, um damit die letzten unbelehrbaren Heiden zu brandmarken.
Sokrates
Eine Ausgrenzung von anderen Religionen und Kulten ist nur selten belegt. Gegen Sokrates wurden zwei Anschuldigungen vorgebracht: Er verderbe die Jugend und erführe neue Götter ein. Welche Götter der Philosoph eingeführt habe, wurde nie gesagt, weder von den Anklägern noch von seinen Verteidigern. Letztlich war dieser Vorwurf vielleicht nur ein Symbol dafür, dass er die Polis beschädigte. Der Prozess lehrt, dass sich die Polis bei Bedarf um Fragen der Religion einmischte und Präsenz zeigte. Sokrates stellte lange Zeit kein Problem dar und wurde nicht behelligt. Nur selten beschäftigten sich die Gemeinwesen mit der religiösen Devianz einzelner Bürger. In Krisenzeiten hingegen war es möglich, dass die Instrumente der Polis mobilisiert wurden.
Kontrolle von Kulten
Eingriffe von Seiten des Staates sind auch in der römischen Geschichte selten. Das markanteste Beispiel in der Zeit vor den Christenverfolgungen ist die strenge Reglementierung der Bacchanalien 186 v. Chr. Diese Bacchusmysterien, über deren Rituale nur Gerüchte kursierten, hatten sich aus dem griechischen Siedlungsgebiet bis nach Rom verbreitet und waren dort wohl schon länger beheimatet. Im Unterschied zu dem Fall des Sokrates griffen die römischen Behörden 186 v. Chr. ein, weil sie die Zeit dazu hatten. In diesem Jahr gab es weniger außenpolitische Probleme als in früheren Jahren; überdies wurden in dieser Zeit auch andere Regelungen getroffen, so war zwei Jahre zuvor die Ämterlaufbahn genau festgelegt worden, 181 v. Chr. wurden die angeblichen Numabücher verbrannt. Man warf den Anhängern des Bacchuskultes vor, dass sie ihre Rituale in der Abgeschiedenheit und in der Nacht feierten. Da alle von Wein berauscht waren, soll es zu unbeschreiblichen Szenen gekommen sein: Das Panorama reicht von sexuellen Ausschweifungen über kleinere Verbrechen wie das Erstellen von falschen Testamenten bis hin zum Mord. Und da die Zahl der Eingeweihten groß war, wurde der Kult, den man für eine Verschwörung hielt, zur Gefahr für den Staat (Livius 39,8–19). Der Senat reagierte mit einem Beschluss, der auch in einer Inschrift überliefert ist: Bacchanalien durften nur abgehalten werden, wenn man sie zuerst in Rom beim Praetor urbanus beantragt hatte; jener für Rechtsfragen zuständige hohe Amtsträger musste die Angelegenheit dem Senat vorlegen, wobei ein Quorum von 100 Senatoren zur Erteilung der Erlaubnis nötig war. An einem Bacchanal durften höchstens fünf Personen teilnehmen; nicht mehr als zwei davon durften Männer sein. Wer sich nicht an die Auflagen hielt, musste mit der Todesstrafe rechnen (Corpus Inscriptionum Latinarum X 104). Entsprechend den paganen Auffassungen von Religion wurde der Kult nicht gänzlich verboten, sondern nur stark eingeschränkt; besonders der Verfahrensweg über Rom mochte für viele, die weit außerhalb der Stadt wohnten, ein schwer unüberwindliches Hindernis darstellen. Das Sagen in Angelegenheiten der Religion hatte der Senat, die Versammlung der einflussreichsten Männer des Staates.
Plinius der Jüngere
Auch in der Kaiserzeit konnte man einen Gegner als superstitiosus skizzieren. Bei der Lektüre der Briefe des jüngeren Plinius wird schnell klar, wer sein Intimfeind ist: Marcus Aquilius Regulus, wie Plinius als Anwalt tätig. Laut Plinius befragte Regulus während eines Prozesses ständig die Eingeweideschauer. Regulus selbst, der durch Schurkereien reich geworden war, erzählte Plinius, er habe einmal beim Opfer gefragt, wie schnell er zu einem Vermögen von 60 Millionen Sesterzen kommen könne. Da das Opfertier doppelte Eingeweide hatte, hoffte Regulus sogar auf ein Vermögen von 120 Millionen Sesterzen (2,20,13f.). Als sein Sohn starb, kannte Regulus keine Grenzen; er ließ am Scheiterhaufen des Kindes alle seine Tiere abschlachten, Ponys, Hunde, Nachtigallen, Papageien und Amseln (4,2,3). Abergläubisches Handeln wird auch an anderer Stelle gegeißelt. Als bei der Stadt Hippo in Nordafrika ein Delphin an den Strand geschwommen war, freundeten sich Knaben mit dem Tier an und badeten im Meer mit ihm. Octavius Avitus hingegen, ein Helfer des Statthalters, verehrte den Fisch und übergoss ihn mit Salben. Der Delphin floh vor dem ungewohnten Geruch ins Meer und kam erst Tage später wieder zurück. Octavius Avitus, namentlich genannt, wird der Lächerlichkeit preisgegeben, hatte er doch das Tier wie ein Götterbild behandelt (9,33,9). Zugleich illustriert diese Episode die möglichen Optionen: Man konnte wie die Kinder mit dem Delphin spielen, man konnte wie Plinius sich an der Geschichte ergötzen – und man konnte den Delphin als Gottheit oder zumindest als Abgesandten einer Gottheit verehren. Für die letzte Möglichkeit standen mythologische Anknüpfungspunkte zur Verfügung, es sei nur an die Rettung Arions durch einen Delphin oder die vielen anderen Mythen, in denen Delphine als Begleiter Apollons auftreten, erinnert.