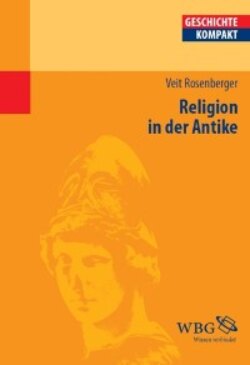Читать книгу Religion in der Antike - Veit Rosenberger - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
Оглавление| Zwischen den Büchern und der Wirklichkeit ist eine alte Feindschaft gesetzt.Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, 17 |
Auf den ersten Blick ist eine Einführung in die Religion der Antike eine einfache Angelegenheit – wer hat nicht schon von den Göttern, Mythen und Tempeln gehört? Doch je schärfer wir das, was wir unter „Religion“ verstehen, unter die Lupe nehmen, desto stärker treten Unklarheiten, Widersprüche und Lücken hervor, bedingt durch die höchst uneinheitliche Quellenlage und die damit einhergehenden unterschiedlichen Interpretationen des Befundes: Kaum ein Begriff kann ohne Modifizierung bleiben, immer wieder wird von lokalen oder regionalen Varianten die Rede sein müssen, von Veränderungen im Laufe der Zeit; oft wird eine Sensibilisierung für die Problematik genügen müssen. Aus Platzgründen können die religiösen Traditionen der Ägypter, Etrusker, Kelten und Germanen allenfalls am Rande Berücksichtigung finden, dies gilt auch für das Judentum und das Christentum. Daher kann dieses Büchlein kein vollständiges Bild, sondern lediglich grobe Skizzen liefern. Antike Religion muss noch viel bunter und vielfältiger gewesen sein als das, was die Quellen verraten.
Eine Kapitelfolge, die glasklar aufeinander aufbaut, ist bei einer Einführung in die Religion der Antike nicht möglich. Zu stark sind die verschiedenen Bereiche miteinander verwoben, etwa Mythen, Götter, Heiligtümer, Rituale: Es ist kein Zufall, dass jedes Handbuch zur Religion in der Antike einem anderen Gliederungschema folgt. Im ersten Kapitel werden antike Konzepte und moderne Forschungsansätze zur Religion in der griechisch-römischen Welt beleuchtet. Das zweite Kapitel widmet sich den Göttern der Griechen und Römer, den religiösen Spezialisten und den Mysterienreligionen. Im dritten Kapitel werden Rituale, Gebete, Verfluchungen und Weissagungspraktiken behandelt. Das vierte Kapitel gilt den religiösen Räumen und der Einteilung von Zeit.
Im Idealfall sollen unterhalb dieser Gliederungspunkte drei weitere Schneisen durch das Dickicht der Informationen angelegt werden. Erstens die Einteilung nach griechischen und römischen Traditionen, zweitens die Unterscheidung nach Gemeinwesen und Individuen, drittens ist zumindest ansatzweise die chronologische Dimension zu berücksichtigen. Eine Zeittafel am Ende, aufgeteilt in die Ereignisgeschichte und in wichtige Daten zur Religion, soll einen schnellen Überblick ermöglichen: Antike Religion ist ohne die Geschichte der antiken Welt nicht zu verstehen. Zugleich erlaubt die disparate Quellenlage nicht immer, dass sich diese Schneisen treffen und eine Lichtung entsteht, die einen Überblick gewährt: Wir wissen beispielsweise viel mehr über griechische Polisheiligtümer im 5. Jahrhundert v. Chr. als über römische Privatkulte zu dieser Zeit.
Für Korrekturen und Anregungen danke ich Daniel Albrecht, Elisabeth Begemann, Asaph Ben-Tov, Andreas Bendlin, Jan Bremmer, Kai Brodersen, Dominik Fugger, Fabian Germerodt, Christian Karst, Karoline Koch, Silvia Orlandi, Jörg Rüpke, Leif Scheuermann, Wolfgang Spickermann, Katharina Waldner und Gregor Weber. Insgesamt hat das religionswissenschaftlich durchtränkte akademische milieu, um nicht zu sagen terroir, an der Universität Erfurt dazu beigetragen, dass viele Ideen aufgekommen, gereift, hinterfragt und auch verworfen wurden; zugleich bewirkt dieser Überfluss, dass ich nicht immer weiß, wem ich für welche Idee zu Dank verpflichtet bin. Römer hätten vorsichtshalber dis deabusque gedankt; als Bewohner des frühen 21. Jahrhunderts danke ich mit einem der politisch unschlagbar korrekten Begriffe, wie sie nur das Lateinische bereitstellt: collegis.
| Erfurt, im Frühling 2012 | Veit Rosenberger |