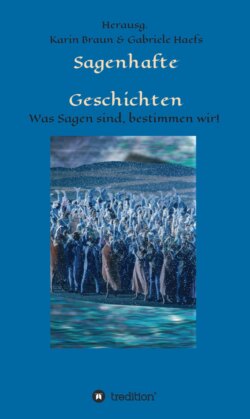Читать книгу Sagenhafte Geschichten - Вильгельм Гауф - Страница 6
ОглавлениеStatt eines Vorworts …
Sagen im Kreise Geldern, die noch im Volksmunde fortleben
Peter Paul Haefs
Siehst du die hohe, stattliche Gestalt, die dort still auf dem moosigen Pfade dem schweigenden, tiefgründigen Moore zuwandelt? - Wer ist diese geheimnisvolle Gestalt in dem altertümlichen Mantel, der das von schimmerndem und glänzendem Golde durchwirkte Gewand nur halb verhüllt? - Was tut sie in dieser tiefen, tiefen Stille?
Es ist Frau „Sage“, die zeitlose und von allen Menschen geliebte Frau Sage. Überall ist sie zugegen, auf dem Schiffe, das unter fremder Sonne die Meeresfluten durchfurcht, sitzt sie mitten unter den Seeleuten, die sich am Maste versammelt haben und mit leiser Stimme die Mär von dem verderbenbringenden Geisterschiff erzählen, im tiefen Walde erklärt sie dem einsamen Hirten oder dem vom Rauch geschwärzten Köhler das Rauschen der Bäume und lässt sie, die Stimme des Windes verstehen, und in der Bauernhütte erfreut sie sich an den lichten Augen der Kinder, die beim knisternden Herdfeuer zu den Füßen des Vaters oder der Mutter sitzen und aufmerksam lauschen auf die wundersamen Mären aus vergangenen Zeiten.
Diese Frau Sage ist auch durch das Gelderland geschritten und hat dort ihre Spuren zurückgelassen. Suchen wir diese Spuren zu lesen und daraus zu lernen. -
Eine Sage entsteht dort, wo ein rätselhafter Vorgang die Aufmerksamkeit des Menschen erregt, mag dieser Vorfall sich in der Geschichte, in der Natur, im täglichen Leben abspielen. In schlichter Erzählung sucht die Sage die geheimnisvolle Begebenheit zu erklären. Die Sage soll in erster Linie erzieherisch wirken. „Ihr Wesen besteht darin“, so schreiben die Gebrüder Grimm, „dass sie Angst und Warnung mit gleichen Händen austeilt.“ Dann hat die Sage aber auch kulturhistorische Bedeutung, insofern sie uns Anschauungen, Sitten und Gebräuche aus grauer Vorzeit schildert und bisweilen vor dem Vergessenwerden bewahrt; denn die Sagen stammen häufig aus Zeiten, aus denen es keine Schriften mehr gibt oder in denen wegen des niederen Kulturstandes der Bewohner noch keine Aufzeichnungen gemacht wurden, und in diesem Falle sind die Sagen eine wichtige Quelle der Überlieferung.
Der Kreis Geldern war einstens sagenreich. Manche Sagen sind im Wechsel der Zeit untergegangen. Andere Sagen sind nur mehr der ältesten jetzt lebenden Generation bekannt, und mit derem Tode werden auch sie aussterben, wenn nicht eine sofortige Sammlung diese Sagen vor dem Vergessenwerden schützt. Demgegenüber steht aber noch eine beträchtliche Anzahl von Volkssagen, die auch heute noch im Volksmunde leben.
Ziemlich bekannt ist die Sagen von der Gründung Gelderns. In grauer Vorzeit soll in der Gegend von Geldern ein gewaltiger Drache gehaust haben. Alles Lebende fiel ihm zum Opfer. Wie „Gelre, Gelre“ klang das Fauchen des Untiers. Das ganze Land litt unter dieser Plage, und allenthalben wanderten die Bewohner aus. In jener Gegend lebte damals ein wackerer Ritter, der Graf von Pont. Dieser Graft hatte zwei Söhne, Wichard und Luitpold, welche beschlossen, den Kampf gegen das Untier zu wagen. Wohlgerüstet traten sie den Weg an. Das Tier lag vor seiner Höhle und sonnte sich. Beim Anblick desselben erschraken die Kämpen, doch bald fassten sie sich, sprachen ein kurzes Gebet und griffen das Untier an. Nach heißem Kampfe erlag das Untier. Freude herrschte ob dieser Heldentat in den Gauen des Gelderlandes. Die beiden Erretter wurden vom Volke zu seinen Gebietern erwählt. Diese erbauten sich auf dem Kampfplatze eine Burg, die sie nach dem Drachengeschrei „Geldern“ nannten. Auf dem Rathause in Erkelenz wird heute noch eine Beschreibung des Kampfes und der Geschichte Gelderns gezeigt, auf deren Titelblatt ein gewaltiger Drache abgebildet ist, der aus seinem Rachen die Worte „Gelre, Gelre“ ausstößt.
Für die Geschichte Gelderns ist die vorstehende Sage von einiger Bedeutung; denn jedenfalls hat sei einen geschichtlichen Hintergrund. Geschichtliche Vorgänge, die sich an einem bestimmten Orte abspielen, bleiben an der Örtlichkeit haften und werden sagenhaft verändert und weitererzählt. Und so kann man hier einerseits an das verdienstvolle Handeln der Herren von Pont denken, die durch kostspielige und langwierige Arbeiten die Gegend entwässerten und so von der Fieberluft freimachten. Andererseits hat auch die Meinung des Pfarrers Leopold Henrichs manches für sich. In seiner Schrift „Geschichte der Stadt und des Landes Wachtendonk“, sagt er im 1. Heft, S. 9: „Die Bewohner des Niederrheins hielten am nationalen Heidenthum sehr fest; nur sehr schwer waren sie für das Christenthum zu gewinnen, und dieser harte Kampf und der Sieg des letzteren spiegelt sich wieder in der Sage De draak van Pont.“
Die Drachensage ist schon früher in gebundener Rede dargestellt worden. Möge sie in dieser Form kurz wiedergegeben werden:
Vör dausend johr, du häd ze Pont,
ens enen lelken draak gewohnt.
Et woer en bies, so fies on kwoet,
dat diere on ok mensse froet.
De schieper und de möhleknäch und
buere van de Klus,
die froet hen van de landstraat weg als
woors on kappesmus.
He froet so soep, wat stand on kroep.
De graaf von Pont, den häd twie söhn,
die finden dat mar niet vör schöen,
sie sochten: „Vader, lot ons luepe, dat wej
den riesendraak os kuepe.“
On vader soech: „Joe, sapperloet, Jongens
haut das biest maar duet.“
On op de schliepstähn komm de greep,
de onnere sabel schleep,
ok vader gruete dolch, wont – sterve sik
de molch!
Maar onderdes den draak trok los und
froet wat hen mar kriege kos:
Et pock met de klock, de maid met de gaid,
des fes van de desch, et salt met et smalt,
de schenk met de speck, joe, et fuer noch
ut de poggenbeck.
De twie, die dar maar niet gefiel, die wosse
wo hen den uhren hiel.
Na den eten ging et aan, jerss noch elkes na de kran.
Salt on bottrame en de tas, enne kluere enn de fuselflass,
so trocke sej de burg heronder, op de joch
na de lelken donder.
Sagskes kroppe sej op den buck, komme
glücklek naa de struck,
wo sej ohne fruete gefoer kieke kosse woj
hen woer.
Podemme noch, war es denn dat?
Sej soege, dat onder de mespelboom wat sat.
Et woer en dier net te beschrieve; wenn he
niet schliep, woj solle we blieve?
Nauw gaukes drop nauw wört et tied,
ok de scheld noch an de siet,
nauw sent sej al onder de buem, on de
draak leht in den druem.
Paaftig – schlont sej öm op de kopp, maar
den draak, den sprengt gauw op.
Lewen hiet et nauw of duet, gefreten – of
den draak kapott.
Hen schleet de scheld ör ut de hand,
tezamme legge sej in de sand.
Schrumstig sint sej weer op de bien, na
dat biest krazt met de tien,
speit füer ut sin mull, maar de twie sind
ok niet ful,
legge salt op sine start on boortenöm de greep
van ochter in het draakenhart, dat hem de uege kneep.
Dat dier wie ene pier krömte sich van ping,
de ruck met buch, schlug hart met de
start, on speite flammlüer.
Den draak, den ant kapott goen woer,
riep dreimol „Gelre!“ hell und kloer,
schnött noch dreimol met de schnütt, on
et leve woer drütt.
De wie, de dochter drover noer, war dat
doch met das „Gelre“ woer.
Wäts do wäl, sät den ene, wej welle hier
sofort begenne.
Wej bauwe en bourg on stadt.
On met de fläs in de tas begoste se
Geldern te bauwe.
Wont den draak, dar fiese bies, den woer
ja nauw kapott gehauwe.
(Übersetzung: Der Drache von Pont – Vor tausen Jahren hat in Pont einst ein fruchtbarer Drache gewohnt. Das war ein so gemeines und böses Biest, das Tiere und Menschen fraß. Den Schiffer und den Mühlenknecht und Bauern vom Land fraß er von der Landstraße weg wie Wurst und Kohl. Er fraß und soff, was stand und kroch.
Der Graf von Pont hatt zwei Söhne, denen gefiel das gar nicht. Sie sagten: „Vater lass uns losgehen, wir wollen uns den Riesendrachen kaufen.“ Und der Vater sagte: „Ja, Sapperlot, Jungs, haut das Biest nur tot.“
Auf den Schleifstein kam die Mistgabel, dazu wurde der Säbel geschliffen, und Vaters großer Dolch, denn: „Sterben muss der Molch!“ Aber der Drache zog derweil los und fraß alles, was er kriegen konnte: Kücken und Glucke, Magd mit Ziege, den Fisch vom Tisch, Salz und Schmalz, den Teller mit Speck, ja sogar das Futter aus dem Schweinetrog.
Die zwei, denen das gar nicht gefiel, wussten wo er Mittagschlaf hielt. Nach dem Essen ging es los, erst mal schnell noch einen trinken. Salz und Butterbrote in die Tasche, einen Klaren in die Schnapsflasche, so zogen sie aus der Burg, auf der Jagd nach dem gemeinen Quälgeist. Langsam krochen sie auf dem Bauch dahin, kamen glücklich zu dem Strauch, wo sie ohne Gefahr nach ihm Ausschau halten konnten. Verdammt noch mal, was ist das denn? Sie sahen dass etwas unter dem Mispelbaum saß. Es war ein unbeschreibliches Tier, wenn es nicht schläft, was wird dann aus uns?
Also schnell drauf, wir haben nicht viel Zeit, noch den Schild heben, schon sind sie unter dem Baum, der Drache träumt noch. Paff! Schlagen sie ihm auf den Kopf, aber der Drache springt sofort auf
Jetzt hieß es, Leben oder Tod, gefressen, oder der Drache kaputt. Er riss den Schild aus der Hand, beide lagen im Sand, sind schon wieder auf den Beinen, aber das Biest kratzt mit den Zehen, speit Feuer, aber die beiden sind auch nicht faul, sie streuten ihm Salz auf dem Schwanz und bohrten ihm die Mistgabel von hinten ins Drachenherz, dass er die Augen zusammenkniff. Das Tier krümmte sich wie ein Wurm vor Schmerz, zuckte mit dem Bauch, schlug mit dem Schwanz und spie lodernde Flammen. Der Drache, der im Sterben lag, rief dreimal hell und klar „Gelre“, schnaubte noch dreimal und das Leben war zu Ende. Die beiden, die dachten darüber nach was dieses „Gelre“ wohl zu bedeuten hätte. Weißt du was, sagte er eine, wir fangen hier sofort an. Wir bauen eine Burg und eine Stadt, und mit der Flasche in der Tasche beschlossen sie, Geldern zu bauen. Denn den Drachen, das fiese Biest, hatten sie ja jetzt kaputtgeschlagen.)
Viele Sagen mit geschichtlichem Hintergrund knüpfen sich an die Bauten der Vergangenheit. Besonders die Burgruinen mit ihrem zerfallenen Gemäuer sind geeignet, die Sagenbildung anzuregen. Auch im Kreise Geldern gibt es manche Burgsagen. Die Sache „Die Ruine von Wachtendonk“ schildert uns die Erlebnisse eines Wanderers, der vor vielen Jahren in die Trümmer der „alten Wachtburg“ eingedrungen war. Voll Staunen betrachtete der Eindringling die gewaltigen Grundmauern, die, vom Alter ergraut, doch noch Jahrhunderte überdauern konnten. Heilige, unheimliche Stille umgab den Einsamen, kein Geräusch von draußen drang durch die gewaltigen Mauern. Klopfenden Herzens stieg er die halbverfallenen Stufen in das Gewölbe hinab. Da erklangen hinter dem Wanderer feste Tritte. Bestürzt schaute er sich um. Sein Herz schlug hörbar. Zitternd zwängt er sich in eine Mauernische. In goldstrahlender Rüstung schreitet ein Ritter an ihm vorbei. Drohend ist sein Antlitz, fahl sind seine Wangen, glühend seine Augen. Vergebens scheint er etwas zu suchen. Plötzlich ruft er aus:
„Ein Fremdling bin ich gar auf eigenen Fluren, die Winde wehn mir meine Asche fort!
Wo Grafen kühn zu meinem Banner schwuren, wo Harf und Becher klangen im Saale dort, da ist dem Ahnherrn, ach, von all den Lieben, nur die Erinnerung einsam überblieben.“
Darauf verschwand die Erscheinung. Allmählich erholte sich der Fremdling von seinem Schrecken. Leise huschte er aus dem Gewölbe, ohne sich noch einmal umzusehen, eilte er empor und freute sich, als er über sich die Kronen der Bäume erblickte und der Wind ihn umsäuselte. Jetzt erst überdenkt er das Erlebte. Er gedenkt der stolzen Ritter, die einstens mit Kraft auf dieser Burg schalteten, der Ritter, deren Ahnherrn er soeben gesehen hat. Alle sind dahingesunken, kaum, dass die Geschichte ihre Namen noch kennt. Und von ihrem einst so stolzen Stammsitze tragen nur mehr Trümmer in die Lüfte empor, und diese warten, bis auch sie die Zeit verschlingt. – Diese Sage erinnert den Menschen so recht an die Vergänglichkeit alles Irdischen. Die Welt ist ein Kind der flüchtigen Zeit. Der Mensch vermag die enteilenden Stunden nicht aufzuhalten. Nur kurze Zeit verweilt er hier auf Erden, was nützt ihm da auf die Dauer der Besitz irdischer Güter?
„Glas ist der Erde Stolz und Glück, die hohe Steinwand springt zu Fall, in Splitter fällt der Erdenball …“
Eine andere Sage versetzt uns zurück in die wilden Zeiten des Faustrechtes und des Raubrittertums. Vor Zeiten hausten in Wetten auf der starken Gesselburg trotzige Ritter, welche die Gegend weit und breit unsicher machten. Auf einem nächtlichen Raubzuge hatten sie einst eine ahnungslose Burg überfallen und alle Bewohner niedergemetzelt. Nur die Tochter des überfallenen Burgherrn wurde von den Mordknechten verschont und heimlich weggeführt. Sie sollte die Gattin eines Raubritters werden. Das Mädchen weigerte sich, einem Mörder die Hand zu reichen, der noch zudem den Tod ihrer Eltern und Verwandten auf dem Gewissen hatte. Um sie gefügig zu machen, wurde sie in einen Turm eingesperrt. Aber das Mädchen blieb standhaft. Als der Ritter sie eines Tages in sein Gemach hatte führen lassen und sie zum letzten Male fragte, weigerte das Mädchen sich wie zuvor. Da ergrimmte der Ritter so sehr, dass er sein Schwert zog und das wehrlose Mädchen meuchlings ermordete. Die Leiche wurde heimlich begraben, und damit schien die Angelegenheit abgetan zu sein. Aber nichts ist so fein gesponnen, es kommt doch endlich ans Licht der Sonnen! Siehe, eines Tages war an der Außenwand der Burg ein großer roter Fleck an der Stelle, wo das Zimmer sich befand, in dem die Unschuldige hingemordet war. Das Blut war durch die Mauer gedrungen. Vergebens suchte man die Wand reinzuwaschen, der rote Fleck wurde immer deutlicher, ja selbst das Wasser, mit dem er abgewaschen werden sollte, wurde zu Blut. Bald wurde dies in der Umgegend ruchbar. Man ahnte den Zusammenhang. Jetzt wusste man, wo das Mädchen geblieben war, von dem man seit Zerstörung der väterlichen Burg keine Kunde mehr vernommen hatte. Der Himmel selbst hatte die Untat geoffenbart. Das Volk von Wetten war über diese Schandtat der Ritter erbittert, aber in seinem ohnmächtigen Zorn konnte es nur die Rache das Himmels auf das starke Raubnest herabrufen. Diese traf auch ein. Wie die Geschichte berichtet, wurde die Burg „Gestelen“ im Jahre 1584 durch die Staatischen eingenommen und in Brand gesteckt. Das Geschlecht der Raubritter starb aus. – Diese Sage will den Menschen mit Abscheu vor einer solchen Freveltat erfüllen und dem Frevler Angst und Schrecken einflößen; der Mensch soll stets bedenken, dass Gott allgegenwärtig ist und jede, auch die geheimste Tat sieht, und dass er in seiner Allmacht jede geheime Tat offenbaren und strafen kann.
Die Sage von der Freveltat auf der Burg Gesselt wird auch in anderer Form erzählt. Die Raubritter hatten einst auf einer benachbarten Burg ein Mädchen geraubt und hielten dasselbe gefangen. Als Lösegeld forderten sie von dem Vater der Jungfrau Auslieferung der Dienstmannen und Übergabe der Burg. Darauf konnte der Ritter nicht eingehen, er konnte und wollte seine Getreuen, die ihr Leben schon so oft für ihren Herrn in die Schanze geschlagen hatten, nicht ausliefern, selbst wenn er sein Kind dadurch verlieren sollte. Über diese Weisung ergrimmten die Raubritter. Sie ließen das Mädchen mittels einer Kette an der Spitze des Giebels befestigen. Dahin richteten sie eine Kanone, und die arme unschuldige Jungfrau wurde von einer Kugel zerschmettert. Von seiner Burg aus hatte der unglückliche Vater den Tod seines Kindes ansehen müssen. Wie sehr ihm diese übermütige Tat der rohen Ritter auf in der Seele brannte, als der Rächer seiner Tochter aufzutreten vermochte er nicht., dazu war er zu schwach. So blieb der Tod des Mädchens lange Zeit ungerächt. Der blutige Giebel, der noch heute zu sehen ist, und der allein von der ganzen Burg übrig geblieben ist, erinnert an diese grausame Tat jener Raubritter, deren Geschlecht längst ausgestorben ist.
Die Raubritter von Gesselt sollen dem sagenhaften Bunde der Teufelsritter angehört haben. Einstens ging der Teufel über Land und kam in die Niersniederung. Manche stolzen Burgen ragten dort empor, auf denen trotzige Ritter hausten. Das urwüchsige Leben dieser wilden Recken gefiel dem Teufel, und er wusste sich gar bald in deren Burgen Eingang zu verschaffen. Durch allerlei Versprechungen wusste er die Ritter zu gewinnen. Ihre Burgen sollten uneinnehmbar sein, stets sollten ihre Unternehmungen von Erfolg gekrönt sein, und in allen Kämpfen versprach er ihnen Sieg. Dafür mussten die Ritter ihm ihre Seele überlassen. Viele Ritter gingen auf dieses Bündnis ein, und schon bald machten die Folgen sich bemerkbar. Unsägliche Drangsale hatten die Bewohner dieser Gegend von den „Schwarzen Rittern“ zu dulden, bis mit der Gründung der ersten christlichen Kirche in diesen Gegenden der Bund der Teufelsritter sich auflöste.
Nicht so alt wie obige Sagen ist die Sage von Hasepuetje und Grommelvaleer. Dieselbe ist aufgekommen, als infolge der unruhigen Zeiten der spanische Graf Spinola den Bau der Fossa Eugeniana, eines Rhein-Main-Kanals, einstellen musste. Im Anfange des 17. Jahrhunderts ´, um 1626, gehörte das Gelderland zu den Spanischen Niederlanden. Die Spanier suchten nun durch die Erbauung dieses Kanales Handel und Verkehr in diesen Gebieten zu heben. Eine ziemliche Strecke dieses Wasserweges war bereits fertiggestellt, da wurde die Arbeit plötzlich abgebrochen. Bald hatte das Volk den Grund vergessen, aus dem die Arbeit abgebrochen worden war, und das unvollendete, großzügig angelegte Werk barg so manche Rätsel, dass das Volk mit Vorliebe von ihm erzählte. In Holt bei Straelen ist die Fossa Eugeniana sehr gut zu verfolgen, an einzelnen Stellen, besonders an der holländischen Grenze, ist sie sehr breit und tief. Der Kanal führt hier den Namen „Grifft“. Als Erbauer dieser Grifft nennt das Volk zwei reiche Bankiers, Hasepuetje und Grommelvaleer. Die Arbeit zog sich so lange hin und verschlang mehr Geld, als die beiden Unternehmer angenommen hatten. Als sie das merkten und sahen, dass dieses Unternehmen ihr ganzes Vermögen verschlingen würde, da betrogen sie die Arbeiter um den verdienten Lohn und flüchteten sich mit den unterschlagenen Geldern über die holländische Grenze. Die betrogenen Arbeiter waren darob mit Recht empört, und in ihrem Zorn verfluchten sie die Übeltäter. Dieser Fluch ging in Erfüllung. Der Reichtum brachte den beiden Unternehmern wenig Freude im Leben, und nach dem Tode mussten sie in finsteren Nächten auf feurigem Wagen auf den Höhen einherfahren zum Schrecken und zum Unheil für den einsamen Wanderer. So traf die Strafe Gottes diese beiden Männer für ihren Frevel und machte das Wort offenbar: „Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert.“
An dieser Stelle verdienen noch einige Sagen aus der ältesten Zeit des Hl. Römischen Reiches deutscher Nation Erwähnung. Karl der Große, der Gründer dieses Reiches, der vielbesungene große Held des Abendlandes, hat auch der Sagenbildung in unserer Gegend manchen Stoff geboten. Er soll in unserer Heimat durch weise Gesetzgebung und durch strenge Ausführung der Gesetze Ruhe und Ordnung hergestellt haben. Daran erinnert noch das Steinbild, das im Herzog-Adolf-Garten in Straelen aufgestellt ist, und das den „Stärk Hormes“, wie Karl im Volksmunde wohl genannt wird, darstellen soll. Ferner sorgte Karl der Große für die hiesige Gegend durch Anlage von Siedelungen und Straßen. So soll die „Karlstroet“ bei Walbeck ihren Namen von Karl dem Großen empfangen haben. Auch für die Ausbreitung des Christentums in unserer Gegend hat Karl gesorgt. Er gab dem hl. Amandus den Auftrag, in heidnischen Gelderlande das Evangelium zu predigen. Bei seiner Missionsarbeit hatte der heilige Amandus großen Erfolg. Noch heutzutage ist bei Herongen der „Amanduspött“ zu sehen, aus dem der Heilige das Wasser zum Taufen geschöpft haben soll. In wieweit diese Sage nun geschichtlich ist, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls steht die Tatsache fest, dass der hl. Amandus, der Missionar von Flandern und der spätere Bischof von Maastricht, der hier wohl nur in Betracht kommt, bereits um 600 gelebt hat und um 680 in dem Kloster Elno bei Tournai gestorben ist, also ein Jahrhundert vor der Zeit Karls des Großen (Karl der Große regierte bekanntlich von 768 – 814). Nichtsdestoweniger hat der Volksmund diese beiden hervorragenden Persönlichkeiten mit einander in Berührung zu bringen gesucht.
Karl der Große ist ohne Zweifel einer der größten Gestalten, welche die Weltgeschichte kennt. Es ist daher kein Wunder, dass sein Andenken weit über das Grab hinaus fortlebte, und dass sein Volk stets stolz war auf seinen Helden. Als später Friedrich I Barbarossa (regierte von 1152-1190) in seinem Streite mit dem Papste den Gegenpapst Paschalis III begünstigte, war Deutschland anfangs sehr unzufrieden. Es hatte gehofft, Barbarossa würde den Tod des Papstes Victor (+ 20. April 1164) zur Aussöhnung benutzen. Der Kaiser hatte dies auch gewollt, aber der damalige Erzbischof von Köln und Kanzler des Reiches, Reinald von Dassel, wusste die Aussöhnung durch die Aufstellung des Gegenpapstes Paschalis III (1164 – 1168) zu hintertreiben. Um nun Deutschland zu gewinnen, wusste Reinald den Papst Paschalis dahinzubringen, der Kanonisation oder Heiligsprechung Karls des Großen zuzustimmen. Die Verehrung dieses neuen Heiligen verbreitete sich nun namentlich am Rhein. Hier in unserer Gegend wurde bei Straelen eine Statue verehrt, die den hl. Kaiser darstellte und die von den Soldaten Karls des Großen ehemals aus einem großen erratischen Block gemeißelt sein sollte. Diesem Steinbilde wurde nun die Wunderkraft zugeschrieben, dass er allen jungen heiratsfähigen Mädchen, die zu ihm pilgerten, einen Verehrer und Bewerber ins Haus sende. Aus der ganzen Umgegend soll bei Nacht das junge Volk zu dem Steinbilde hingepilgert sein, um die Wunderkraft zu versuchen. Doch – das war einmal, die aufgeklärte Gegenwart soll ja an solche Wunderdinge nicht mehr glauben.
Mit der Geschichte haben mehrere Sagen offenbar nichts zu tun. Diese Sagen haben ihren Ursprung und Hintergrund anderswo. Ein gebirgiges oder hügeliges Land, das zerklüftet oder schwer zugänglich ist, und auch eine weite Ebene mit dichtem, endlosem Wald und weitem trügerischen, träumerischen Moor, wo eine fast unheimliche Ruhe herrscht, die nur kurz unterbrochen wird durch einen Kibitzschrei oder Entenruf, die sind geschaffen für das Reich der Sage. Die hier herrschende Einsamkeit und Schrecknis des Ortes wirken ein auf die empfängliche Menschenseele. Oder auch Gewitterstürme, dichte Nebel und andere Naturerscheinungen bieten Stoff zu Sagenbildungen. So lässt sich wohl eine andere Sage von Hasepuetje erklären, deren Schauplatz ebenfalls die Grifft in Holt bei Straelen ist. Danach war Hasepuetje ein Arzt in Straelen. Einstens wurde er zu einem kranken Bauern nach Holt gerufen. Der Arzt lebte nun mit dem Bauern im Streit. Anstatt einer heilkräftigen Medizin gab er dem Kranken absichtlich einen Trank, der diesen bald ins Grab brachte. Als das durch Zufall ruchbar wurde, ergrimmten die Nachbarn sehr, und der Arzt musste vor ihnen fliehen. Er flüchtete sich auf die Anhöhen an der holländischen Grenze. Dort würden ihm die Erdwälle der Fossa oder Grifft, die Sandhügel und die Moore, „Päddewater un Blanken“ genannt, wohl ein Versteck bieten. Aber die Bauern wussten den Bösewicht ausfindig zu machen und bald waren sie ihm auf den Fersen. Vergebens floh Hasepuetje von einer Anhöhe zur andern, die Bauern waren hinter ihm her und trieben ihn von Höhe zu Höhe der Stelle zu, wo „Druje Greef“ eine etwa 30 Meter breite und 25 Meter tiefe Schlucht bildet. Dort hofften sie ihn zu fangen. Hasepuetje kannte die Gegend nicht so genau, und plötzlich gähnte vor ihm die steile Schlucht.
Was tun? Zurück konnte er nicht mehr. Dort keuchten die ergrimmten Bauern schon von allen Seiten mit Sensen und Dreschflegeln heran. Hinunter konnte er nicht, die Schlucht fiel steif ab. Ein Versteck gab es nicht. Widerstand – er hatte keine Waffe. So stand er da, hilflos, ratlos. Schon hatten die Bauern ihn fast erreicht, die von den Anstrengungen der Hetzjagd noch mehr erbittert waren. Jetzt sahen sie ihn. Da in seiner Not verkaufte Hasepuetje seine Seele dem Teufel, wenn dieser ihn in die Schlucht bringen wollte. Ein Anlauf, ein Schrei – und Hasepuetje stand wohlbehalten auf der anderen Seite. Höhnisch lachte er den Bauern zu und rief hinüber, sie sollten es ihm nachmachen. Aber seine übermütige Freude sollte nicht lange währen. Sofort beanspruchte der Teufel die Seele. Bereits in der folgenden Nacht begann die Strafe für den Mörder. In feurigem Wagen, eine glühende Pfeife im Mund, fuhr er über die Höhen und setzte immer wieder über die Schlucht, gleichsam ein zweiter Ahasver, der beim Hinübersetzen gern den Hals brechen möchte, um Ruhe zu haben. Aber vergeblich, denn ewig soll er keine Ruhe finden. – An der Stelle, wo Hasepuetje über die Schlucht setzte, sollen die Fußstapfen noch heute zu sehen sein, und die Höhe heißt noch heute „Hasepuetjes Berg“.
Wie tief die Sagen um Hasepuetje sich beim Volke eingebürgert haben, möge eine kleine, wahre Episode zeigen. Eines Tages war ein Arzt aus Straelen zu einem Krankenbesuch nach Arcen gefahren, von dem er erst spät heimkehrte. Auf dem Heimwege blieb sein Pferd gerade in der Talsenkung stehen, welche die Landstraße bei der Durchquerung der Fossa bildet. Wahrscheinlich hatte das Tier gemerkt, dass sein Herr im Wagen schlief, und so benutzte es die Gelegenheit, sich auszuruhen, bevor es die vorstehende Höhe erklomm. Wahrscheinlich war dieser Vorfall von einem spät heimkehrenden Arbeitsmanne beobachtet worden. Am folgenden Morgen hieß es dann: „Vanne Nooch es den Docter an Hasepuetje angeholde worde.“
„Gott lässt seiner nicht spotten.“ In der Nähe von Capellen liegt tief im Walde versteckt der „Geistberg“. Vor Zeiten sollen hier stattliche Zinnen und Türme aus Waldesgrün hervorgeschaut haben; denn auf dem Geistberg stand das Schloss eines berühmten Rittergeschlechts. Der letzte Spross desselben war ein übermütiger, jähzorniger Herr, der es auch mit dem Kirchenbesuch nicht sehr ernst nahm. An einem bestimmten Tage erschien er aber regelmäßig zur Messe, das war Tag, an dem das Seelenamt für seine verstorbenen Eltern gelesen wurde. Als der Tag wiederum einmal gekommen war, da rüstete er sich für einen Jagdzug aus, gleich nach der Messe wollte er dem edlen Waidwerk obliegen. Weil er sich bei der Ausrüstung etwas verspätet hatte, eilte er mit Armbrust und Hunden sogleich zur Kirche. Doch die Feier hatte bereits begonnen, der Priester hatte zur bestimmten Zeit mit dem Seelenamte angefangen. Als der Graf das sieht, nimmt er voll Zorn, dass man sein Erscheinen nicht erst abgewartet habe, die Armbrust und erschießt den Priester am Altare. Für diese Freveltat ließ die Strafe Gottes nicht lange auf sich warten. In der Nacht brach ein furchtbares Unwetter los. Blitze zuckten hernieder, der Donne krachte, Bäume wurden durch den Sturm entwurzelt. Als das Gewitter endlich ausgetobt hatte und nach einer langen, bangen Nacht der Tag anbrach, da war das Schloss verschwunden. Ein kleiner Schutthaufen zeigte die Stelle, wo es gestanden hatte. So benutzte Gott die Natur, um das unschuldig vergossene Blut seines Dieners zu rächen.
Zu den Natursagen gehört auch die Sage von der „Düwelt“. In dem alten Walbecker Kirchturm hing vor Zeiten ein schönes Glockenspiel, das von der Hand eines kundigen Meisters geschaffen war, zur Ehre Gottes und zur Freude der Bewohner von Walbeck. Denn herrlich erklang das Geläute an hohen Festtagen durch die morgendliche Stille. Eines Morgens waren die Glocken verschwunden. Lange suchte man sie vergebens. Endlich fand ein biederer Landsmann sie in einer Bauerschaft zwischen Walbeck und Twisteden. Aber wer hatte die Glocken aus dem Turm geschafft, und wie kamen sie in diese einsame Gegend? – Menschen konnten die Tat nicht so still ausgeführt haben, dass weder Pfarrherr noch Küster etwas gemerkt hatten. Hier hatte offenbar eine höhere Macht gewaltet, und das war offenbar der Teufel. In dem Turme konnte man die Löcher gut sehen, die der Satan mit seinen Pranken in die Turmwände geschlagen hatte, um bei seiner Arbeit festen Halt zu haben. Und die Bauerschaft, wo die Glocken aufgefunden waren, war in alter Zeit als Tanz- und Tummelplatz des Teufels bekannt. Nur mit Schaudern und Furcht zog der Wanderer durch die dunkeln Tannenwälder jener Ortschaft, und wenn die Zeit es ihm gestattete, machte er lieber einen kleinen Umweg, um jene schreckliche Gegend zu vermeiden. In Walbeck aber herrschte große Freude, als man meldete, die Glocken seien aufgefunden. Unter Beteiligung der ganzen Einwohnerschaft wurden dieselben im Triumphe zurückgeführt. Zur Erinnerung an diese Begebenheit führt die Gegend nordwestlich von Walbeck noch den Namen „die Düwelt“.
Noch verschiedene Stellen im Kreise Geldern bezeichnet der Volksmund als Tummelplatz des Teufels. So war an einer Landstraße in der Nähe von Sevelen ein Schlagbaum, dort soll der Teufel lange Zeit sein Spiel getrieben haben. So wird erzählt, jeder Wagen, der nachts dort vorbeifuhr, sei von einer unsichtbaren Gewalt angehalten worden, und Pferd und Wagen hätten sich dreimal im Kreise herumdrehen müssen, ehe der Weg fortgesetzt werden konnte. Um nun diesen Spuk zu bannen, sollen früher die nächsten Anwohner daselbst ein geweihtes Kreuz errichtet haben. Dadurch sei die Macht des Teufels gebrochen worden. Solche und ähnliche Schauermären sind vielfach verbreitet. Fast jeder Kreuzweg und jedes Wegekreuz hat seine besondere Sage. So herrscht im Volke vielfach der Glaube, dass an den durch Kreuze bezeichneten Wegen Priester von Strauchdieben überfallen und ermordet seien. Die Seelen der Mörder aber könnten nach dem Tode keine Ruhe finden und müssten an der Stelle, wo die Freveltat geschehen sei, „umgehen“. Manche dieser Sagen finden ihre Erklärung in der Abgelegenheit und Schrecknis des Ortes und in dem Aberglauben des Volkes; denn wenn man sich genauer erkundigt, findet man fast immer, dass die betreffende Stelle durch ein Kreuz gekennzeichnet ist, weil dort einmal vor Jahre ein Unglücksfall vorgekommen ist, oder dass fromme Seelen an geeigneten und landschaftlich schönen Stellen Kreuze aufgestellt haben, um etwa den Sinn des Wanderers auf Gott zu richten und ihn daran zu erinnern, dass er ein zwiefacher Waller ist, ein Wanderer von einer Stadt zur andern und ein Pilgrim aus dem Reiche der Zeit in das der Ewigkeit.
Schuld erfordert Sühne. Jeder Mensch muss für seine Vergehen büßen, durch opferwillige Buße lässt sich die Gottheit versöhnen. Diese Gedanken bringt folgende Sage zum Ausdruck: Südlich von Straelen, in der Bauerschaft Zandt, erhebt sich mitten in der Ebene ein kleiner Hügel. Ringsum ist er von kleinem Buschwerk umkränzt, und seine Spitze wird von drei Eichen gekrönt. Dieser Hügel ist in alten Zeiten von einem Mönch aus dem benachbarten Kloster Zandt zusammengefahren worden, und zwar mit einem Schubkarren. Der Mönch hatte gelobt, einen Kreuzzug ins hl. Land mitzumachen, doch hatte er die Gelegenheit dazu verstreichen lassen. Der Vater der Christenheit sprach ihn nun von seinem Gelübde zwar frei, aber zur Strafe für seine Bequemlichkeit musste der Mönch den Hügel zusammenfahren. Der bereits bejahrte Mann nahm es mit dieser Bußübung recht ernst. Ohne Rast und ohne Ruh arbeitete er, um den „Kalvarienberg“ noch vor seinem Tode zu vollenden. Und als er den letzten Schubkarren Erde angefahren und auf dem Gipfel des Hügels drei Eichen gepflanzt hatte, da brach sein müdes Auge. Seine Lebensaufgabe hatte er erfüllt. Gott der Herr im Himmel nahm die Seele seines bußfertigen Dieners zu sich in den Himmel, die sterblichen Überreste wurden auf dem Gipfel des Kalvarienberges bestattet.
Jeder Ort im Kreise Geldern hat seine Windmühle und seinen Mühlenberg, die alle mehr oder minder von einem Kranze von Sagen umsponnen sind. So wird von einer Walbecker Mühe erzählt, sie sei in früheren Zeiten der Eckturm eines Ritterschlosses gewesen, in dem der Ritter seine Gefangenen eingesperrt und so lange in Gewahrsam gehalten habe, bis ein hohes Lösegeld für sie gezahlt wurde. Weil der Turm für diesen Zweck bestimmt gewesen, sei er besonders stark gebaut worden, und so habe er das ganze andere Gebäude überdauert und sei bis auf den heutigen Tag stehengeblieben.
Andere Berge beherbergen die Bergmännlein. Solches wird neben andern auch vom Straelener Mühlenberge berichtet, wo vor kurzem noch die alte Mühle, das liebe Wahrzeichen von Straelen, ihre Flügel ragend in die Lüfte streckte. Auch der Berg wird jetzt abgetragen. Als der Beschluss, die Mühle niederzulegen, bekannt wurde, hat Herr Rektor Fr. Brücker der Klage darüber seine Stimme geliehen und in einem schönen Gedicht die Sage des Mühlenberges behandelt. Danach hausten tief im Innern des Berges die Zwerge, die dort einen gewaltigen Schatz zusammengetragen hatten und denselben sorgsam und eifersüchtig bewachten. Lange Gänge führten durch die Erde vom Innern fast bis ans Tageslicht. Mancher kühne Eindringling soll den schimmernden und funkelnden Schatz tief unten im Erdinneren gesehen haben. Ihn zu heben ist keinem gelungen, trotz aller Anstrengungen, die freilich der Schatz wohl wert war, denn:
Wem des Schatzes Fund gelängt, Herr des Landes würd er sein! Wer gewänn den Hort im Berge, wär im Land der reichste Baas! Und das kluge Volk der Zwerge diente ihm an Niers und Maas!
Doch jetzt sind mit der Mühle auch die Bergmännlein und der Schatz verschwunden. Und nur die Erinnerung an dieselben wird im Volke fortleben.
Manche Sagen behandeln Stoffe aus dem alltäglichen Leben. Sie lehnen sich an das gewöhnliche Volksempfinden an, zeichnen die Hauptcharakterzüge der Bewohner der Niersniederung und geben uns einen Einblick in das Denken und Fühlen derselben. Die Grundlage des gelderländischen Volkes ist ein inniges Familienleben. Herzliche, opferwillige Liebe vereinigt Mutter und Kind. Das zeigt die Sage von Girita von Geldern. Die kleine Jutta, Giritas einziges Kind, war im Walde von einem Bären angefallen und so schwer verletzt worden, dass die Ärzte alle Hoffnung aufgaben. Da eilt die geängstigte Mutter in die Kirche und wirft sich vor das Bild der Gottesmutter nieder. Heiß und inbrünstig betet sie zur Mutter des Jesuskindleins:
„O Gottesmutter, erhalte mir mein Kind, du selber hast erfahren, was Mutterleiden sind.“ So fleht sie, und in ihrem Schmerze streckt sie die Hand nach dem Jesukinde aus:
„Und willst du mein Kindlein nicht retten, nehm ich deinen Knaben.“
Und sie nimmt den Jesusknaben aus den Armen seiner Mutter und presst ihn stürmisch an ihr Herz.
Sieh, da neigt sich voller Leben tief der Jungfrau Angesicht, und die Mutter hört mit Beben, was Maria zu ihr spricht: „Aus des Lebens Wermutschalen Bitterkeit dein Herz umfloss, ach, des Mutterherzens Qualen keine so wie ich genoss! – Wohl, dein Kind, es soll gesunden, eh‘ des Morgens Stunde schlägt, aber auch die Spur der Wunden immerfort sein Antlitz trägt. Wie ein mahnendes Gewissen bleibt die Unzier dir zum Harm, weil verzweifelnd du gerissen mir den Sohn vom Mutterarm.“
Die Worte Mariens gingen in Erfüllung. Jutta genas, aber die Wunde behielt sie ihr ganzes Leben lang. Girita war durch dieses Wunder der Gottesmutter tief bewegt. Sie gelobte, auch das bitterste Leiden fürderhin mit Ergebung zu tragen. Und sie hat ihr Gelöbnis treu gehalten. Sie erzog ihr Kind in Gottesfurcht und starb nach einem heiligmäßigen Leben als Vorsteherin des Klosters zu Essen.
„Zuvor getan, hernach bedacht, hat manchen in groß‘ Leid gebracht.“ Übereifriges Handeln in wichtigen Angelegenheiten ist unverzeihlich, denn es kann einen Schaden anrichten, der nicht mehr gut zu machen ist. – Dem Grafen von Knesebeck zu Frohnenbruch waren mancherlei Wertsachen entwendet worden, und eine Magd wurde des Diebstahls bezichtigt. Obwohl die Magd ihre Unschuld beteuerte, schenkte der Herr ihr keinen Glauben. Jeder Frevler beteuere seine Unschuld, sie solle das gestohlene Gut herbeischaffen, sonst lasse er sie enthaupten. Und als das Mädchen bei der Beteuerung seiner Unschuld beharrte, ließ der Graf die Arme zum Richtplatz schleppen. Bevor aber ihr Blut geflossen, sprach sie den Fluch aus über den Ritter und sein ganzes Haus. Dann sank ihr Haupt unter dem Schwerte. Kaum war die Hinrichtung geschehen, da überbringt ein Arbeiter dem Grafen ein Rabennest, in dem der vermisste Schmuck sich befand. Beim Fällen eines Baumes hatten die Arbeiter das Nest gefunden und so den Dieb entdeckt. Als der Graf das sah, erfasste ihn jähes Entsetzen. Vergebens bereute er sein vorschnelles Handeln. Der Fluch des Mädchens fällt ihm ein, und bange Sorge um die Zukunft erfasst ihn. Es leidet ihn nicht mehr auf seinem Gute, für immer verlässt er Frohnenbruch. Einsam verbrachte er den Rest seines Lebens. Der Gedanke an das unschuldige Mädchen ließ ihm keine Ruhe. Er starb einsam und verlassen, und mit ihm ging sein Geschlecht zu Ende.
Ein Stück volkstümlicher Rechtanschauung liegt in der Strafe, die den Grenzfrevler trifft. Nach dem Tode muss er „umgehen“, mit dem Stein auf der Schulter, den er versetzt hat. In Straelen lebte vor Zeiten ein Mann, der es mit dem Eigentum der Nachbarn nicht genau nahm. Einstmals in einer dunklen Nacht stand er von seinem Lager auf und versetzte die Grenzsteine zwischen seinen Äckern und denen der Nachbarn. Doch nicht lange sollte er an dieser unredlichen Vergrößerung seines Besitztums Freude haben. Der Schlag rührte ihn, und bald weilte er nicht mehr unter den Lebenden. In seinem Grabe konnte der Unglückliche keine Ruhe finden. Stets drückte ihn das unrechte Gut, das er sich erworben hatte, und von dem jetzt seine Nachkommen ernten würden zum Schaden der Nachbarn. In der Geisterstunde verließ er sein Grab, das ihm zu eng wurde. Er eilte zu dem Acker und grub den Grenzstein aus. Bei dieser Arbeit wurde er von Leuten gesehen und beobachtet. Da sah man denn, wie der Unglückliche den schweren Stein auf seine Schulter lud und die Grenzfurchen entlang lief, indem er stets die Worte wiederholte: „Woe loet eck de Poel, woe loet eck de Poel?“ In den folgenden Nächten wiederholte sich der Vorgang. Die Unruhe des armen unglücklichen Mannes ging den Nachbarn zu Herzen, und sie beratschlagten, wie ihm zu helfen sei. Sie stellten an der Stelle, wo der Grenzstein rechtlich hingehörte, ein kleines Holzkreuz auf, auf dem die Worte standen: „Set de Poel doe neer, woe hen hergehört.“ Als die unglückliche Seele in der folgenden Nacht dieses Zeichen und die Worte sah, eilte sie dort hin, grub den Stein ein und verschwand. Das Kreuz war verschwunden, und die Seele wurde nicht mehr gesehen. Sie hatte endlich die Ruhe des Grabes gefunden.
Die Kinder dieser Welt sind oft sehr klug in ihrer Art. Die Wahrheit dieses Wortes zeigt folgende Sage: In der Nähe von Hinsbeck lebte vor geraumer Zeit ein Bauer, dessen Hof ganz verschuldet und in überaus schlechtem Zustand war. Eines Tages ging er über Land und dachte nach, wie er wohl zu einem neuen Hofe kommen könnte, oder wie er wenigstens aus seiner misslichen Lage befreit würde. Als er so mit seinen Gedanken beschäftigt war, stand plötzlich ein feiner Herr vor ihm, der sich voll Mitgefühl nach dem Grunde seines Kummers erkundigte. Und als der Bauer ihm seine missliche Lage offenbart hatte, da meinte der Herr, ihm wohl helfen zu können. Er selbst wolle ihm das nötige Geld für einen schönen neuen Hof verschaffen. Dafür sollte der Bauer ihm seine Seele verschreiben. Doch dieser war damit nicht einverstanden. Er ahnte wohl, welchen „Herrn“ er vor sich hatte, und er dachte, dieser Meister der schwarzen Kunst könne ja jeden Augenblick seine Seele von ihm fordern. Er äußerte sich daher dem Teufel gegenüber, wenn er sich einen neuen Hof baue, dann wolle er doch in seinem Leben noch recht viel Genuss davon haben, und deshalb solle der Teufel ihm noch eine genügende Lebensfrist gewähren. Nach einigem Hin und Herreden einigte man sich auf vierzehn Jahre. Während dieser Zeit wollten sie sich in die Ernte teilen. In einem Jahre sollte der Bauer alles haben, was über der Erde wachse, und der Teufel alles das, was unter der Erde wachse. Im folgenden Jahre sollte es dann umgekehrt sein, und so sollte es die vierzehn Jahre hindurch fortgehen. Da war der Bauer zufrieden. Er dachte: Kommt Zeit, kommt Rat. Und wenn das Jahr kam, wo der Teufel die Ernte über der Erde haben sollte, da pflanzte der Bauersmann Kartoffeln, Möhren, Rüben, also alles, was unter der Erde wuchs. Im andern Falle baute er Kappes, Salat an und säte Gemüse. So ging der Teufel immer leer aus. Da kam er eines Tages zum Bauern, schimpfte und wetterte und sagte: „So kann es nicht weitergehen. Wir wollen einen Wettkampf eingehen. Wer einen Stein am weitesten werfen kann, der soll der Sieger sein, dem soll der Hof gehören.“ Dem Bauern klopfte das Herz, als er das hörte. Doch er dachte, den Teufel vielleicht noch einmal überlisten zu können und so auch seine arme Seele zu retten. So ging er denn auf dem Vorschlag ein, freilich zitternd und zagend. Der Teufel sah die Angst des Bauern und lachte höhnisch in seiner stolzen Siegeszuversicht. Er dachte nicht daran, dass der Verstand des Bauern fieberhaft arbeitete, um einen Ausweg aus dieser furchtbaren Lage zu finden. Da blitzschnell steht ein ganzer Plan vor der Seele des Landmannes. Der Bruder des Bauern, ein frommer Mann, stand als Feldgeistlicher in der Fremde beim Heere. Der Umstand musste ihn retten. Der Teufel hatte sich einen gewaltigen Felsblock gesucht, den schleuderte er fort, wohl eine Meile weit, bis auf den „Bosberg“. Jetzt war die Reihe an dem Bauern. Soweit konnte er natürlich nicht werfen. Nichtsdestoweniger suchte er sich einen schönen, glatten Stein. Dann trat er ruhig vor den Teufel hin und sprach: „Mein Bruder weilt im Kriege, ich weiß aber nicht, wo er sich gegenwärtig befindet, ob in Holland oder Belgien oder Frankreich. Wenn ich den nur nicht tot werfe.“ Da wurde der Teufel stutzig, als er den Bauern so ruhig vor sich stehen sah. „Hoho“, sagte er, „wenn du so weit werfen kannst, dann versuche es nur gar nicht. Den Hof will ich dir überlassen. Denn wenn du deinen Bruder träfest, würde der straks gen Himmel fahren. Den habe ich nämlich noch nicht genügend bearbeiten lassen.“ – „So“, sprach der Bauer, „du hast mir den Hof überlassen. Jetzt will ich dich hier nicht mehr sehen.“ Da sah der Teufel ein, dass er, der Vater der Lüge, sich zweimal hatte übertölpeln lassen. Fluchend und zähneknirschend machte er sich von dannen. Der vom Teufel geworfene Stein auf dem Bosberg (Buschberg) hat den Namen Teufelsoder Blutstein erhalten. Wenn man denselben mit einem härteren Gegenstand verwundet, soll Blut herausfließen.
Verhängnisvoll kann der Teufel denjenigen werden, die sich übermäßig und leidenschaftlich dem Kartenspiel hingeben. Er stachelt die Leidenschaft der Spieler an, spielt bisweilen selbst mit und gewinnt Hab und Gut und Seele der Spieler: Einst saßen drei Bauern in der Sylvesternacht im „Schwarzbruch“ bei den Karten und spielten um hohes Geld. Die Leidenschaft leuchtete ihnen aus den Augen. Da kam ein vierter hinzu, ein unbekannter, unheimlicher Geselle. Gar bald war er am Spiele beteiligt. Immer höher wurden die Einsätze, von den Zehnern gings in die Hunderte, und fast jeder Gewinn fiel dem Unbekannten zu. Wiederum galt es einem großen Einsatz, da fiel einem Bauern eine Karte herunter. Er bückte sich, um sie aufzuheben. Da – leichenblass - kam er unter dem Tische zum Vorschein. Er hatte unter dem Tische bei seinem Gegenüber den Pferdefuß erblickt. Sofort war bei ihm die Spielleidenschaft verschwunden, er wusste jetzt, wer der unbekannte Vierte war. Heimlich ging er hinaus und sagte seiner Frau Bescheid. Und als diese mit Weihwasser und einer geweihten Palme in die Stube trat und den christlichen Gruß sprach, flogen die Fenster auf und der unheimliche Gast war verschwunden. Ein Schwefeldunst erfüllte das Zimmer. Da wussten auch die beiden andern Bauern, mit wem sie gespielt hatten, und nie wieder haben die drei eine Spielkarte angerührt.
Eine andere Überlieferung berichtet, der Teufel habe sich, als er den christlichen Gruß hörte, in einen schwarzen Hund verwandelt und unter Tisch und Bank verkrochen.
Die Sage ist ein Erzeugnis des Volksempfindens, und dieses wird in mancher Hinsicht von der äußeren Natur beeinflusst. So kommt es, dass fast jede Gegend ihre spezifischen, d. h. der betreffenden Gegend eigenen, Sagen hat. Im Moor- und Heideland, in waldreichen Gegenden findet man andere Sagen als in solchen Ebenen, wo vorzugsweise Ackerbau betrieben wird. Und wiederum trifft man Sagen vom Berggeist vorzugsweise in Gebirgen und dort, wo Bergbau betrieben wird. Neben diesen Ortssagen gibt es solche, die Gemeingut einer ganzen Nation geworden sind, sogenannte Nationalsagen. Hier sind vor allem die nationalen Heldensagen zu erwähnen. Der Kern der Nationalsagen ist überall derselbe, nur kommen hin und wieder lokale Zusätze und dialektische Abweichungen vor. Auch bei verschiedenen Völkern kann man vielfach nahe Übereinstimmungen entdecken. Eine solche im ganzen deutschen Vaterlande verbreitete und auch in unserer Gegend wohl bekannte Sage ist die vom Alp oder Mahr.
Diese Sage lässt sich bin in das heidnische Altertum zurückverfolgen. Im altgriechischen Volksglauben finden wir die Schreckgestalten der Empusen, Lamien und Mormolyken. Mormo war bei den Griechen ein geheimnisvolles, gespenstisches Wesen. Empusa nannten sie ein von der Mondgöttin Hekate gesandtes Nachtgespenst. Lamia endlich war die Tochter des Meergottes Poseidon oder Belos. Wegen ihrer Schönheit wurde sie vom höchsten Gott oder Göttervater Zeus zu seiner Geliebten erkoren. Doch darüber war die Göttermutter Hera eifersüchtig, und in ihrem Zorn raubte sie die Kinder der Lamia. Letztere verfiel darüber in Wahnsinn, und in ihrer Rache raubte und tötete sie alle Kinder, die in ihre Hände fielen. Nach diesen drei göttlichen Wesen sind die Mormolyken, Empusen und Lamien benannt worden. Es waren geheimnisvolle, schöne weibliche Dämonen, welche den Jünglingen das Blut aussogen und das Fleisch derselben verzehrten. Auch raubten sie Kinder, und deshalb drohte man Kindern mit denselben. Diese geheimnisvollen Wesen leben in den Sagen und Märchen der Griechen bis heute fort.
Von Griechenland haben diese Sagen sich dann über die ganze Balkanhalbinsel und die Donauländer verbreitet. Hier werden diese Schreckensgestalten Vampire genannt, und man versteht unter denselben Geister von Verstorbenen, die des Nachts ihre Gräber verlassen, um Lebenden das Blut auszusaugen und sich so zu ernähren.
Von hieraus hat der Grundgedanke der Sage sich donauwärts bis nach Deutschland verbreitet. Als Abarten der Vampire kann man die „Nachzehrer“ in der Mark Brandenburg, die „Blutsauger“ in Preußen und den „Gierfraß“ in Pommern bezeichnen. Ein furchtbarer Aberglaube liegt diesen Sagen zugrunde. Man glaubt, auch hier an die verderblichen, totbringenden Nachstellungen von seiten verstorbener Menschen. Wenn ein Familienmitglied dem andern rasch in den Tod folgte oder nach dem Tode eines Anverwandten hinsiechte, so glaubte man an Nachstellungen solcher „Gierfresser“ oder Blutsauger. Und dieser Aberglaube hat manchmal zu entsetzlichen Friedhofsentweihungen und furchtbaren Leichenschändungen geführt. Man glaubte nämlich, solche Unglückliche von den Nachstellungen der Geister befreien zu können, indem man das Grab öffnete und dem Toten mit einem Holzscheite das Haupt abschlug oder ihn mit einem Nagel an seinem Sarg befestigte.
In Süd- und Nordwestdeutschland sind diese Sagen nicht so schauerlich. In Oberdeutschland nennt man die Quälgeister „Schrat“ oder „Schrätele“, auch wohl „Dude“, in Mittel- und Niederdeutschland, besonders auch in unserer Gegend, „Mahr“, „Alp“ oder „Elfen“. Das Wort „Elfen“ ist im 18. Jahrhundert aus dem Englischen in die deutsche Sprache eingeführt worden, für die hochdeutsche Form „Elben“. Die mittelhochdeutsche Bezeichnung hierfür lautet in der Einzahl „Alp“, und dieser Ausdruck ist in unseren jetzigen Sprachgebrauch eingegangen. Die aus dem Englischen stammende Bezeichnung weist darauf hin, dass die Sage in unserer oder wenigstens in einer ihr ähnlichen Form vorkommt. Auch in Dänemark ist die Sage verbreitet. Hieran erinnert der Ausdruck „Erlkönig“. In dem goetheschen Gedichte „Der Erlkönig“ sind solche sagenhafte Geister gemeint, die gern Kinder an sich locken und töten, um in den Besitz der Seelen zu gelangen. Der Ausdruck Erlkönig ist eine unrichtige Übersetzung des dänischen eller- oder elverkonge – Elfenkönig. Sie stammt von dem deutschen Dichter Herder und wurde von Goethe später übernommen.
Das Volk in unserer Gegend erzählt, der Mahr oder Alp sei die Seele eines Menschen, die ihren Leib verlässt, um andere Leute zu quälen. Dieser Quälgeist kommt durch das Schlüsselloch und gleicht einer Schlange. Andere Leute schildern ihn als unförmliches Wesen, das über den Boden dahinrollt. Es fällt den Menschen bei Nacht an, legt sich auf seine Brust und drückt sie dermaßen, dass der Mensch nur schwer Atem holen und sich kaum regen kann. Am andern Morgen erwacht der Gequälte dann aus einem unruhigen Schlaf, vollständig in Schweiß gebadet. Durch verschiedene Verslein kann man den Mahr von sich bannen.
Häufig werden auch Tiere, besonders Pferde, vom Mahr angefallen. Dann kann man sie am folgenden Tage wohl schäumend und schweißtriefend stehen sehen, und im Volksmunde heißt es dann: „Die hat der Mahr geritten.“
Der Sage liegt der Glaube an eine selbsttätige Seele zu Grunde, die ihren Körper verlassen kann. Bei den Menschen, deren Seele als Mahr wandelt, soll bei der Taufe eine Zeremonie vergessen worden sein. Dadurch, dass man den Mahrsüchtigen noch einmal tauft, erlöst man diesen, und von sich selbst hält man den Mahr fern.
An dieser Stelle verdient noch Erwähnung die Sage von der Mittagsfrau oder dem Mittagsdämon. Dieser Dämon, der gewöhnlich eine weibliche Gestalt annimmt, geht im September in der Mittagszeit über die Felder und quält die Arbeiter, die sich zu kurzer Rast dem Schlummer überlassen, mit furchtbaren Träumen oder tötet sie. Die in der Mittagshitze nicht seltenen Unglücksfälle wie Hitzschläge und ähnliche mögen zu dieser Sage Anlass gegeben haben. Dieser Aberglaube ist sehr alt. Jetzt findet man die Sage von der Mittagsfrau hauptsächlich in Nordwestdeutschland, also auch in unserer Gegend; früher war sie besonders bei den Slawen verbreitet. Aber auch im Altertum war diese Sage anscheinend schon bekannt. Bereits im Alten Testament der Heiligen Schrift, im Psalm 90, Vers 6, wird der Mittagsdämon erwähnt. Es ist hier ein bildlicher Ausdruck für „die Seuche, die am Mittag verwüstet“, wie es im hebräischen Text heißt. Damit sind die schädlichen Ausdünstungen gemeint, die auf den Feldern in der Mittagshitze wohl entstehen und Krankheiten hervorrufen können.
Neben den bereits eingeführten Sagen leben in einzelnen Bezirken unserer engeren Heimat noch andere fort. Doch der Kreis, in dem die Volksüberlieferung noch wurzelt, wird mit jedem Jahrzehnt kleiner. Aus den Städten ist die Volksüberlieferung schon längst verbannt. Schauen wir nur einmal auf das Volkslied. In früheren Zeiten, vor einem halben Jahrhundert, war in unserer Heimat das volkstümliche Lied noch beliebt und gepflegt. Ältere Leute erzählen gern von der sangesfrohen und sangesreichen Vergangenheit. Bei der Arbeit wurde gesungen, denken wir nur an das „Reeplied“. Und abends nach des Tages Last und Mühe wurde das gesellige Leben erst recht gepflegt. Bald versammelte man sich bei diesem, bald bei jenem Nachbarn zu lustiger Unterhaltung und fröhlichem Gesang. Die Frauen spannen und strickten, die Männer rauchten eine Pfeife, und dabei wurden dann die beliebten Volkslieder gesungen. Mögen hier zwei zum Beispiel angeführt werden, und zwar ein weltliches und ein geistliches Lied. In dem ersten, das bei alten Leuten noch wohl bekannt ist, wird in der Anfangsstrophe auf den Inhalt hingewiesen. Diese erste Strophe lautet:
„Kommt hier al bey en hoort en klucht, ik sing von Pierlala, en drollig ventje, voll genucht, de vreugt van zyn Papa. Wan in zyn leven is geschied, dat zult gy hooren in dit lied: Et is al von Pierlala.“
Und dann werden in den folgenden Strophen die Streiche des „Helden“ erzählt. Neben den weltlichen Liedern wurden in den hl. Zeiten des Kirchenjahres auch geistliche Lieder gesungen. So vertrat in der Festlichkeit die sogenannte „Poossij“ (Passionsgeschichte) die Stelle des gemeinsamen Rosenkranzgebetes. Die erste Strophe dieses Liedes lautet:
„Hier es et begenn van et bettre lyden, van onze Hier hochgebenediede, den onz von zonden heeft verloest, dat het syn dierbar bloed gekoest, dort Ada wore wey verloere, mar Jesus het ont oitverkoere; hen es va synne thruen gegan, on het vor onz de schold betan.“
Und der Verrat des Judas wird also geschildert:
„Judas het et sehr verdroete, hen geng stroks tut syn soldoete, vor darteg pännenge on hiet mier verkooch hen Jesus, synen hier.“
Dieses Lied bestand, wie erzählt wird, aus 124 Strophen. Jede Mutter lehrte es ihren Kindern. Bisweilen trifft man auf dem Land noch alte Leute, welche die Strophen noch aus dem Gedächtnis hersagen können. Doch das sind längst vergangene Zeiten. Und wie das eigentliche Volkslied aus dem Leben fast ganz verschwunden ist und den neueren Gassenhauern und Operntexten immer mehr hat weichen müssen, so geht es auch bald vielleicht mit den Sagen, wenn sie nicht gesammelt werden. Wenn der Arbeiter abends heimkehrt, dann sehnt er sich nach Ruhe. Die hastende, schnellebige, nach Gewinn strebende Gegenwart verlangt tagsüber seine ganze Kraft, und so ist er abends zufrieden, wenn er Zeit findet, eben aus der Zeitung die Tagesneuigkeiten zu ersehen und ein wenig Politik zu studieren, die ihre Wellen bis in das entfernteste und einfachste Hüttlein schlägt. Der so nüchterne Sinn ist heute fast nur mehr auf das Nützliche und Praktische gerichtet. Wo sollte man da die Zeit zum Singen und Erzählen hernehmen?