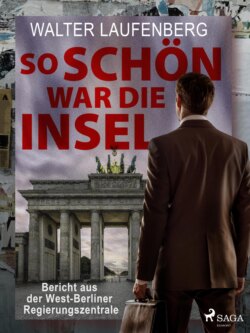Читать книгу So schön war die Insel. Bericht aus der West-Berliner Regierungszentrale - Walter Laufenberg - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7.
ОглавлениеAuch der Büroalltag will gelernt sein. Dr. O. Schmitt versteht, daß man viel verstehen muß, was so nicht gesagt wird. Vor allem aber muß man es verstehen, ständig auf intelligent wirkende Weise zu sprechen, ohne zu verraten, was man denkt. Gerade mit den schönsten Gedanken darf man sich nicht schmücken. Sie sind wie das schon fertige Brautkleid der sitzengebliebenen Heiratskandidatin: nur hinter geschlossenen Fensterläden aus dem Karton zu holen.
Meine Kollegen, sie gehen wie unter Drähten, versucht Schmitt seine Eindrücke zu verarbeiten. Wie die Trolleyhunde an der Grenze. Besser noch: wie die Kontrollgänger der Elektrizitätswerke. Mit ihren prüfenden Blicken angebunden an die Überlandleitung hoch über ihnen, in ein energieknisterndes Spannungsfeld eingehüllt, das bei jedem Schritt mitgeht. Mit durch das Land, katasterignorant über Gräben und Zäune hinweg, sich nicht um Markierungen und Begrenzungen kümmernd, nicht um Kühe, Katzen, Köter. Sie gehen und gehen und leben nur dem einen Auftrag: zu gehen. Sie haben nur die Drähte und die Masten im Auge, sehen die einen an den anderen hängen und machen sich keine Gedanken darüber, daß die Masten auch an den Drähten hängen. Sie finden Drähte und Masten in Ordnung, und mehr sollen sie auch nicht finden. Das kommt dann ins Berichtsheft: Alles in bester Ordnung, keine Beschädigungen, keine gefährlichen Vorrichtungen, keine störenden Hindernisse. So erfüllen sie ihre Aufgabe, meine Kollegen. Schon imponierend.
Ich brauche wohl noch einige Zeit, muß Orpheus sich eingestehen, um zu verstehen, was hier eigentlich gespielt wird. Oder wird hier gar nicht gespielt? Unsinn. Man muß nicht gleich alles ernst nehmen, was so gewichtig daherstolziert, daß es einem komisch vorkommt.
Die Kollegen, die so gesetzt wirken – ja, gesetzt, das scheint ihm der exakt richtige Ausdruck –, und der Regierende Bürgermeister, der wie der Hauptgewinn in einer Tombola auftritt, sie lassen ihn immer wieder mit dem Begriff Karriere ringen, wie Jakob mit seinem Engel. Klammheimlich fühlt er sich für Höheres prädestiniert. Schon daß ich noch ziemlich weit unten bin auf der Karriereleiter, beweist doch, daß es nur aufwärts gehen kann mit mir. Das ist das Faszinierende an der Leiter, versteht er: Man braucht sie nur so zu sehen, wie sie sein soll.
Leiter oder nicht Leiter, – immer wieder steht Orpheus vor dem mannshohen Spiegel in seinem Apartment, steht da ohne alles, und sucht herauszubekommen, womit die Natur ihm einen Fingerzeig für seine ganz persönliche Karriere gegeben habe. Sich seinen Platz an der Sonne zu ersitzen, das wäre sicher nicht seine Bestimmung. Dazu gehört ein breiter Arsch, hat er oft genug sagen gehört, ein Arsch, so ausladend – und einladend – breit, daß keiner um ihn herum kommt. Fehlanzeige, stellt er bedauernd fest. Hätte ihm dieser bequeme Weg doch gefallen. Geduld genug hätte er dafür sicherlich. Und wie ist es mit dem Kriechen? Nein. Mit meinen leider etwas asthenisch abstehenden Schulterblättern würde ich überall hängenbleiben. Und radfahren? Er besieht sich seine Beinmuskulatur mit einem nachsichtigen Lächeln. „Mir werden schon die Beine dünn“, sagt er mit Heinrich Heine, „das kommt vom vielen Studieren.“ Und erschrickt über diese Offenheit und nimmt sich fest vor, Heinrich Heine im Rathaus Schöneberg nie zu erwähnen. Aus Rücksicht auf die eine wie die andere Seite. Wenigstens solche krassen Fehler sollte man vermeiden, wenn man in der Regierungszentrale sitzt. Aber was ist mit meinen Ellbogen? Gefährlich spitz sehen sie ja aus. – Doch gehört ein wohltrainierter Apparat von Streck- und Beugemuskeln dazu, wenn sie wirksam werden sollen. Mich strecken? Wozu. Und mich beugen? Nein. Wie er sich auch dreht und wendet vor seinem hohen Spiegel, sich beinahe schlangenmenschartig verbiegt: Er kann das Loch nicht sehen, das als Königsweg der Karriere gefeiert wird. Erst wie er dem Spiegel den Rücken zukehrt und sich ganz tief runterbeugt und durch seine gespreizten Beine äugt, sieht er es. Und erschrickt: so eng. Und so gebückt zu arbeiten, nein, das scheint ihm auf die Dauer doch zu anstrengend. Zudem, überlegt er, lacht er sich selbst aus: Ich bin ja viel zu lang; kaum bin ich meinem Chef richtig hinten reingekrochen, hänge ich ihm schon zum Hals raus.
Nein, er macht es sich nicht leicht, der neue Mitarbeiter in der Senatskanzlei. Dabei sind die Verhältnisse, in die er hineingeraten ist, auch ohne sein Sichwinden in Gedanken, Worten und vor dem Spiegel schon kompliziert genug. Bei ihrer Regierungs- und Verwaltungsarbeit verwechseln die Rathäusler meist energisch mit energieaufwendig. Das kann er nicht leiden. Da muß er gegensteuern. Nur stiekum natürlich. Also das Licht ausmachen, das die Kollegin angelaßen hat, die Heizung abdrehen, die der Kollege auf Dienstreise seinem leeren Schreibtischsessel bietet, und beim Händewaschen sich den Warmwasserhahn verkneifen, nicht mehr als zwei Blätter Papier zum Händetrocknen verbrauchen. Gelobt sei, was hart macht. Wenn mich einer dabei ertappen würde, weiß er, wäre ich gleich als Grüner abgestempelt. Sollen sie mich doch lieber weiter für einen Rechten halten, die lieben linken Kollegen. Für die rechte Führungsclique bleibe ich zum Ausgleich als ein Linker suspekt. Pardon, es ist schon ein Kreuz mit den Parteiabstinenzlern.
Sollen sie von mir halten, was sie wollen. Ich jedenfalls weiß jetzt, daß die Grünen keine Linken sind, wie immer wieder in diffamierender Absicht wird. Das zeigt sich ganz klar an ihrer undifferenzierten Menschenbewertung. Habe ich doch gelesen, daß ihnen jeder, den sie in ein Parlament schicken, einen Facharbeiterlohn wert ist. Diese prokrustische Gleichmacherei hat nichts, aber auch gar nichts gemein mit der verkrusteten Rangordnung der wahren Linken, auf die wir nebenan in der DDR treffen. Die linken Machthaber dort verkaufen uns einen Gefangenen, der Facharbeiter ist, für 40 000 DM, einen Ingenieur oder ähnlich qualifizierten Akademiker können wir für 100 000 DM freikaufen, aber einen Professor nicht für unter 150 000 DM, während Rentner kostenlos abgegeben werden. Um die Kosten der Lager-Haltung zu minimieren.
Aber was habe ich mit grün oder links zu tun? Ich bin weder das, noch dies, noch jenes oder solches. Aber mit den Parteileuten habe ich zu tun. Und mit denen ist es erst recht ein Kreuz. Die mit ihrem generellen Handlungsprinzip: Meine Interessen gegen eure Interessen und das Interesse der Allgemeinheit immer auf den Lippen, aber hier ausnahmsweise einmal hintangestellt, ganz ausnahmsweise natürlich. Immer so. Dieser lästige Zweifel, der Orpheus packt, wenn er seine Arbeit tut, also gerade so richtig funktioniert: Bin ich hier richtig? Von wegen Hand am Puls, offenes Ohr, dem Volk aufs Maul schauen ... und dann gezielt etwas für Berlin tun, für die von der Nachkriegsgeschichte besonders gebeutelten Berliner. Vielleicht ja doch. Da heute der sogenannte gemeine Mann nicht mehr der Mann auf der Straße ist, überlegt er, muß ich ihn da suchen, ihn mir da ansehen, wo er zu finden ist: Der sogenannte gemeine Mann ist heute Büromensch.
Also wären die Büromenschen meine Zielgruppe, folgert er. Und nimmt sie gleich ins Visier: Es sind ja gar nicht die kleinen Vorteile – Kalender und Kugelschreiber und all die Zeitungen und Zeitschriften, die kostenlosen, die Presseübersichten dazu und diverse Informationsdienste –, was diese Tätigkeit am Hofe so angenehm macht. Auch die gelegentlichen Essen auf Einladung oder auf Spesen und die paar netten Besucher, selbst hin und wieder mal kleine Dienstreisen sind es nicht. Orpheus Schmitt kommt allmählich dahinter, daß seine Kollegen im Rathaus Schöneberg durchaus geistigen Genüssen frönen: Dieses Sofort-Reagieren-Können auf ständig wechselnde Fragestellungen, Aufgaben und Probleme, dieses Den-Durchblick-Haben und dieses Entscheidungen-Treffen, auch das Geizen mit sogenanntem Herrschaftswissen, das sind die Genüsse, die hier geboten werden. Zu wissen, was zu tun ist, und es sofort veranlassen zu können, das ist ein Knopfdruck-Glück, das den Vorzug hat, alles abzudecken, die lähmende Langsamkeit der Uhr wie das erschreckend schnelle Wegschmelzen des Kalenders. Aber gute Zeiten haben ihre eigene Not, kann Orpheus seinen Kollegen ansehen. Je besser das Leben, um so größer die Angst, es zu versäumen, und um so verkrampfter der Griff an alle Brüste der Glückseligkeit. Der Ausdruck Verflachung wäre hier fehl am Platz, korrigiert er seinen ersten Eindruck. Da kriegen subalterne Beamte spätrömische Genießerbacken, und König Faruks neuägyptische Leibesfülle drückt Bürostühle. Der rundum beklagte zu hohe Blutdruck ist für Orpheus ein neues Thema, aber ganz klar ein Thema, das sich hören lassen kann.
Fast so prestigeträchtig, wie die Erörterung des Unterschieds zwischen Malt Whisky und Blended Whisky. Im Paternoster, wo Schmitt zufällig mit Vogel zusammengetroffen ist. Auf der Fahrt nach unten. Wie kommt der Mann nur auf Whisky in diesem schnöden Kasten, diesem Bürokratenbagger, der unermüdlich sein Auf und Ab vorführt, als ob er uns was zu sagen hätte. Vielleicht das: hier geht’s rund und führt doch zu nichts. Ein Service, so brauchbar wie lächerlich. Wie meine Arbeit hier. Whisky, Whisky, ja, so muß man es machen: aus dem Stand heraus ein Thema ins Gespräch bringen, das einen wachsen läßt. Wenn es auch nach unten geht. „Man bekommt ihn ja kaum noch irgendwo vorgesetzt, den richtigen Malt“, hört Orpheus aus Kollegenmund. Dann folgen Aufzählung und kritische Würdigung der teuersten Restaurants Berlins. Eine Feinschmeckerzunge leckt genießerisch die Lippen. Leckt sie den Aktenstaub ab? Darüber wird es dunkel, die Whiskykiste schiebt sich zur Seite, fährt in die Unterwelt. Was das Hohelied aus Vogels Mund auf den Whisky nicht stoppen kann. Dunkel. Noch nie bin ich im Paternoster untendurch gefahren, überlegt Orpheus. Und kann doch das leichte Erschauern nicht ungestört genießen. Schon hebt sich das Gefährt wieder, es wird hell, vor ihnen der Parterreflur, fast gleichzeitig springen sie hinaus. Abgang in verschiedene Richtungen.
Kein vernünftiger Mensch fährt untendurch, überlegt Orpheus. Kein Bedarf für besondere Erlebnisse. In dieser „Mahlzeit“-Gesellschaft gilt nur die schnelle und bequem erreichte Beförderung. Natürlich, die Beförderung ist es. Dabei fährt der Paternoster nicht nur nach oben. Ich fahre auch gern nach unten. Weil ich gern auf den freien Kasten von oben warte. Wegen der optischen Faszination: zuerst Füße, dann Beine, dann Hände und Taschen und Papiere, und erst zuletzt die Köpfe sehen zu müssen, diese belanglosen Köpfe. Und schon sind sie weg. Ein Brett schiebt sich vor den Kopf. Und neues Spiel, neues Glück. Dagegen nebenan die von unten, die Hochfahrenden, wie sie scheinheilig die Augen nach oben verdrehen, sich vor einem erheben, über einen hinauswachsen und dafür ruck-zuck geköpft werden, Stück für Stück weiter abgesäbelt bis zu den Füßen. Das zu sehen, dafür muß man in der richtigen Stimmung sein.
Schon ein toller Typ, dieser Vogel, muß Orpheus sich zugeben. Womit er dem Kollegen allein aufgrund seiner Genußfähigkeiten eine gute Note gegeben hat. Der altgediente Regierungsdirektor, ein Aufsteiger aus dem gehobenen Dienst mit routiniertem Kitekatlächeln und ein wenig rausgedrücktem Steiß – vom vielen Duckmäusern –, der in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit eine Art Erster-Offizier-Rolle spielt, erregt schon durch seine Nase Dr. Schmitts besonderes Interesse. Eine Victory-Nase, beste deutsche Handarbeit trotz dieses angelsächsischen Namens. Die Typenbezeichnung leitet Orpheus ab von dem V, das sich auf dem unteren Teil des Nasenrückens abzeichnet. Wie bei Barbra Streisand. Jahrzehntelange Bohrtätigkeit, schön gleichmäßig rechts wie links, hat der Nase ein doppeltes Paar Kotflügel übereinander beschert, was natürlich nicht gerade windschnittig wirkt. Aber weil das Förderprogramm im Falle Vogel, Streisand und Co. weit über den Bereich der Nasenflügel hinausgegangen ist, überhaupt nicht mehr zu halten in seinem Explorationsdrang, hat es der Nase einen Doppelhutzel aufgesetzt, der im Profil vielleicht ein wenig drollig wirkt und an eine Kartoffelnase erinnert. Von vorn gesehen jedoch ein seltsamschönes Gesicht, weil es das Siegeszeichen triumphierend auf der Nasenstumpfe trägt.
Ganz deutlich: Vogel kann mit dieser Nase gut leben. Weniger gut mit seinem Abteilungsleiter Dr. Hecht, wie Orpheus schnell herausfindet. Der eine warnt ihn vor dem anderen, der ihn vor jenem. So weiß Orpheus gleich, zwischen welchen Stühlen er sitzt. Denn dieser Vogel, so erfährt er, war bisher für die Aufgabe zuständig, die jetzt seine sein soll: die Hebung des Images Berlins. Was dem Kollegen an Zuständigkeit verblieben ist, wird mit Koordinierung umschrieben und bleibt im übrigen unklar. Erst allmählich wird Dr. Orpheus Schmitt erfahren, daß der Begriff Koordinierung in diesen Kreisen stets für Entmachtung steht, aber auch, daß nicht jede Entmachtung voll gelingt, weil es bei den verschiedenen Tätigkeiten und Kontakten Erbhöfe gibt, an die mit Rücksicht auf Außenstehende nicht gerührt werden kann. Dr. Schmitts eigene Stellung erweist sich schnell als die eines Puffers zwischen den beiden so unterschiedlichen Nasen. Dabei hilft ihm wenig, daß er sich die wechselseitige Animosität der beiden erklären kann, auf seine Weise, nämlich damit, daß eine Doppelpultnase nun einmal keine Victorynase riechen kann – und umgekehrt.
Orpheus muß sich daran gewöhnen, daß in seiner neuen Umgebung andere Kategorien gelten als in seinem früheren Dasein. Dr. Hecht gibt ihm mit einer abfälligen Bemerkung über Aufsteiger das Sesamöffne-dich zur Erkenntnis. Aufsteiger, versteht er, ist – den positiven Wortbestandteilen auf und steigen zum Trotz – ein negativer Begriff. Wenigstens wenn Dr. Hecht ihn benutzt. Und das mit recht. Wenn Orpheus sich in den geerbten Ordnern den Schriftverkehr ansieht, den Vogel geführt hat: da ist nicht ein einziger Brief, der in korrektem Deutsch abgefaßt wäre – von den Tippfehlern der Sekretärin ganz abgesehen. Alles immer dicht an der richtigen Ausdrucksweise vorbei, und das offensichtlich nicht einmal absichtlich, nicht aus werbetaktischer Raffinesse. Nein, einfach aus mangelnder Vertrautheit mit der Sprache. Vogel selbst trägt den Aufsteiger dagegen fast wie ein Adelsprädikat vor sich her. Der Unterschied liegt wohl in der Stellung innerhalb der Bildungspyramide, und damit in der Blickrichtung, folgert Orpheus: Von unten betrachtet wirkt der Aufsteiger groß, von oben betrachtet klein. Und weil Orpheus selbst oben steht, lautet sein Resümee: Der Aufsteiger ist das, was man früher als Emporkömmling oder Parvenü bezeichnete. Doch so geschickt, so werkeltagstauglich, solch eine Erkenntnis für sich zu behalten, ist er bereits.
Dabei belustigt ihn, daß er immer mehr durchschaut und doch nichts daraus macht, daß er nicht mehr schreibt – außer gelegentlich Tagebuch. Jetzt bin ich ein geistiger Bodybuilder, den Kopf voller Muskelpakete und ohne eine Idee wozu. Aber wie sollte ich jetzt noch schreiben? Mit Fettstiften, mit Wurstfingern geldklimpernde Sätze auf Papier mit Goldrand werfen? Keine Chance mehr als Satiriker, ein Sattiriker jetzt, einer mit Doppeltee. Gute Zeiten sind nun mal schlechte Zeiten für die Dichtung.