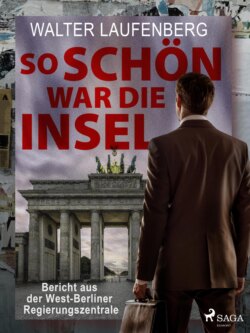Читать книгу So schön war die Insel. Bericht aus der West-Berliner Regierungszentrale - Walter Laufenberg - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.
ОглавлениеPünktlich 17 Uhr 47 Weiterfahrt ab Braunschweig Hauptbahnhof. Nur mühsam kommt der Zug ins Rollen. Fast könnte man Mitleid mit ihm haben, mit dem überforderten Muli. Da steht plötzlich dieser Mann neben seinem Tisch, sichtlich in Atemnot, so daß er schon versucht ist zu sagen: Pünktlichkeit ist doch ein Fluch, zumindest die bei anderen.
„Tschuldigung, ist der Platz noch frei?“ keucht der Mann ihn an.
„Bitte.“ So freundlich wie kurz, um dem Gehetzten nicht gleich einen ganzen Dialog aufzuzwingen. Wenn er sich auch schon heimlich darauf freut, ihn mit einer geschickten Einleitungsphrase zu betasten, ihn abzuhorchen und in aller Ruhe zu betrachten, mit diesem ungeniert direkten Ansehen, das zum Gesprächsritus gehört. Mit schnellen Wischblicken schon mal eine Kostprobe nehmen: Älterer Herr mit sehr schmaler Nase, Typ Messer, der Mann ist also kein Bohrer, sondern ein nachdenklicher Nasenflügelstreichler, korrekte Erscheinung im grauen Anzug, mit Weste, Schlips und Kragen und offenbar mit Umgangsformen, die einen vor Überraschungen unangenehmer Art bewahren. Vermutlich hat der Mann keine roten Streifen unter den Absätzen, wie die geschäftlich reisenden Smarties. Doch dürfte er statt der Papiertaschentücher ein gebügeltes Taschentuch in der Hose haben. Alte Schule.
Daß der Mann ohne jedes Gepäck ist, fällt ihm vor lauter Vergnügen am Mutmaßen – seine persönliche Variante von Mut – nicht auf. Zu sehr genießt er diesen ersten Akt der Bekanntschaft, den Akt, der meist der schönste ist. Weil voller Möglichkeiten. Nachher, wenn man alles weiß über sein Gegenüber, alles, was zur Grobkategorisierung nötig ist, steht man ja doch wieder mit dem Üblichen beschenkt da und sagt sich: Hätte mir denken können, daß nichts dabei herauskommt.
Freundlicherweise zunächst noch aus dem Fenster schauen, den anderen sich erholen lassen. Gerade erst Braunschweig hinter uns und noch lange nicht Helmstedt erreicht, doch die Felder werden immer größer, fällt ihm auf. Das schon vor der Grenze. Als ob sie einem mit diesem allmählichen Übergang zur Kolchoswirtschaft einen sanfteren Eintritt in die ganz andere Welt bieten wollten. Darf ich mir das einbilden? Daß sie mir einen Agrokulturschock zu ersparen versuchen? Die?
Der Mann ihm gegenüber bestellt sich ein Kännchen Kaffee. Und die Bedienung ist prompt. Er gießt sich aber so wenig Kaffee in die Tasse, als sollte dieses Kännchen bis Warszawa reichen. Da ist er schon versucht, ihn anzusprechen. Doch kommt der andere ihm zuvor, gerade als sie Helmstedt hinter sich lassen. Das mittelalterliche Städtchen zeigt ohnehin fast nur Dächer. Die letzten romantischen Bauten werden vom Grün abgelöst. Alte Kultur verliert sich in immer wieder junger Natur: So das sanfte Denkeln, mit dem er sich dem dritten Fläschchen Radeberger Pils hingibt, als der Grauverpackte ihn aufschreckt: „Da, sehen Sie da, der Bussard!“
„Ja, tatsächlich.“ Und sieht, wie der Vogel den Sturzflug vorführt, und ist plötzlich hellwach.
„Wo sonst können Sie noch einem Bussard zuschauen, wie er auf seine Beute hinabstößt“, sagt der Mann triumphierend. Als hätte er selbst die Szene arrangiert. „Das ist noch Natur. Gerade dieses von allen guten Geistern verlassene Stück Land zwischen Helmstedt und Marienborn, das Niemandsland, ist ein wunderbares Fleckchen Erde. Das ist das Beste, das die Zaunkönige geschaffen haben.“
Was tun, wenn man nicht versteht, aber auch nicht nachfragen und gestehen will, daß man noch nie einen Zaunkönig gesehen hat? So schweigen sie beide, den Bussard samt Beute hinter sich. Und bald auch Marienborn, die andere deutsche Grenzstation, Ende des Niemandslandes, Anfang von – na ja. In Marienborn hatte es fünf Minuten Aufenthalt gegeben, die Gelegenheit, sich von dem sonderbaren Fährmann zu befreien, der mit seinen Kommentaren irritierte.
Er war aufgestanden und zur hinteren Wagentür gegangen, um die Luft der Fremde zu schnuppern. An der Rückseite des Zuges. Der vom Bahnsteig abgewandten. Und sah einen Grenzposten mit Schäferhund neben dem letzten Wagen des Zuges stehen. Und sah, wie ein Kollege von ihm den Kopf aus dem ersten Wagen des Zuges rausstreckte. Und dachte, daß er sich gut beschützt fühlen müßte. Wenigstens von dieser Seite her könnte keine Gefahr drohen. Ein Mitreisender stellte sich zu ihm ans Fenster. „Bei der Hinreise habe ich gesehen“, erzählte der, „wie sie den Schäferhund unter den letzten Wagen getrieben haben. Da mußte der Cerberus, dieses arme Tier, unter dem ganzen Zug durchlaufen und prüfen, ob sich jemand unter einen der Waggons gehängt hat, bis zum vordersten Wagen hin. Da kam es rausgekrochen und wurde wieder an die Leine genommen.“
„Und warum machen sie das jetzt nicht so?“
„Weil es jetzt nicht aus der DDR raus geht, sondern in die DDR hinein.“
„Ach so“, um Zeit zu haben dahinterzukommen. Cerberus hat er gesagt. Also auch ein alter Oberstudienrat oder so was. Wie mein Vater. Da zog die Lok an, und der Zug defilierte mit einer sonderbaren Feierlichkeit an einer hochgebauten Observierungsplattform vorbei. Von dort oben beäugten ihn zwei Grenzposten, sah er. Also auch von oben keine Gefahr. Dann ging es zwischen immer enger stehenden hohen Zäunen hindurch. Irgendwie in eine Reuse hineingeraten, überlegte er.
In Marienborn waren blauuniformierte Männer eingestiegen, das Etikett Schutzpolizei auf dem Ärmel. Beim Gang durch den Speisewagen sagten sie: „Schönen guten Tag und guten Appetit.“ Und niemand wagte zu antworten. Kurz darauf waren Graugrüne hinterher gekommen, auf dem Ärmel als Grenztruppen der DDR deklariert.
„Sehen Sie da im Wald, sehen Sie den Hund?“ erschreckt ihn sein Gegenüber.
„Ja, ein Schäferhund. – Und?“
„Und den Draht, sehen Sie auch den Draht?“
Der Fremde sitzt in Fahrtrichtung, sieht also alles, noch ehe sie es erreicht haben. Er selbst sitzt gegen die Fahrtrichtung und kann so nur immer gehorsam hinterhersehen. Vielleicht ist es ja das, was den Mann ermuntert, für mich den Cicerone zu machen.
„Haben Sie den Draht richtig gesehen?“ hakt der nach. Und ohne eine Antwort abzuwarten: „Das ist so eine Art Trolleyhund, ein Wächter mit Oberleitung, wissen Sie. Die Hunde, auf Mann abgerichtete, scharfe Tiere, sind mit der Leine an diesen Laufdrähten fest, die sich quer durch die Wälder ziehen. Da drüben, da können sie deutlich die von den Hunden getretenen Pfade sehen. Und die Hundehütten hier und da auch.“
Jetzt müssen die auch schon ihre Wachhunde anbinden, damit sie ihnen nicht davonlaufen, kommt es ihm in den Sinn. Sagt er aber nicht. Nur: „Das ist ja entsetzlich.“ Was sich aber mehr auf die Vorstellung bezieht, so einem Trolleyhund im Wald zu begegnen.
„Ja, die armen Tiere“, sagt sein Tischgenosse.
Eine so freundlich-mitleidige Äußerung, daß ihm klar wird: Den Mann muß ich näher kennenlernen. Nur wie? Jedenfalls nicht mit einem derart tierisch ernsten Gesprächsthema. Da, da ist die Bewegung, die alles erklärt. Der Mann geht mit der Linken ins Gesicht und streicht nachdenklich die ganze Länge seiner Nase entlang, sie zwischen den Kuppen von Daumen und Zeigefinger einklemmend. Das zwanzig mal am Tag gemacht, und sicher schon über fünfzig Jahre lang, so hat er sich die Messernase geformt. Aber auch das ist leider kein Gesprächsthema. Kann man doch keinem Menschen erklären, diese Art von Handarbeit. Immer sofort der Einwand: Für sein Aussehn kann ja keiner. Daß die Nase ein Gebilde ist, dessen Entwicklung man selbst in der Hand hat, ein Gebilde mehr plastisch als elastisch, wer hat sich das schon klargemacht. Achja, Plaste und Elaste aus Schkopau, dieser berühmteste Werbespruch der DDR, über den alle Welt lächelt, bei der Fahrt mit dem Wagen auf der Transitstrecke habe ich ihn an einer der Brücken gelesen. Nein, auch kein brauchbares Thema.
„Der Wagen wackelt so schrecklich, da tun Sie gut daran, sich immer nur sehr wenig Kaffee einzuschütten. Sie kennen die Strecke wohl gut“, plaudert er einfach drauflos. Und erschrickt über sich selbst: Wie kannst du so was sagen, das ist doch nicht dein Bier.
„Das liegt nicht an dem Wagen“, geht der Mann sofort lebhaft auf den Köder los. „Das liegt am Gleiskörper. Da ist nie was dran gemacht worden. Die ganze Trasse müßte erneuert werden. Der Wagen selbst ist doch großartig. Wissen Sie, ich setze mich immer nur in den Speisewagen. Dieser anheimelnde Gruß der fünfziger Jahre, der einen da empfängt.“
„Die fünfziger Jahre, ja genau, das ist der Stil“, gibt er sich genauso begeistert.
Doch braucht er nicht weiterzusprechen, denn der Mann ist schon nicht mehr zu halten: „Sehen Sie, diese angedeutete Trennwand dort, mit dem nierenförmigen Ausschnitt, durch den man geht. Ist das nicht schön? Das war einmal die Grenze zwischen der ersten und der zweiten Klasse. Die Grenze haben sie natürlich beseitigt. Grenzenlos offen jetzt der Wagen, nur noch eine Andeutung von vorderem und hinterem Teil. Und welcher Teil der eine und welcher der andere ist, das ist eine Frage der Sehweise – oder besser: der Fahrtrichtung. Und völlig gleich die Ausstattung, da wie dort. Die taubenblauen Kunstledersitze mit diesen seitlichen, na wie soll ich sagen, Verblendungsscheiben, mit den schmückenden Goldstreifen dran. Gold auf taubenblau, – taubenblau, haben Sie denn dafür nichts übrig?“
So was wie vornehmes Mattgold auf den Zierleisten, stellt er bei genauerem Hinsehen fest, und braune Klebestreifen über den Nähten. Noch ein einziges Mal dieses Wort taubenblau, denkt er, und mich wundert nicht mehr, wenn er sich plötzlich ganz förmlich gibt, sich aus seinem Sitz erhebt und sich vorstellt: Kuckuck. Ja, das ist es doch, was mir von Anfang an so gefallen hat an diesem Tischnachbarn. Daß er so aussieht, wie früher ein Professor der Paläonthologie auszusehen sich bemühte.
Und bemerkt, daß sein Gegenüber auf eine Antwort wartet, ihn jedenfalls schon eine ganze Weile schweigend ansieht. Dann aber wohl einsieht, daß nichts mehr kommen wird, und hinausschaut. So kann er sich in die Stimmung der fünfziger Jahre zurücklehnen, seinen Blick auf dem Spiegel am Kopfende des Wagens – oder Fußende? – ausruhen lassen. Ebenfalls nierenförmig. Und kann dem Gedanken nachgehen, daß es wohl in den frühen Fünfzigern gewesen sein müsse, daß er den Felix Krull das erste Mal gelesen hat. Seitdem berührt es mich immer so sonderbar, wenn ich in einem alten Speisewagen sitze. Wenn auch ohne schöne Intarsien. Doch ich sollte jetzt die Verbindung nicht abreißen lassen. Wenn auch kein Professor, vielleicht ist der Mann dennoch ein interessanter Mensch.
„Bekomme ich eigentlich keinen Ärger mit dem Kellner“, fragt er unvermittelt, aber diesmal darauf achtend, was sein Bier ist, „wenn ich so lange an seinem Tisch sitze ohne zu essen?“
„Keine Sorge“, beruhigt ihn der Streckenerfahrene, „ich sitze immer die vollen drei Stunden von Braunschweig bis Bahnhof Zoo hier an diesem Tisch bei meinem Kaffee. Da hat niemand was gegen.“
„Aber das ist doch – ich meine, ich verhalte mich hier doch eigentlich geschäftsschädigend.“
„Das ist für die Kellner kein Gesichtspunkt“, klärt der Fahrensmann ihn auf, „die sind nicht so dahinter her, sich selbst Arbeit zu machen, – wenn man nur überhaupt etwas bestellt hat.“
Da fällt ihm auf: Der Kellner hält die beiden Tische am Anfang des Wagens reserviert und scheucht jeden weg, der das nicht sofort sieht. „Für meine Abrechnung nachher“, sagt er zum zweistelligen Male. Er hat wohl als seine eigene Kalkulation im Kopf: freibleibende Stühlezahl mal Fahrstunden mal mögliche Gästezahl gleich gesparte Arbeit. – Aber nicht wieder nur mutmaßen, lieber das Gespräch weiterführen. „Und Sie fahren öfter nach Berlin?“ wird er direkt. „Immer wieder diese endlose Strecke?“
„Ach, wissen Sie, so weit ist es ja gar nicht von Braunschweig nach Berlin. Gerade zweihundertzwanzig Kilometer sind das, oder drei Stunden Bahnfahrt oder ein Kännchen Kaffee. Und eine nasse Hose, ja allerdings, dieses Kunstleder, das ist das einzig Unangenehme an der Fahrt. Aber was nimmt ein Sammler nicht alles in Kauf, wenn es um seine Leidenschaft geht.“
Gerade Magdeburg passiert und dann die sich gelangweilt in ihrem Überschwemmungs-Wasserbett räkelnde Elbe überfahren. Die Großstadt wie der Fluß durchaus imponierend genug, um mal einen Zwischenstop zu rechtfertigen, überlegt er. Und dafür wäre der D 247 eigentlich auch nicht zu fein, will meinen: zu eilig. Aber der Wagen, der rollt. Rollt und schlingert zum Gotterbarmen lahm weiter. Das also war Magdeburg. Seine Mietskasernen waren in ein wirres Geflecht von Luftwurzeln ausgefranst. Wie auf den Kopf gestellt. Aber bloß die alten Kästen waren so. Die neueren trugen jeweils nur eine Gemeinschaftsantenne, trugen sie wie einen indianischen Federschmuck. – Vom Bussard? – Egal. Aber, darf ich das Stichwort Sammler aufgreifen? Muß ich es vielleicht sogar, um nicht beleidigend desinteressiert zu wirken? Oder darf ich dieses so sehr vertrauliche Geständnis nicht durch ein Nachfragen noch peinlicher werden lassen? Ja, verflucht noch mal, das kommt doch auf die Frage hinaus: Ist es nun eine Macke, ein Sammler zu sein, oder ist es das nicht?
„Ich sammle nämlich Visa.“
„Aha.“ – Und registrierte heimlich: Also doch eine Macke.
„Wissen Sie, der Kreis der Visacollectors ist noch sehr klein und steht in gar keinem Verhältnis zu der Häufigkeit des Reisens und der Ausstellung von Visa. Aber das ist gerade das Großartige an diesem Sammelgebiet. Daß sich darauf noch nicht Krethi und Plethi herumtummeln, wie bei Briefmarken oder Münzen und Puppen und Zwiebelmustergeschirr und was für einen Unsinn sonst noch die Leute sammeln. Wir Visasammler sind noch recht wenige. Gerade erst haben wir in Amsterdam unseren europäischen Dachverband gegründet, die EAVC. Das heißt European Association of Visa Collectors. Ich war als Vertreter der bundesdeutschen Sektion dabei. Sehr feierlich. Wir kooperieren vorläufig noch auf informelle Weise mit der renommierten AAVC, der American Association of Visa Collectors, aber das sehr intensiv. Doch zur Gründung eines Weltverbandes wird es wohl noch nicht so bald kommen, weil der gesamte Ostblock sich dagegen sperrt. Dieser Wahnsinn der Teilung unserer Welt in Ost und West.“
„Ja, ja.“
„Im Ostblock ist die Entstehung entsprechender Vereinigungen von Visasammlern durch die absurde Einstellung blockiert, dafür sei ein Visum eine viel zu ernste Angelegenheit. Dabei, – wer nimmt die Visa wohl mehr ernst als wir, die ernsthaften Visacollectors.“ Spricht das englische Visacollectors stets mit karpfenmäuliger Korrektheit und gehobener Stimme, als sei es sein Adelsprädikat.
Bei der Erwähnung des Ostblocks war seine Stimme plötzlich sehr leise geworden, dann versiegte sein Redefluß sogar ganz. Resigniert rührt der Mann in seinem Kaffeerest. Da muß man doch helfen, da muß man doch was zur Aufheiterung sagen, zur Ablenkung. Der Zug zieht durch die Magdeburger Börde. Und nichts, das man ansprechen könnte. Kein Bussard, keine Zaunkönige. Wie das mit den Zaunkönigen gemeint war, ist ihm sowieso schleierhaft. Auch kein Schäferhund mit Oberleitung. Der Blick hinaus einfallslos schraffiert: Die gefurchten Felder wollen schier kein Ende nehmen. – Diese großen Felder, dieser Unsinn, diese Dokumentation einer großen Idee. Da fällt ihm die berühmte Rechenaufgabe ein: Eine Putzfrau schafft eine Hundert-Quadratmeter-Wohnung in drei Stunden; wieviel Stunden brauchen zwei Putzfrauen für eine doppelt so große Wohnung? Die richtige Antwort lautet: Sechs Stunden.
„So weit und so gefurcht, wie übermäßig hohe Denkerstirnen“, sagt er und deutet hinaus. Doch sein Gegenüber geht nicht darauf ein. „Eine hohe Stirn ist halt nicht immer mit hoher Geistigkeit gleichzusetzen“, versucht er zu trösten. Doch kommt keine Reaktion – und der Kaffeerest immer noch nicht zur Ruhe. Das ist ja nicht mitanzusehen. Also den Mann einfach frontal angehen: „Wie viele Visa haben Sie denn schon gesammelt?“
„Ha“, ist der sofort wieder voll da, „das fragt sich so leicht und ist so schwer zu beantworten. Ich zum Beispiel, und ich gehöre nicht einmal zu den bedeutendsten Sammlern, ich kann meine Schätze überhaupt nicht mehr überblicken. Es mögen fünftausend sein, es können aber auch an die zehntausend sein, – was weiß ich. Ich habe keine Zeit, sie zu zählen. Zunächst habe ich ja querbeet gesammelt, wie man das als Anfänger halt so macht. Auch diese Sammelstücke werden einmal wertvoll, das ist klar; immerhin gab es ja fast hundert Jahre lang keine Visa mehr im innerdeutschen Verkehr. Da klafft eine gewaltige Lücke, historisch bedingt. Das macht natürlich alles aus den Jahren unmittelbar vor und nach diesem Einbruch um so wertvoller. Aber es hat keinen Zweck, alles zu sammeln. Deshalb habe ich mich – und so macht es jeder halbwegs gescheite Sammler – auf ein Gebiet spezialisiert.“
„Und das wäre?“
„Das ist“, korrigiert er sanftmütig und beinahe unauffällig, „das ist dieser innerdeutsche Verkehr, das heißt das Transitvisum zur einmaligen Reise durch das Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik auf der kürzesten Fahrstrecke mit der Eisenbahn. So seine korrekte Bezeichnung. Die kennt man dann natürlich auswendig. Und dieses Visum wird ausgestellt vom Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Deutschen Demokratischen Republik mit Sitz in Berlin, der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik“, zitiert er weiter. „Sie sehen, man wird auch politisch aufgeklärter durch diese Sammlertätigkeit. Die ist also alles andere als sinnlos.“
„Aber wenn man einmal so ein Transitvisum gekriegt hat, dann kennt man es ja. Das ist doch immer gleich, anders als Briefmarken, die ja immer andere Bilder bringen“, reizt er den Sammler zum Weiterreden, um zu verhindern, daß der wieder in seine Kaffee rührende Bedrücktheit verfällt.
„Für den Laien ja, zugegeben, für den Laien ist das immer gleich. Aber der ernsthafte Visacollector sieht das mit anderen Augen. Jedes Transitvisum ist ein einmaliges Dokument, ein echtes Unikat, entstanden aus der Kombination von drei variablen Faktoren, nämlich dem gedruckten Formular, der handschriftlichen Eintragung durch den Grenzpolizisten und dem von Hand aufgedrückten Stempel. Und weil alle drei Faktoren Variable sind, gibt es eben diese unüberschaubare Menge von Unikaten, durch die ich eine Schneise zu schlagen bemüht bin. Denn so ist das halt beim ernsthaften Sammeln – und damit auch ein bißchen wie ganz allgemein im Leben: es kommt nicht auf das Was an, dafür um so mehr auf das Wie. Immer nur das Wie muß stimmen.“
Das Drei-Eier-Omelett ist inzwischen kalt geworden. Schade um das eigentlich recht günstig erstandene Essen: mit Pilzen und zwei Scheiben trockenem Brot für ganze 7 Mark 70. Aber so aufmerksam den Nachrichten aus einer anderen Welt lauschend, da bleibt kein Platz fürs Essen. Und wenn man dazu auch noch gespannt ist auf den Auftritt der Grepos. Aber das mit den Variablen will er unbedingt vorher noch genauer wissen. Dabei entpuppt sich sein Partner als ein sehr geduldiger Lehrer. So erfährt er, daß die Formulare im Format DIN A 6 nicht nur auf verschiedenem Papier gedruckt werden, „vermutlich so, wie es gerade vorrätig ist“, sondern auch mit unterschiedlichen Drucktypen, mal mit schmalhohen, mal mit breiter laufenden, mal flauer und mal fetter. „Wohl in verschiedenen Druckereien gedruckt. Und der durchgehende Arabeskenaufdruck mit dem großen Staatswappen im Kringelkranz mitten drauf, der bringt auch nicht immer dasselbe Muster und ist mal erfrischend lilarot, mal kirchenfestlich violett, ganz abgesehen von der aufgedruckten laufenden Nummer mit Buchstabenkombination. Das macht ihnen so leicht keiner nach.“ Mit unüberhörbarer Bewunderung. „Nur die neben das Siegel gedruckte Unterschrift ist immer gleich unleserlich, – irgendwas wie Henscheid.“
Vom Bier zum Tee übergewechselt, um alles hellwach mitzukriegen. Die beiden Teebeutel schwimmen ohne Rettungsleine im Teekännchen. Dafür tröstet das Papierchen unter der Tasse mit der Aufschrift: Mitropa macht das Reisen schöner. Die am Nebentisch haben das wohl nicht gelesen, fällt ihm auf, die lassen ihren Kaffee angetrunken angewidert stehen. „Ist alles nicht mehr wie früher“, hört er.
Daß Name, Vorname und Geburtsdatum des Transitreisenden von den Grepos nicht mehr in die vorgesehenen Rubriken eingetragen werden, findet der Sammler sehr bedauerlich. „Aber ich, ich habe auch viele Stücke aus der Anfangszeit, als man noch mit dem nötigen Ernst bei der Sache war.“
Will er mich etwa neidisch machen? Dabei hat es mich doch noch gar nicht gepackt, das Sammelfieber. Ich warte lediglich auf den Grepomann, der mir mein persönliches Transitvisum gibt. Wie ein Kind auf den Weihnachtsmann, so warte ich auf ihn. Aber reine Sensationslust, nichts sonst.
„Um eine komplette Kollektion zu erhalten, die dann auch was wert ist“, erfährt er, „muß ich beim Sammeln gewisse Konstanten einführen.“
„Erst all die Variablen, und jetzt auch noch Konstanten?“
„Ja, ich muß jede Woche fahren und darf keine einzige auslassen. Und immer am selben Wochentag, immer mit demselben Zug und immer im Speisewagen an demselben Tisch. Und das mit dem Speisewagen statt Abteil, das will ich Ihnen als Anfänger gleich als Tip mit auf den Weg geben: Die Grepos stehen hier bequemer als in der Abteiltür und schreiben deshalb die Paßnummer deutlicher. Das erhöht natürlich den Wert des Stückes und ist letztlich mehr wert, als der eine Kaffee kostet. Ohnehin darf man an Kosten nicht denken. Die viele Fahrerei. Ein Sammler zu sein, das muß man sich halt leisten können.“ Und genehmigt sich prompt noch einmal ein winziges Schlückchen Kaffee, so vorsichtig dosierend, beinahe nur ein Küßchen für den Tassenrand.
Anderthalb Stunden vor der Ankunft in Berlin Zoologischer Garten nimmt der Ober einem Gast, der sich gerade erst gesetzt hat, die Speisekarte aus der Hand. Und als der wieder danach greifen will, meint er: „Ja, wenn Sie sich nur mal informieren wollen. Die Küche ist aus. Ich muß jetzt abrechnen.“ Dann setzt er sich an den ersten Vierertisch, den freigehaltenen, und breitet Listen und Blöckchen aus. Und rechnet eifrig los, mit leisem Vorsichhinsprechen. Alles ohne Taschenrechner. Ein Arbeiter des Kopfes, nicht der Faust.
Dann endlich kommen sie, die Grenzposten: fünf Mann mit Bauchladen und Pistole schwärmen nach einer offenbar gut einstudierten Choreographie zwischen den Tischen aus und bitten um die Reisedokumente, wie sie den bundesrepublikanischen Reisepaß schön verallgemeinernd nennen. Sein persönlicher Grepo klappt vor ihm den Bauchladen, einen flachen Holzkasten, auf und legt seinen Reisepaß auf den so entstandenen kleinen Tisch, schreibt irgendwas, macht zweimal klackklack mit einem Automatikstempel – einmal in den Paß, einmal auf das Transitvisum, wie er hinterher feststellen wird –, gibt ihm den zugeklappten Paß zurück und geht. Schon Schluß mit der ganzen Zeremonie. Ein unansehnliches Zettelchen steckt zwischen den Blättern seines Reisepasses: das Transitvisum.
Er ist enttäuscht und läßt es seinen Gesprächspartner merken, indem er den Zettel betont desinteressiert doppelt faltet, nicht einmal akkurat in der Mitte, und ihn mit dem Paß wegsteckt. Solange die Graugrünen im Speisewagen sind, ruht an allen Tischen das Gespräch. Erst nachdem sie verschwunden sind, lodert es zögerlich wieder auf. Er tut unbeeindruckt. „Kennen Sie Brandenburg?“ fragt er sein Gegenüber.
„Nur von der Durchreise her. Da ich ja immer an diesem Tisch sitze, wegen der Konstanten, verstehen Sie. Da muß man konsequent sein und anderes einfach beiseite lassen. Der Blick des Sammlers wird naturgemäß etwas eingeschränkt, das gilt auch und erst recht für den Sammler von Transitvisa“, setzt er die nur bei der Kontrolle unterbrochene Sammellitanei fort.
Hilf Himmel, wie komme ich nur wieder vom Transitvisum los? Den Partner nicht mehr anschauen, überhaupt nicht mehr hinhören. Frechheit, denkt er, einem so ein mieses Zettelchen zu geben, ohne jeden Versuch einer künstlerischen Gestaltung, wo doch Briefmarken und Münzen und Porzellan von erstklassigen Künstlern entworfen werden. Ich will einfach nichts mehr davon hören. Erledigt, aus. – Doch ein passionierter Sammler läßt sich nicht so leicht abschütteln. Dafür ist seine Sache viel zu wichtig. Und deshalb auch er selbst. Ärgerlich. Jetzt hast du es wieder bestätigt gekriegt, sagt er sich: Die Leute, die man so trifft, sind nur solange interessant, wie man nicht weiß, was sie tun und sind. So grübelt und gründelt er langsam auf Potsdam zu, immer strenger werdend in seinen Überlegungen. Dann endlich hat er was:
„Aber“, sagt er unvermittelt, „ist das nicht Mißbrauch des Transitabkommens von 1971, genaugenommen, wenn Sie sich nicht ein Transitvisum ausstellen lassen, weil Sie die Transitstrecke benutzen wollen, sondern die Transitstrecke benutzen, nur um ein Transitvisum zu ergattern? Und das immer wieder. Sozusagen als ein Serientäter.“
Mit weitaufgerissenen Augen und Nasenlöchern und klaffendem Mund starrt der Sammler ihn an, einen Moment lang tonlos. Dann aber: „Nein, nein, um Gottes willen“, greift er sich ans Herz, „so kann man das doch nicht sehen. Sagen Sie, daß man das so nicht sehen kann. Ich habe immer eine Fahrkarte zum vollen Preis gekauft, und ich habe mich immer absolut korrekt verhalten, kein Wort gesagt bei den Paßkontrollen, da habe ich stets drauf geachtet, um ja keinen Anlaß für eine Verdachtskontrolle in der Baracke zu geben. Aber wenn Sie das so sagen –.“ Und schweigt atemlos, erst blaß, dann wie in die Farbvariable getaucht, mal mehr rot und mal mehr violett im Gesicht.
Es ist kurz nach zwanzig Uhr, als die Grenzposten wieder durch den Speisewagen kommen. Der Sammler plötzlich wieder leichenfarben. Die Männer aber streben mit schnellen Schritten und zufriedenen Ladenschlußgesichtem dem Zugende zu.
Die Vorortbahnhöfe Berlins werden ohne Halt und nur im Bummeltempo passiert: Wildpark – da steht noch eine verfallende Prachthalle abseits, einst für den Empfang des Kaisers geschmückt –, dann Babelsberg und schließlich Griebnitzsee, das andere Ende der Reuse. In Griebnitzsee steigen die Uniformierten aus, auf dem Bahnsteig von Kollegen und Schäferhunden erwartet. Daß es immer Schäferhunde sein müssen, überlegt er. Eigentlich ein gutes Zeichen: Wir Deutschen sind ein bukolisch empfindendes Völkchen. Mindestens fünfmal waren sie durch den Zug gezogen, die Uniformierten, im Gänsemarsch. So ein Schutz, denkt er. Sein Gegenüber ist verstummt. So hat er Muße, sich einmal die Mauer aus der Nähe zu betrachten: grau und übermannshoch und mit einer ebenfalls grauen Rolle obendrauf, an der wohl die Hände abgleiten sollen, wenn einer drüberzuklettern versucht. Was ohnedies ein schlimmes Ende nehmen würde, denn hier sieht er hinter der Mauer einen breiten Riegel von rostbraunen Eisenmatten liegen, mit hohen Stacheln dicht an dicht. Selbst einen gestandenen Fakir müßte dieser Teppich an der Welt verzweifeln lassen. Liegen die Matten nun vor oder hinter der Mauer? Das ist eine überflüssige Frage, weil die Öffnungen, durch die der Zug fährt, ja reusenartig gebaut sind. Aber daß wir aus der Reuse überhaupt wieder hinausdürfen, das ist schon grandios. Das verdanken wir fraglos dem Transitvisum – und den vielen Millionen harter D-Mark, die Bonn dafür zahlt.
Um 20 Uhr 30 in Berlin-Wannsee. Die letzten fünfzehn Kilometer bis zum Bahnhof Zoo unterscheiden sich deutlich von der gerade durchfahrenen Strecke: Die ganz andere Art von Autos auf den Straßen markiert den Bühnenwechsel. „Ich vermute, jetzt sind wir wieder auf deutschem Boden oder nicht?“ fragt er sein Gegenüber. Und ergänzt, als er dessen irritiertes Suchen nach einer passenden Antwort bemerkt: „Ich meine, wir sind in, wie soll ich sagen, na ja, Sie wissen schon.“ Klingt ja auch viel zu pathetisch, das mit der freien Welt, überlegt er.
„Tschuldigung“, springt der Mann plötzlich auf, wiederbelebt. „Dürfte ich Sie wohl um Ihr Transitvisum bitten? Sie brauchen es ja jetzt nicht mehr, und ich, ich sammle doch das Gebiet, und nun – nun war das meine letzte Reise. Zurück werde ich fliegen, vorsichtshalber.“ Und dann hurtig von Tisch zu Tisch mit seiner Bitte. Und ab in den nächsten Wagen: eine Sammlerpersönlichkeit, ungebrochen.
Pünktlich 20 Uhr 46 läuft der Zug in Bahnhof Zoo ein. In dem Menschengewirr dort kann er seinen Gesprächspartner leider nicht mehr ausmachen. Zu spät, um sich dafür zu entschuldigen, daß er ihm die Komplettierung seiner Sammlung vermasselt hat.
Auch ich in Berlin, sagt er sich. Und wenn schon nicht in Arkadien, so doch an der Sollbruchstelle der Welt. Und ich habe hier eine wichtige Funktion. Den Bruch zu verhindern? Nicht ganz das. Vielleicht eher: Darzustellen, daß er längst keiner mehr ist. Daß die Risse gut verheilt sind. Nur noch liebevoll gehätschelte Narben. Triumphierend vorgezeigt.