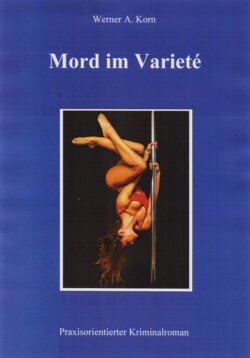Читать книгу Mord im Varieté - Werner A Korn - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеBreitsteins Wandergruppe erreichte ein ebenes, grasbewachsenes Hochplateau, das die Einheimischen seit alten Zeiten als ›Gschwendt‹ bezeichneten. Ein ›Gschwendt‹ ist eine Wirtschaftsfläche, die durch Roden nutzbar oder durch Abbrennen urbar gemacht wurde.
Diese baumfreie ca. 300 mal 700 Meter große Fläche begrenzte am bergseitigen Ende ein flacher Hügel. In der Mitte des Areals waren fünfzehn Männer der örtlichen Feuerwehr in ihrer Dienstkleidung damit beschäftigt, nach genauen Vorgaben einen riesigen Holzstapel für das abendliche ›Johannisfeuer‹ aufzubauen. Sie stellten trockene, dünne bis zu fünf Meter lange Holzstämme über einige bis zu einem Meter lange Reisigbündel und kleinere Strohballen zu einer Kegelform zusammen. Die Bündel des röschen Anfeuerholzes, auch Feuernest oder Feuerherz genannt, bestanden aus verdrillten Zweigen, die mit dickerem Geäst umwickelt und zusammengeschnürt waren.
Seit dem 12. Jahrhundert ist das Entzünden von ›Johannisfeuern‹ auch als ›Würzfeuer‹, ›Notfeuer‹ oder ›Sonnenfeuer‹ bekannt. In der Nacht zum 24. Juni werden in Bayern, Tirol, Nieder- und Oberösterreich, Baden-Württemberg und Mitteldeutschland (Harz) die ›Johannisfeuer‹ entzündet. Nach alter, heidnischer Tradition begrüßen die Menschen auf Berggipfeln mit diesen hochlodernden Feuern den Anbruch des Sommers.
Der 24. Juni ist der Geburtstag Johannes des Täufers. Er geht dem Geburtsfest Christi um sechs Monate voraus und galt ursprünglich als Fest erster Klasse. Die Kirche versuchte bereits im Mittelalter die älteren Sonnwendfeuer durch die ›Johannisfeuer‹ zu ersetzen. Im Mittelalter führte man vor allem Tänze rund um die ›Johannisfeuer‹ auf. Da das Fest des heiligen Johannes in die Zeit der Sommersonnenwende fällt, war es im Volksglauben mit vielen Bräuchen - besonders den Reinigungs- und Fruchtbarkeitsriten - verbunden. Der Sprung über das ›Johannisfeuer‹ sollte sowohl baldige Heirat als auch Schutz vor Hexen und Geistern versprechen. Angebrannte Holzstücke steckte man in Felder und Äcker, um diese vor Ungeziefer zu schützen.
Die Feuer zur Sommersonnenwende weisen wohl vorchristliche Wurzeln auf, waren aber vor allem im Mittelalter sehr verbreitet und haben sich über die Verbote der Aufklärung hinweg vielerorts bis in unsere Zeit erhalten. Im Zuge der Christianisierung ersetzte die Kirche das Fest der Sommersonnenwende durch jenes der Geburt Johannes des Täufers am 24. Juni. Aus den Sonnwendfeuern wurden die ›Johannisfeuer‹.
Der Tag der Sommersonnenwende ist der längste Tag im Jahreszyklus. Er fällt auf den 21.(22.) Juni und kündigt den kalendarischen Sommerbeginn an, den Mittsommer. Dabei wurden Sunna (das Gesetz) und Baldur zu den Feierlichkeiten der Tag- und Nachtgleiche geehrt. Der ›leuchtende Gott‹ Baldur (Balder/Baldr), die Sonne, befindet sich auf ihrem Höhepunkt, um danach zu „sterben“. Er wird von Loki, dem Gott der Lügen und des Feuers, mit einer Mistel umgebracht. Zu Ehren von Saga, der Göttin des Wassers und der Weisheit, Sagen und Geschichten, wurden Teiche und Brunnen geschmückt.
Im Mittelalter tanzten die Menschen um das ›Johannisfeuer‹. In späterer Zeit umgingen die Gläubigen, den Rosenkranz betend, das Feuer. Zum Ritus gehörte auch eine lebensgroße Strohpuppe, auch ›Hansl‹ oder ›Gretl‹ genannt. Diese Puppe symbolisierte den Winterdämon oder die Wetterhexe und wurde auf einem Stock über dem Scheiterhaufen verbrannt. Nachdem der Winter vertrieben und alle bösen Geister vom Feuer verzehrt wurden, begann das vergnügliche Feuerspringen. Das Feuerspringen, so glaubte man, segnete den Springer, schützte ihn vor bösen Geistern, Hexen sowie Krankheiten und spendete Fruchtbarkeit. Sprang ein Mädchen mit einem Burschen Hand in Hand über das Feuer, so hat sie sich ihm versprochen.
Breitstein sah zum Gasthof mit dem bescheidenen Namen ›Flori-Alm‹ hinauf. Da stand ein dreistöckiges Haus mit weit ausladenden Vordächern. Die Fassaden waren im Erdgeschoß mit einem feinporigen Kalkanstrich und vom ersten Stock bis zum Satteldach mit einer Holzverkleidung versehen. Das Dach bestand aus Holzschindeln. An den Fenstern waren Läden aus naturbelassenem Holz angebracht. Vor dem Terrassengeländer und den Fensterbänken blühten in Holzkästen rote Geranien. Am Eingang begrüßten das Pächterpaar die ankommenden Natur- und Wanderfreunde. Nach der offenstehende Holztüre betraten die Gäste die Gaststube.
Hauptkommissar Bernd Breitstein erklärte dazu seinen Begleitern: »Diese Gaststätte war früher nur eine aus dicken rindenlosen Baumstämmen errichtete Almhütte. Dann baute man sie zu einer Anlaufstelle für hungrige, müde oder schutzsuchende Wanderer und Skifahrer aus. Und schließlich in den 80iger Jahren zu diesem ganzjährig bewirtschafteten Touristenkasten mit 40 Betten für Sommer- und Wintergäste und einer Sauna- und Wasserwelt. Modern halt.«
Deutlich war in seinem Tonfall seine absolute Ablehnung für den zunehmenden Massentourismus in den Bergen herauszuhören. Für ihn stellte dieser eine landschaftsbelastende und verhängnisvolle Verdrängung der regional gewachsenen Kultur dar. Nach seiner Überzeugung hatte der Andrang mit dem so häufig propagierten ›sanften Tourismus‹ nichts zu tun.
Gemächlich schlenderten die drei Wanderer auf der breiten, geteerten Forststraße zu dem 50 Meter weiter gelegenen Berggasthof hinauf.