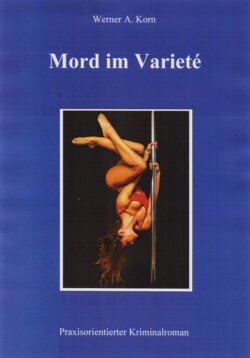Читать книгу Mord im Varieté - Werner A Korn - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеBernd Breitstein, Kriminalhauptkommissar und Leiter des ersten Mordkommissariats im Polizeipräsidium der Stadt Fasenau, hatte sich mit zwei seiner Wanderfreunde zum Sommerfest ›Johannisfeuer‹ auf dem Berggasthof ›Flori-Alm‹ verabredet. Der Gasthof liegt auf einer Hochebene, ca. 200 Meter unterhalb des 1 665 Meter hohen, markanten vielzackigen ›Ritzstein‹ in den Bayerischen Voralpen. Für viele naturverbundene Urlauber und bergbegeisterte Ausflügler zählt dieser Berg als Tagestour zu einem der bevorzugten Ziele. Mit ein paar Mitgliedern des Wandervereins ›Edelweiß‹ war der Kriminalhauptkommissar schon einige Male in diesem Gebiet unterwegs gewesen. Immer wieder faszinierten ihn der traumhaften Ausblicke auf die gewaltige Alpenkette und in die hügelige Landschaft des Voralpenlandes.
Die Bayerischen Voralpen sind eine bis 2 086 Meter über NHN hohe Gebirgsgruppe der Nördlichen Kalkalpen in Deutschland und Österreich. Normalhöhennull (NHN) ist der Begriff der Bezugsfläche für das Nullniveau mit der Höhenangabe über dem Meeresspiegel, früher Seehöhe oder als Normalnull (NN) bezeichnet. NHN wurde als neuer Begriff eingeführt, da die Höhenangaben des NN das Schwerefeld der Erde nicht berücksichtigten. Das Schwerefeld der Erde wird durch die Anziehung der Erdmasse, durch die Kreisbewegung und durch kleinere Auswirkungen wie die Gezeiten, z. B. Anziehung durch Mond und Sonne, bewirkt. Das Schwerefeld auf der Erdoberfläche und im Außenraum ist mit relativ geringen Abweichungen das einer Kugel. Die Anziehung ist am Pol aufgrund der Abplattung der Erde und der dort wegfallenden Zentrifugalkraft um ca. ein 200stel grösser als am Äquator. Mit zunehmender Entfernung von den anziehenden Massen verringert sich die Anziehung. So ist sie in einer Höhe von 3 000 Metern um ca. ein Tausendstel geringer als auf Meereshöhe. Neben diesen beiden Haupteffekten weist das Schwerefeld globale, regionale und lokale Unregelmäßigkeiten auf, da die Masse sowohl in der Erdkruste (Gebirge, Kontinentalplatten) als auch tiefer (im Erdmantel und -kern) nicht gleichmäßig verteilt ist. Mit der Umstellung auf NHN fand eine Anbindung an das europäische Nivellementnetz (UELN) statt. Seitdem bestehen bei den Höhenangaben zu den anderen daran angeschlossenen Ländern keine Abweichungen mehr.
Der bayerische Voralpenanteil besteht zwischen den Flüssen Loisach im Westen und Inn im Osten. Das Gebirge ist etwa 80 km lang und 20 bis 30 km breit. Der Begriff ist nicht politisch, sondern alpingeografisch definiert, denn kleine Teile liegen im österreichischen Bundesland Tirol.
Am Samstag, es war der 23. Juni, fuhr Bernd Breitstein früh um sechs Uhr in seinem alten, grauen Mercedes-Benz, den bereits seit Jahren ein ›H-Kennzeichen‹ zierte, zu den Wohnungen seiner Freunde. Er holte Rudi Reiser und Joachim Jarosch jeweils zu Hause ab. Auf der wenig frequentierten Landstraße durchquerte er kleinere Bauerndörfer, bis er schließlich in dem Bergdorf Reitwies ankam.
Da der Rudi Reiser, ein verheirateter im Innendienst des Hauptpostamtes von Fasenau beschäftigter Endvierziger, zum ersten Mal diese Wandertour mitmachte, erklärte ihm der Hauptkommissar einiges, wie es z.B. zur Namensfindung des Berggasthofes kam.
»Der heilige Florian war ein christlicher Märtyrer, der im 3. Jahrhundert lebte. Er ist Landespatron von Oberösterreich und Schutzpatron der Feuerwehr, Bierbrauer, Seifensieder und der Schornsteinfeger.«
Rudi Reiser fragte nach: »Geht auf diesen Märtyrer auch der Begriff der Floriansjünger zurück?«
»Genau. Ich sagte schon Schutzpatron der Feuerwehr. Der heilige Florian war Offizier in der römischen Armee und Oberbefehlshaber einer Einheit zur Feuerbekämpfung. Er wird auch in Bayern ganz besonders verehrt«, ergänzte Bernd Breitstein.
Nach einer guten halben Stunde erreichte die Gruppe in dem alten Mercedes über die kurvenreiche Landstraße den Parkplatz oberhalb der Ortschaft Reitwies. Der Kriminalbeamte parkte seinen mit großer Hingabe gepflegten Oldtimer, den er scherzhaft ›Meine gute alte Berta‹ nannte, auf einem von hohen Fichten beschatteten Stellplatz.
Alle verließen den Wagen und holten ihre vollgepackten Rucksäcke aus dem Kofferraum heraus. Geschmeidig zogen sie ihre robusten, wasserdichten, aus Nubukledern gefertigten und gewachsten Wanderschuhe an und schnallten sich ihre Rucksäcke um.
Bei einem wolkenlosen Himmel marschierten die drei Wanderer gemächlichen Schrittes im Gänsemarsch über die neu errichtete Holzbrücke eines Baches. Auf dem schmalen, teilweise von rötlichbraunen Moospolstern bedeckten Waldboden stiegen sie durch den Mischwald zu einer lichten Anhöhe hinauf. Spärlich fielen einige Sonnenstrahlen durch die dichten Äste der ihre Aufstiegsroute säumenden Fichten und Tannen. Den ausgeschilderten Weg über die geteerte Forststraße vermied die Gruppe. Bernd Breitstein bevorzugte den kürzeren, wenngleich etwas steileren Wanderpfad, den sogenannten Jägersteig.
Hauptkommissar Breitstein, der seine Wanderfreunde anführte, drehte sich nach einiger Zeit um und erklärte: »Die Hälfte der Strecke zur ›Flori-Alm‹ haben wir bald geschafft. Ich freu‘ mich schon auf eine klassische bayerische Brotzeit mit einem ›Obatzten‹ oder zwei ›Fleischpflanzerln‹. Und ganz besonders auf das ›Sonnwendfeuer‹ am Abend. Das wird ein einmaliges Erlebnis!«
Das ›Fleischpflanzerl‹ hat viele Namen. Was man in Altbayern ›Fleischpflanzerl‹ nennt, wird in Nordbayern als ›Fleischküchle‹ oder ›Fleischküchla‹, in Berlin als ›Bulette‹, in Niedersachsen als ›Frikadelle‹ und in Südthüringen als ›Hackhuller‹ bezeichnet. Die ›Buletten‹ sollen von den aus Frankreich geflüchteten Hugenotten im 17. Jahrhundert nach Berlin gekommen sein.
Der Name ›Fleischpflanzerl‹ stammt von dem altertümlichen Wort ›Fleischpfannzeltel‹. Als Zelte bezeichnete man flache Kuchen, die aus Fleisch in der Pfanne zubereitet wurden. Diese Zubereitung besteht für die ›Fleischpflanzerln‹ weiterhin unverändert. Der Begriff Lebzelten hat sich für Lebkuchen bis heute erhalten. Während früher das ›Fleischpflanzerl‹ meiste aus Fleischresten gebraten wurde, wird heute eine frisch zubereitete Mischung aus Schweine- und Rinderhack verwendet.
Der Lebzelter war früher ein Lebkuchenbäcker, der u.a. Lebzelten (Lebkuchen) herstellte. Eine Verbindung zu dem Wort ›Fleischpflanzerl‹ ist dabei jedoch nicht erkennbar. Aus dem ehemaligen Begriff ›Pfann(en)zeltel‹ entstand zunächst die gekürzte Form ›Pfanzl‹, später ›Pflanzl‹ und durch das Braten mit der Fleischmischung das ›Fleischpflanzerl‹.
›Obazda‹ (auch ›Obatzter‹ geschrieben) heißt so, weil er mit den Händen gemanscht wird. Denn das bayerische Wort bedeutet nichts anderes, als Angebatzter oder Angedrückter. Es handelt sich dabei übrigens um ein Käsegericht, das hauptsächlich aus reifem Camembert, Butter und Gewürzen besteht.
In Franken wird er als ›Gerupfter‹ bezeichnet. Dieses würzige Käsegericht ist aus keinem bayerischen Biergarten mehr wegzudenken.
Denn, ob Bayer oder Preiß (= Preuße, für den Bayern alle Nichtbayern), zur zünftigen Maß Bier gehört auch eine deftige Brotzeit. Auch wenn der ›Obazde‹ sich mittlerweile zur bayerischen Spezialität gemausert hat, wurde er aus der Not heraus geboren, den überreifen Weichkäse noch irgendwie zu verwerten.
Ein alter Camembert oder Brie schmeckt ziemlich kräftig (der Bayer sagt dazu ›rass‹) und das ist schließlich nicht jedermanns Geschmack. Mit Butter abgemildert und mit Paprikapulver gewürzt, wird jedoch aus dem ungeliebten Weißschimmelkäse, der mit seinem Gestank schon den Kühlschrank verpestet, ein Schmankerl.
Je nachdem wie reif also der Weichkäse ist, umso ›rasser‹ schmeckt auch der ›Obazde‹. Wer es für den Anfang lieber etwas milder probieren möchten, sollte darauf achten, dass der Camembert noch nicht ganz so alt ist. Aber auch mit der zugefügten Buttermenge lässt sich die Schärfe regulieren. Der echte ›Obazde‹ sollte mindestens 50 Prozent Käseanteil aufweisen.
Seit Mitte 2015 sind die Bezeichnungen ›Obazda‹ und ›Obatzter‹ geschützt: Nur wenn die Käsespezialität in Bayern zubereitet wird, darf sie einen dieser beiden Namen tragen. Wer somit in Berlin das tolle ›Obazda-Rezept‹ nachkocht, erhält noch lange keinen ›Obazden‹, sondern lediglich einen ›ogmachten Kas‹ (= angemachten Käse).
Seine ihm nachfolgenden Freunde blieben kurz stehen und bestätigten mit einem kurzen Kopfnicken erwartungsvoll ihre Vorfreude. Joachim Jarisch, der 55-jährige Witwer erwiderte tief nach Luft schnappend: »Es ist zwar etwas anstrengend, aber so ein ›Johannisfeuer‹ erlebt man halt nicht jeden Tag.«
»Und das ist gut so!«, ergänzte Rudi Reiser kurz und bündig. Er liebte es, ohne große Reden mit anderen, still in sich gekehrt und in alle Ruhe die Natur zu genießen. Ruckartig zog er den rechten Schultergurt seines Rucksackes, der ihm von seiner schmalen Schulter etwas herabgerutscht war, wieder hoch.
Schweigend und gleichmäßig atmete die Gruppe die modrig-würzige Waldluft ein. Im Gleichschritt stapften die Männer weiter.