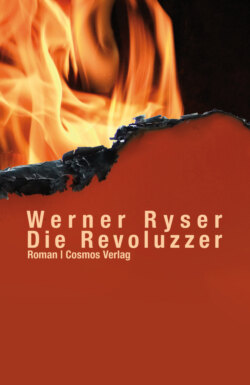Читать книгу Die Revoluzzer - Werner Ryser - Страница 11
6
ОглавлениеIm Winter, wenn es auf dem Hof weniger zu tun gab, sassen Barbara Jacob oder ihre Tochter Martha bis spät in die Nacht beim schwachen Licht einer Öllampe am Webstuhl. Sie verwoben das Garn, das Hilfsarbeiterinnen in der Fabrik in Basel durch die Zwirnmühle gedreht hatten, zu Bändern. Barbaras Vater, Emil Strub, der als Fuhrmann zweimal wöchentlich Waren zwischen Waldenburg und Basel hin und her transportierte, brachte den Faden auf den Hof. Wie die meisten Baselbieter Bandweber bezahlten auch die Jacobs Miete für den Webstuhl, in ihrem Fall an Benedikt Preiswerk, den Bruder von Madame Staehelin. Wie alle städtischen Fabrikanten hatte dieser damit jeden Produktionsschritt, von der Anschaffung des Garns bis zum Verkauf des fertigen Bandes, unter seiner Kontrolle.
Seidenbändel, mit denen man Kleider, Hüte und manchmal sogar Schuhe schmückte, waren beliebt. Aber während die Fabrikbesitzer in Basel reich wurden, waren die Posamenter draussen in der Landschaft schlecht bezahlt. In den Landvogteien des Oberen Baselbiets standen Hunderte von Webstühlen. Man war auf den Zusatzverdienst angewiesen und konkurrierte sich gegenseitig. Das drückte auf die Löhne.
Mit den einfachen Trittwebstühlen, wie sie in den meisten Haushalten standen, konnten im Gegensatz zu den Bändelmühlen, die man in der Fabrik in Basel verwendete, nur einfarbige Bänder produziert werden, die als Massenware in den Verkauf kamen.
Bevor Barbara oder Martha ihre Arbeit aufnehmen konnten, musste das Garn auf Spulen übertragen und die Kettenfäden, den Massen der bestellten Bänder entsprechend, hergerichtet werden. Diese Aufgabe, die viel Zeit in Anspruch nahm, gehörte zu Hannas Pflichten. Anschliessend bereitete die Mutter oder die Schwester den Stuhl vor. Erst zwei bis drei Tage nachdem Emil Strub das Garn geliefert hatte, konnten sie mit dem Weben beginnen.
Wenn sie auf die Pedale ihres Stuhls trat und sich die geraden und ungeraden Kettenfäden gleichzeitig hoben beziehungsweise senkten, sodass sie das Schiffchen von Hand hindurchführen konnte, hatte Barbara Musse, ihre Gedanken schweifen zu lassen. Ihr war bewusst, dass ihr der Bändelherr die Arbeit und damit einen wichtigen Teil des familiären Einkommens jederzeit entziehen konnte. Insofern waren die Jacobs nicht nur als Pächter, sondern auch als Posamenter auf das Wohlwollen von Dorothea Staehelin und deren Bruder angewiesen.
Seit Samuels Unfall wartete Barbara jeweils darauf, dass das städtische Frauenzimmer mit ihrer Tochter wieder nach Basel zurückkehrte. Meinen Goldschatz nannte Madame neuerdings ihren Jüngsten, dem sie eine Montur geschenkt hatte, von der er sich nicht mehr trennen mochte. Barbara biss sich auf die Unterlippe.
In der Nähe dieser vornehmen, stets gepflegten und schlanken Frau mit dem schmalen Patriziergesicht fühlte sie sich klein und hässlich. Sechs Geburten hatten Barbara in den Hüften breit werden lassen. Ihre abgearbeiteten, kräftigen Hände waren rot und voller Risse, und neben Dorotheas kunstvoller Frisur kam sie sich mit ihrem eigenen aschblonden, strähnigen Haar unansehnlich vor. Madame Staehelin war nicht nur schön, sondern auch noch klug, sprach Französisch und Latein, konnte malen und schrieb seitenlange Briefe. Dazu kam, dass sie und ihr Mann in der Jugendzeit einen vertrauten Umgang gehabt hatten. Barbara hatte Mathis im Verdacht, dass er noch heute mehr an die Frau dachte, als ihm guttat.
Bis zu ihrer Heirat hatte Barbara stets im elterlichen Haushalt mitgearbeitet. Sie hatte eine Magd ersetzt, und daran hatte sich bis heute, abgesehen von den zusätzlichen Pflichten als Ehefrau und Mutter, wenig geändert. Sie beklagte sich nicht. Sie wusste, in welchen Stand sie geboren war. Dass sich jedoch die reiche Dorothea Staehelin in ihre Familie drängte, ihrem Mann schöne Augen machte und versuchte, ihr den Kleinen abspenstig zu machen, das schien ihr nicht richtig.
Wenn sich Sämi aber auf sein Schemelchen neben den Webstuhl setzte und darum bettelte, sie möge ihm das Märchen vom gräulichen Landhund mit den feurigen Augen erzählen oder von den Erdweiblein und Hexen, die in den Wäldern am Hauenstein ihr Unwesen trieben, dann verschwanden die bitteren Gedanken, und Barbara wusste wieder, dass er ihr gehörte, ihr und niemand anderem.
Am liebsten hörte Samuel die Geschichte vom steinernen Ritter. Und so berichtete die Mutter zum tausendunderstenmal vom bösen Hans von Waldenburg, der einen armen Bauern in den tiefsten Kerker des Schlosses werfen liess, weil er die Fronarbeit verweigert hatte. Die Frau des armen Mannes warf sich dem Zwingherrn, als der auf seinem Ross dahergeritten kam, mit ihren Kindern in den Weg und flehte um Gnade. Doch dieser gab ihr hohnlachend einen Feldstein und meinte: «Da habt ihr etwas Brot, ihr Hungerleider». Die Frau aber verfluchte den Unmenschen und wünschte, er möge selber zu Stein werden. Und tatsächlich: Im selben Augenblick wurde der Tyrann zur grässlichen Bildsäule. Die Waldenburger aber brachen ins Schloss ein und befreiten den Gefangenen.
Für Samuel hatte der steinerne Ritter das Gesicht des Landvogts. Wenn er Hanna auf einem ihrer Botengänge ins Städtchen begleiten durfte, kam es manchmal vor, dass sie Hans Jakob Müller begegneten, der hoch zu Ross, von Knechten, seiner Familie oder irgendwelchen vornehmen Damen und Herren begleitet, zum Schloss hinaufritt. Die Schwester nahm Sämi dann jeweils an der Hand und zog ihn an den Wegrand. «Zieh deine Kappe ab!», zischte sie, während sie selber einen ungeschickten Knicks machte. Der gnädige Herr schien die beiden Bauernkinder zu übersehen, aber einmal, als Samuel staunend dastand und vergessen hatte, die Mütze abzunehmen, zügelte Müller sein Pferd und zeichnete ihm mit der Reitpeitsche die nackten Beine. «Das soll dich lehren, Bauernlümmel, das nächste Mal anständig zu grüssen!», hatte er geschrien.
«Dabei ist er nur ein Metzger», hatte sich die Mutter empört, als ihr die Kinder weinend von der Begegnung erzählten. Der Vater hatte sich die Striemen auf Samuels Beinen angeschaut. Er war bleich geworden und hatte schweigend die Stube verlassen.
Sein Hass auf den Landvogt und die Obrigkeit war grenzenlos. Er sog die Berichte über die Ereignisse in Frankreich auf wie ein Schwamm. Sein Schwiegervater brachte neben Garn und Dingen des täglichen Gebrauchs auch Zeitungen, Flugblätter und Pamphlete aus Basel ins verschlafene Waldenburgertal und gehörte selber zu jenen Männern, die sich regelmässig trafen, um über die neuesten Nachrichten aus dem Nachbarland zu diskutieren. Denn während Pfarrer Grynäus glaubte, die Bauern würden in frommen Konventikeln die Bibel auslegen, lasen sie in den dunkeln Stuben die Aufrufe, in denen sich die französische Revolutionsregierung als Schutzmacht aller Geknechteten und Benachteiligten anpries. Im ganzen Tal kursierten Abschriften von solchen Blättern, und an den Mauern von Kirchen und Gemeindehäusern wurden nachts heimlich Imprimés aus Frankreich angeschlagen, welche die politische Gleichberechtigung der Landleute forderten. Die Gnädigen Herren, die 1790 mit grossen Worten die Leibeigenschaft aufgehoben hatten, ohne den Baselbietern die Gleichberechtigung zu gewähren und ohne sie von ihren drückenden Abgaben wenigstens teilweise zu befreien, hofften vergebens, ihre Untertanen mit dieser letztlich folgenlosen Massnahme beruhigt zu haben.
Dass Mathis so empfänglich war für die frohe Botschaft aus Frankreich, war nicht allein die Folge mancher Demütigungen, die ihm Vertreter der städtischen Herrschaft zugefügt hatten. Für die Leute im Tal war er der Sohn eines Zugewanderten, der Nachkomme eines jener Anabaptisten, die regelmässig an den heimlichen Täuferversammlungen teilnahmen. Er selber hatte sich vom Glauben seiner Vorfahren zwar abgewandt, nicht zuletzt, weil sein Vater ein arger Frömmler gewesen war. Doch auch in der Basler Staatskirche, zu der er sich mehr aus Pflicht denn aus Bedürfnis bekannte, fühlte sich Mathis nicht heimisch. So brachten die Ereignisse in Frankreich in ihm den Keim der Rebellion zum Wachsen.
Zugleich galt seine Sorge auch ganz anderem Wachstum. Sobald im Frühling der Schnee am Oberen Hauenstein bis auf wenige Reste im Schatten der felsigen Gerstelfluh dahingeschmolzen war, brach Mathis Jacob mit dem Pflug ein Stück Weideland um und zerkleinerte die braunen Schollen mit der Egge, um der Erde Roggen, Gerste und Hafer anzuvertrauen, die in wenigen Monaten als Brot oder Brei auf den Tisch kommen würden.
Auch Barbara und ihre beiden Töchter bearbeiteten mit der Hacke den Pflanzgarten und düngten ihn mit den eigenen Fäkalien, der Hüsligülle, die sie aus dem Abort hinter dem Hof schöpften, damit Bohnen, Kraut, Rüben und Kartoffeln kräftig und nahrhaft wurden.
Peter trieb die Kühe auf die Weide, wo sie ihre Freude, dem dunklen Stall entronnen zu sein, mit närrischen Sprüngen zum Ausdruck brachten. Und Paul, sein jüngerer Bruder, hütete die Schafe, die man nicht unbewacht grasen lassen durfte, denn in den Wäldern hausten Wolf und Luchs.
Daneben wurde täglich Milch zu Käse und Butter verarbeitet und alle vierzehn Tage in Liestal auf dem Markt verkauft, damit genügend Geld vorhanden war, die Pacht und die Abgaben zu bezahlen, die eine nimmersatte Obrigkeit gebieterisch forderte.
Während das Leben auf Sankt Wendelin seinen gewohnten Gang ging, verfolgten die Menschen in der Stadt und Landschaft Basel die Ereignisse im letzten Jahrzehnt des achtzehnten Jahrhunderts mit leidenschaftlicher Anteilnahme. Das neue Frankreich hatte den europäischen Monarchien, die unter der Führung Österreichs und Preussens das Rad der Zeit zurückdrehen wollten, den Krieg erklärt. Im Juni 1792 marschierten eidgenössische Truppen über den Hauenstein. Die Tagsatzung hatte sich Sorgen um die Stadt Basel gemacht, denn diese lag genau zwischen den kriegführenden Mächten: Die Österreicher waren im Nordosten stationiert, im Fricktal und im Breisgau, während im Südwesten, im Fürstbistum, im Laufental und im Birseck, die Franzosen standen. Es bestand die Gefahr, dass eine der beiden Armeen einen Angriff über Basler Gebiet plante und die Eidgenossenschaft in einen Krieg verwickeln würde. Durch die Grenzbesetzung mit tausenddreihundert Mann wollte man dies vermeiden. Als im September etwa hundertfünfzig Franzosen auf der Flucht vor den Österreichern auf Basler Gebiet gelangten, wurden sie von den Eidgenossen gefangengenommen und entwaffnet, anschliessend aber wieder in die französische Festung Huningue zurückgeschickt.
Ein Jahr später kam es dort zum Gefecht, und die Bewohner der Stadt Basel hatten das zweifelhafte Vergnügen, von der Rheinbrücke aus die Bahn der feurigen Kanonenkugeln zu beobachten, die etwas weiter nördlich zwischen den Franzosen und Österreichern über den Strom hin und her flogen.