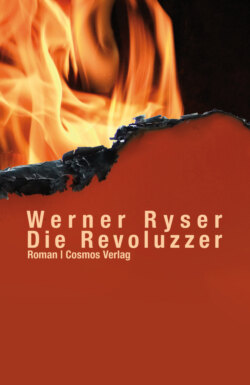Читать книгу Die Revoluzzer - Werner Ryser - Страница 6
1
ОглавлениеAm Sonntag, dem 16. Juli 1775, wollte Mathis Jacob, dessen Vater Pächter auf dem Sennhof Sankt Wendelin am Oberen Hauenstein war, mit der achtzehnjährigen Barbara Strub vor den Traualtar treten. Die Zeit drängte, denn die Braut war bereits im vierten Monat schwanger, und ihr Zustand würde sich nicht mehr lange verbergen lassen. Was noch fehlte, war der Eheschein, der in der Kanzlei des Schlosses ausgestellt wurde und für den eine Gebühr von zwei Pfund zu entrichten war. Gleichzeitig wurden Uniform und Waffen inspiziert, welche sich die Wehrmänner der Landmiliz, der Mathis wie jeder Baselbieter angehörte, auf eigene Kosten anschaffen mussten. Mathis hatte sein Steinschlossgewehr und das Bajonett gereinigt, und jetzt, vier Tage vor der Hochzeit, war er in der blauroten Montur, die seine Mutter am Vorabend ausgebürstet hatte, unterwegs Richtung Schlossberg.
Seit bald sechs Jahrhunderten beherrschte die hochmittelalterliche Veste, die wie ein Adlerhorst auf einer zerklüfteten Fluh über dem Städtchen Waldenburg thronte, die Strasse über den Oberen Hauenstein. Sie diente seit bald vierhundert Jahren den Gnädigen Herren der Stadt Basel als Sitz für die Landvögte, die in ihrem Auftrag über ihre leibeigenen Baselbieter Untertanen regierten. Die Anlage war durch eine Ringmauer und steil abfallende Felswände geschützt und bestand aus einer Hauptburg, einem Bergfried, Wohngebäuden sowie dem alten und dem neuen Schloss, einem mehrstöckigen Palas.
Gegen neun Uhr stieg Mathis die schier unendlichen Treppenstufen hinauf und durchquerte den Zwinger der Vorburg. Eine Wache, die am inneren Tor stand, wies ihm den Weg in den Empfangsraum, wo ihm ein zweiter Soldat bedeutete, Platz zu nehmen. Rund ein Dutzend Bauern und Handwerker warteten bereits. Sie waren entweder vorgeladen worden oder hatten, wie er, ein Anliegen an die Obrigkeit.
Die städtischen Landvögte in den sieben Ämtern des Kantons überwachten die von ihnen als Gemeindevorsteher ernannten Meier oder Untervögte und die dörflichen Niedergerichte. Darüber hinaus zogen sie die Steuern ein und machten, zusammen mit den Pfarrherren, die Erlasse des städtischen Rats bekannt und kontrollierten deren Einhaltung. Neben ihrem Gehalt und den Einkünften aus dem von einem Pächter geführten Bauerngut, dem Schlosshof, standen ihnen die Gebühren für die von ihrer Kanzlei ausgestellten Urkunden zu. Ausserdem erhielten sie einen Anteil der von ihnen verhängten Bussen.
Während der Schlossschreiber, Koni Schäublin, die Vorgeladenen, einen nach dem anderen, in die Kanzlei rief, unterhielten sich die Wartenden. Man erzählte sich, weshalb man hier war. Einer war verklagt worden, weil er nach seiner Hochzeit den Gästen zum Tanz hatte aufspielen lassen, ein Vergnügen, das die sittenstrengen Gnädigen Herren partout nicht dulden mochten. Zumindest nicht unter den Landleuten. Ein anderer erwartete eine Geldstrafe, weil er seine Verwandten im fricktalischen Rheinfelden besucht, also verbotenerweise fremdes, vorderösterreichisches Territorium betreten hatte. Die Rede kam auf die Willkür der Landvögte, auf die Gier, mit der sie Bussen und Gebühren eintrieben, um so ihre Amtszeit, die sie dem Losglück verdankten, möglichst ertragreich zu gestalten. Franz Brodbeck, der zurzeit das Amt Waldenburg verwaltete, hatte den Ruf, ein launischer Herr zu sein, der seine Entscheidungen ganz nach eigenem Gusto traf.
Staunend folgte Mathis Jacob der Unterhaltung. Bis heute hatte sich der zweiundzwanzigjährige Jungbauer wenig Gedanken über Fragen von Macht und Herrschaft gemacht. Wenn es im Schloss etwas zu regeln gegeben hatte, war das von seinem Vater Johannes erledigt worden. Aber die Kräfte des Alten liessen nach, und Mathis würde wohl bald den Hof und damit auch den Verkehr mit der Landvogtei übernehmen müssen.
Gegen Mittag trat der etwa dreissigjährige Schreiber in die Tür der Kanzlei und sagte, der Herr Landvogt habe die Geschäfte mit den Vorgeladenen erledigt. Jetzt sei er ausgeritten. Jene, die ein Anliegen an ihn hätten, müssten sich bis zu seiner Rückkehr gedulden.
Mathis wurde unruhig. Er hatte damit gerechnet, zum Mittagessen zu Hause zu sein. Er fragte einen älteren Mann, der ebenfalls etwas vom Landvogt wollte, wie lange es wohl dauern werde, bis der Gnädige Herr zurück sei.
Der andere zuckte mit den Schultern: «Wenn wir Glück haben, vielleicht drei Stunden. Es kann aber auch sein, dass wir morgen früh wiederkommen müssen.»
«Aber ich brauche den Eheschein! Er kann uns doch nicht einfach hängen lassen!»
«Er kann», sagte der Mann. «Glaub mir, er kann.»
Die Gespräche verstummten. Die meisten dösten auf den harten Bänken an der Wand. Mathis wanderte unruhig hin und her. Er hatte Hunger. Die Zeit zog sich in die Länge. Man hörte den Glockenschlag der Schlossuhr. Er verkündete die erste, die zweite und dann die dritte Stunde des Nachmittags.
Um vier Uhr wurde die Tür zur Kanzlei wieder geöffnet, und der Erste der Wartenden durfte sein Anliegen vortragen. Er schien seine Sache schlecht zu vertreten. Bis in den Empfangsraum hörte man die Stimme des Landvogts, der den Bittsteller lautstark massregelte. Mit betretenem Gesicht kam der Mann heraus. Wortlos verliess er den Ort seiner Niederlage. Auch den beiden Nächsten, die vorgelassen wurden, ging es nicht besser. Der Lärm, der aus der Kanzlei drang, machte deutlich, dass sich die Laune des Gnädigen Herrn zusehends verschlechterte.
Dann war Mathis an der Reihe. Er trat über die Schwelle. Franz Brodbeck lag halb in seinem grossen, geschnitzten Sessel, die Hände über dem Bauch gefaltet. Koni Schäublin beugte sich hinter seinem kleinen Pult über irgendwelche Akten.
«Nimm Stellung an!», bellte der Landvogt. Und während Mathis Jacob steif und starr dastand, sein Gewehr vorschriftsgemäss mit der Linken am Lauf umklammerte und gegen Hüfte und Ferse presste, erhob sich der Herr, umkreiste ihn lauernd und musterte ihn aus zusammengekniffenen Augen. Mathis kam sich vor wie ein Stück Vieh, das auf dem Markt vom Händler begutachtet wurde.
«Wenigstens einer, der nicht aussieht wie ein vollgeschissener Strumpf», knurrte Brodbeck schliesslich. «Rühr dich! Was willst du?»
Er bitte untertänigst um einen Eheschein, sagte der junge Mann.
«Das kostet zwei Pfund. Hast du das Geld?»
Mathis holte seinen Beutel aus der Tasche. Schäublin fragte nach seinem Namen und dem seiner Braut. Alles wurde notiert. Und während der Hochzeiter umständlich die geforderten vierzig Schillinge, die ihm der Vater gegeben hatte, auf den Tisch zählte, wollte der Vogt wissen, wann die Trauung sei.
«Am Sonntag, Gnädiger Herr.»
«Was?», schrie Brodbeck. «Seid ihr schon verkündet?»
«Ja, Gnädiger Herr.»
«Der Pfaffe weiss, dass er niemanden verkünden darf, bevor ich nicht die Einwilligung gegeben habe. Ich will ihn lehren, sich an Recht und Ordnung zu halten. Sag ihm, dass ich ihn beim wohlweisen Herrn Bürgermeister verklagen werde. Und nun verschwinde!» Er wandte sich an den Schreiber: «Ihr werdet dem Bauern keinen Schein ausstellen.»
«Aber Gnädiger Herr …», begann Mathis, der an seine schwangere Braut und an das bereits bestellte Hochzeitsessen im Wirtshaus dachte.
«Schweig», brüllte Brodbeck, «oder ich lasse dich ins Verlies sperren, wo du Zeit hast, darüber nachzudenken, wie man sich gegenüber seiner Obrigkeit benimmt!»
Mathis spürte, wie der Zorn in ihm hochkroch. Was konnte er dafür, dass sich Pfarrer Werthemann nicht an die Regeln gehalten hatte. «So gebt mir wenigstens mein Geld zurück …»
Weiter kam er nicht. Der Landvogt hieb mit der flachen Hand auf den Tisch. «Der Kerl kommt für fünf Tage bei Wasser und Brot ins Loch!», schrie er. «Das wird ihn lehren, wie sich ein Bauernlümmel gegen seine Herrschaft zu benehmen hat. Schaff ihn hinaus.»
Schäublin stand auf und drängte Mathis aus dem Zimmer. «Komm», flüsterte er dem sich Sträubenden ins Ohr, «mach dich nicht unglücklich. Fünf Tage sind keine Zeit.»
Draussen im Empfangsraum wies er die Wache an, Mathis in den Kerker zu bringen.
Es war ein finsteres Loch, in das man Mathis Jacob eingesperrt hatte. Aus einer schmalen Luke fiel nur wenig Licht in den engen Raum mit vier feuchten Mauern aus rohen Quadersteinen und einem gestampften Lehmboden. Seine Notdurft würde er in einer Ecke verrichten müssen. Er setzte sich auf eine aus ungehobelten Brettern gefügte Pritsche. Noch immer war er voller Zorn über die Willkür des Landvogts. Zu Hause wartete man auf ihn. Auch seine Braut würde gegen Abend von Waldenburg, wo sie lebte, nach Sankt Wendelin hinaufsteigen, um mit ihm noch dieses und jenes im Zusammenhang mit der Hochzeit zu besprechen, die nun gar nicht stattfand, jedenfalls nicht am nächsten Sonntag. Hoffentlich erzählte ihr der Schlossschreiber, der auch im Städtchen wohnte, was geschehen war.
Seiner misslichen Lage zum Trotz lächelte Mathis, als er sich vorstellte, wie Barbara zetern würde, wenn sie von seinem Missgeschick erfuhr. Sie war ein temperamentvolles Ding und würde ihn dafür verantwortlich machen, dass sie nun mit dickem Bauch vor den Altar treten musste und man sich im ganzen Tal das Maul über das hitzige junge Paar zerreissen würde, das nicht hatte warten können und es bereits vor der Hochzeitsnacht miteinander getrieben hatte.
Mathis hatte seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Wasser und Brot, hatte der Landvogt gesagt. Ob er bereits heute etwas bekommen würde? Er glaubte es nicht. Der Hunger, die Dunkelheit, das Nichtstun – ihm standen wohl die fünf längsten Tage seines bisherigen Lebens bevor.
Während er so dasass, den Kopf in die Hände gestützt, fiel ihm ein, dass er nicht der erste Jacob war, den man ins Verlies geworfen hatte. Seine Vorfahren waren im letzten Jahrhundert im Emmental als Täufer verfolgt worden. Den Urgrossvater, Ueli Jacob, hatten die Gnädigen Herren von Bern seines Glaubens wegen zu einer Galeerenstrafe verurteilt. Auf einer Ruderbank angeschmiedet, war er elend zugrunde gegangen. Seine Frau Anna, die sich gegen die Obrigkeit aufgelehnt hatte, war im Schloss Trachselwald eingekerkert und dann aus ihrer Heimat verbannt worden. Mit ihren drei Jüngsten war sie auf den Sonnenberg im Fürstbistum Basel gezogen, wo man mit Erfolg eine Käserei geführt hatte. Ihr Enkel Johannes, der Vater von Mathis, hatte keinerlei Aussicht, den Betrieb übernehmen zu können, denn dieser wurde nach bernischer Tradition an den jüngsten Sohn vererbt. So wanderte er in den Baselbieter Jura aus. Am Oberen Hauenstein, auf halber Höhe zwischen dem Städtchen Waldenburg und Langenbruck, fanden er und seine Familie ein Auskommen als Pächter von Sankt Wendelin, einem Sennhof, der dem reichen Basler Seidenfabrikanten Remigius Preiswerk gehörte. Der Bändelherr hatte ihn vor zwei Jahren, als seine Tochter Dorothea den Obristen Staehelin heiratete, der jungen Frau als Mitgift überschrieben.
Mathis legte sich auf die harte Pritsche und starrte in die Dunkelheit. Was wohl die Leute auf Sankt Wendelin machten?
Zur selben Stunde sassen dort Elisabeth Preiswerk, eine geborene Debary, und ihre Tochter Dorothea vor dem Hof an ihren Staffeleien und bemühten sich, den rot flammenden Abendhimmel über den bewaldeten Hügeln im Westen auf die Leinwand zu bannen. Remigius Preiswerk stand hinter ihnen. Er unterbrach seine wenig kunstsinnigen Bemerkungen, mit denen er das Schaffen der beiden Frauenzimmer kommentierte, und starrte stirnrunzelnd auf seinen Pächter, der vergeblich versuchte, die hemmungslos weinende Braut seines Sohnes zu trösten. Sie war soeben auf Sankt Wendelin eingetroffen.
«Was hat denn die Dirne so zu heulen», knurrte Preiswerk schliesslich. «Geh, frag sie», befahl er Dorothea.
Die junge Frau gehorchte widerwillig. Es widerstrebte ihr, sich in die Angelegenheiten der Jacobs zu mischen.
Schluchzend erzählte Barbara Strub, sie habe vor einer Stunde vom Schlossschreiber Schäublin erfahren, dass der Landvogt ihren Mathis für fünf Tage ins Loch gesteckt habe und dass nun am Sonntag nichts aus der Hochzeit werden könne.
Der Seidenbandfabrikant, der zu ihnen getreten war, hörte zu. «Soso», bemerkte er spöttisch. «Und den Pfarrer Werthemann will er beim wohlweisen Herrn Bürgermeister verklagen.» Dann wandte er sich barsch an die weinende Barbara: «Hör auf zu flennen, das bringt jetzt auch nichts! Ich werde morgen ins Schloss reiten und die Sache regeln.»
Als Remigius Preiswerk am nächsten Tag von seinem Ausritt zurückkam, übergab er Dorothea den Eheschein. «Bring ihn zu Johannes und sag ihm, sein Sohn könne heiraten, sobald er seine Strafe abgesessen habe.» Er war gut gelaunt. Auf ihre Frage, wie er das Kunststück fertiggebracht habe, den Landvogt umzustimmen, erklärte er: «Ich habe dem Parvenü mit seinem wohlweisen Herrn Bürgermeister gedroht.»
Dorothea begriff. Für den reichen und angesehenen Fabrikanten und Handelsherrn, der als Dreizehnerrat dem wichtigsten Kollegium der Basler Obrigkeit angehörte, waren Zeitgenossen wie Brodbeck Nonvaleurs. Selbst wenn sie ein gewisses Vermögen besassen, stammten sie nur aus Handwerkerkreisen. Für solche Leute war das Amt eines Landvogts, das sie nur dank Losglück erhielten, bereits die höchste Stufe, die sie erreichen konnten. Brodbeck gehörte eben nicht zu jenen alteingesessenen Familien wie die Burckhardts, die Vischers, die Staehelins, die Preiswerks, die Iselins oder die Werthemanns, die über die Verhältnisse im Kanton Basel bestimmten. Als Mitglied des Kleinen Rats war der Vater letztlich Vorgesetzter des Landvogts. Ausserdem war er nicht nur mit dem Pfarrer von Waldenburg, sondern über seine Frau auch mit dem Bürgermeister Johannes Debary verwandt. Dass Brodbeck damit gedroht hatte, Werthemann beim Staatsoberhaupt zu verklagen, war für ihn unfassbar. Er hatte den Wichtigtuer auf den ihm gebührenden Platz verwiesen.
«Und wann kommt Mathis zurück?», wollte Dorothea wissen.
«Der wird seine Strafe abhocken müssen», knurrte Preiswerk. «Ich habe ihm übrigens noch fünf weitere Tage aufgebrummt. Es ist höchste Zeit, dass der Kerl lernt, was ein Herr und was ein Knecht ist.» Er wandte ihr den Rücken zu und stolzierte über den Hof. Am Sonntag würden er und seine Frau nach Basel fahren.
Dorothea sah ihrem Vater nach. Sie hasste ihn. Er war ein machtbesessener, auf seine Würde bedachter städtischer Patrizier, der das Glück seiner Mitmenschen bedenkenlos mit Füssen trat, wenn es um seine eigenen Interessen ging. Manchmal geschah dies gar aus einer blossen Laune heraus. Nicht nur Mathis, auch sie selbst war ein Opfer der väterlichen Willkür.
Mathis war zwei Jahre älter als sie. In ihrer Jugend waren sie unzertrennlich gewesen. Sie begleitete ihn auf die Weide und in den Wald. An seiner Seite half sie bei der Heuernte mit. Er brachte ihr das Melken bei. Einmal durfte sie dabei sein, als eine Kuh kalbte. Dorothe nannte er sie – bis zu jenem Tag vor vier Jahren, als ihr Vater zwischen seinen Geschäften in der Stadt wieder einmal für zwei oder drei Tage nach Sankt Wendelin kam. Preiswerk machte dem damals Achtzehnjährigen unmissverständlich klar, dass er als Sohn des Pächters seine Tochter als Jungfer Dorothea anzusprechen habe. Er hatte ihn unterm Kinn gefasst und gezwungen, ihm in die kalten Augen zu schauen. «Jungfer und Dorothea. Dorothea, nicht Dorothe. Sie ist schliesslich keine Bauerndirne. Hast du das verstanden?» Und als der junge Mann eingeschüchtert schwieg, lauter: «Hast du das verstanden?»
«Ja, Herr», presste Mathis zwischen den Zähnen hervor.
«Na also, es geht doch.» Remigius Preiswerk wandte sich an Mathis’ Vater, der schweigend danebenstand. «Wenn du auf dem Hof Pächter bleiben willst, Johann», knurrte er, «dann sorg dafür, dass die Ordnung der Dinge gewahrt bleibt.»
Später, beim Nachtessen, oben in der Wohnung, begehrte sie gegen den Alten auf. Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen: «Ich bin nicht die Jungfer Dorothea!», schrie sie. «Nicht für Mathis.»
Er zog die Brauen zusammen. «Jungfer Dorothea und später Madame und der Name des Mannes, den ich für dich aussuchen werde.»
«Nein.» Sie ballte die Fäuste.
«Nein?» Remigius Preiswerk packte sie, legte sie übers Knie und verprügelte sie mit seinem Stock. «Wer bist du?», brüllte er, immer wieder. «Wer bist du?» Er liess erst von ihr ab, als sie ihm schluchzend bestätigte, sie sei die Jungfer Dorothea.
Am andern Tag, als sie sich vor dem Hof begegneten, schauten sich die beiden Jungen verstört an. «Grüss dich, Mathis», sagte sie schliesslich.
«Grüss Euch.» Er schaute sie kurz an und lief dann in Richtung Wald davon.
Damals war etwas in ihr zerbrochen. Zwei Jahre später wurde Dorothea, ohne dass man sie nach ihrer Meinung gefragt hätte, standesgemäss mit dem mehr als doppelt so alten Christoph Staehelin verheiratet. Nachdem dieser während Jahren als Offizier in einer der vier Basler Kompanien in Frankreich gedient hatte, wurde er Oberst bei der Landmiliz. Die Ehe war nicht glücklich. Trotz Dorotheas Bitten und Drängen weigerte sich Staehelin, ein ausgesprochener Libertin, sein Verhältnis mit einer Dame von zweifelhaftem Ruf aufzugeben.
Dass sie zur Heirat den Hof Sankt Wendelin als Brautgabe erhalten hatte, war für sie ein Trost. Staehelin war kurz nach der Hochzeit einmal dort gewesen. Aber das Landleben behagte ihm nicht. Dorothea hingegen verbrachte die Zeit zwischen Johanni und Michaelis meist auf dem Hof.
Mathis schloss, vom ungewohnten Licht geblendet, die Augen. Die Tür zu seinem Kerker war endlich aufgeschlossen worden, und eine Laterne erleuchtete das Verlies. Gestern hätte seine Hochzeit stattfinden sollen. Jetzt würde man ihn laufenlassen.
«Das stinkt ja wie in einem Schweinestall», sagte Brodbeck angewidert und trat einen Schritt zurück. Der Landvogt hatte sich persönlich zu ihm in die Unterwelt bemüht. Eine Wache begleitete ihn. «Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt», knurrte er.
«Ja, Gnädiger Herr», sagte Mathis, gewillt, den Zorn zu bezähmen, der ihm geholfen hatte, die vergangenen Tage zu überstehen.
«Nun, der Ratsherr Preiswerk war der Meinung, die fünf Tage, zu denen ich dich verurteilt habe, seien für einen Flegel wie dich zu wenig, um ihn zur Besinnung zu bringen. Wir werden dich deshalb bis Ende Woche hierbehalten.» Brodbeck sah seinen Gefangenen lauernd an.
Mathis biss sich auf die Unterlippe
«Du hast nichts dazu zu sagen?»
«Nein, Herr», sagte er gepresst.
«Weiterhin Wasser und Brot!», befahl der Landvogt der Wache. «Und nun sperr die Türe wieder zu!»
Wie betäubt liess sich Mathis auf die Pritsche fallen. Seit Remigius Preiswerk ihm zu verstehen gegeben hatte, dass er keinerlei freundschaftlichen Verkehr zwischen ihm und Dorothea dulde, hatte er den Sohn seines Pächters mit Misstrauen beobachtet. Mathis wusste, dass der Tyrann an jenem Abend seine Tochter gezüchtigt hatte. Er war damals im Hof unter dem offenen Fenster gestanden, ohnmächtig, mit geballten Fäusten.
Mathis hatte sich geschämt, dass er unfähig war, sie vor ihrem Vater zu schützen. Er war überzeugt, ihrer nicht wert zu sein. Seither hatte er sich von Dorothe – für ihn war sie Dorothe geblieben – ferngehalten. Und er hatte auch stets darauf geachtet, dem Alten nicht in die Quere zu kommen. Weshalb hatte Remigius Preiswerk trotzdem seine Kerkerhaft verlängert? Aus schierer Boshaftigkeit? Ging es ihm darum, seine Macht zu demonstrieren und ihn, den leibeigenen Untertanen, klein zu halten?
Mathis spürte, wie sich zum Zorn der vergangenen Tage der Hass gesellte, ein kalter, abgrundtiefer Hass: auf den Landvogt, auf Remigius Preiswerk, auf die Gnädigen Herren von Basel. Und er fühlte, dass dieser Hass ihn künftig begleiten würde.
Am 22. Juli blieb Dorothea Staehelin in ihrer Wohnung. Sie wusste, dass Mathis heute im Verlauf des Tages aus seiner Haft entlassen würde. Das niederträchtige Handeln ihres Vaters erfüllte sie mit Scham, und die Vorstellung, dass Mathis glauben könnte, sie sei damit einverstanden gewesen, quälte sie. Was sollte sie tun oder sagen, wenn sie ihm draussen vor dem Haus gegenüberstehen und er an ihr vorbeigehen würde, ohne sie zu beachten?
Sie hatte sich mit einer Stickerei ans Fenster gesetzt, aber sie mochte nicht arbeiten. Sie dachte an das schwärmerische junge Mädchen, das sie einst gewesen war. Ihr Herz war weit geworden, wenn sie das Geläut der Herden und den morgendlichen Gesang der Vögel gehört hatte. So hatte sie es jedenfalls in einem Brief an ihre Freundin, Anna Sarasin, formuliert. Was sie ihr aber nicht geschrieben hatte: In Mathis Jacob, dem Sohn des Pächters, sah sie das lebende Vorbild für den allerliebsten Schäfer in seinem Rokokokostüm, das in der Manufaktur von Meissen hergestellt worden war und im elterlichen Haus zum Goldenen Falken am Nadelberg die Kredenz zierte.
Vom Vorhang halb verborgen, schaute sie immer wieder aus dem Fenster. Endlich, um die Vesperzeit, sah sie, wie Mathis vom Wald her auf den Hof zuschritt: ein Soldat der Landmiliz, das Gewehr an einem Riemen über die Schulter gehängt. Ihr Herz klopfte wie wild, und sie spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. Seine Uniform war verschmutzt, sein Gesicht ausgezehrt vom zehntägigen Fasten, sein schwarzes, struppiges Haar fiel ungekämmt über die Ohren, und seine unrasierten Wangen und das Kinn schimmerten bläulich. Das war nicht mehr der romantische Schäfer ihrer Jungmädchenträume, das war ein Krieger, der stattlichste Mann, dem Dorothea je begegnet war.
Mathis schaute zum Fenster hoch. Ihre Blicke kreuzten sich. Zaghaft hob sie die rechte Hand. Huschte ein Lächeln über sein Gesicht? Sie glaubte, es gesehen zu haben. Sie wollte es gesehen haben.