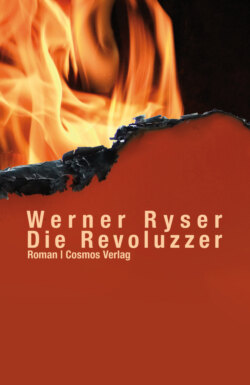Читать книгу Die Revoluzzer - Werner Ryser - Страница 15
10
ОглавлениеDie Zeit heile alle Wunden, sagt der Volksmund. Barbara Jacob zweifelte daran. Das Bild, wie ihr Mann die vornehme Dorothea Staehelin in jener Nacht auf die Stirn geküsst hatte, liess sie nicht mehr los. Ihr war, als habe sich ein Schatten, der alle Fröhlichkeit erstickte, über sie gelegt. Sie fühlte sich unwert, als sei sie ein Gegenstand, den man fallen gelassen und beschädigt hatte. Zwar nutzte man ihn noch, konnte sich aber nicht mehr über ihn freuen. Obwohl erst achtunddreissigjährig, kam sie sich alt und verbraucht vor. Sie tat, was zu tun war, so, wie sie es immer getan hatte: Sie kochte, putzte und sass am Bandstuhl. Sie besorgte den Pflanzgarten, half auf dem Hof mit, wenn man sie brauchte, aber sie tat es mechanisch, tat es, weil es getan werden musste, weil sie nicht wusste, was sie sonst hätte tun sollen.
Madame Staehelin und ihre Tochter waren längst wieder in Basel. Das Leben auf Sankt Wendelin ging seinen gewohnten Gang. Ihr Mann war nicht anders als früher, verlässlich, schweigsam – und dennoch hatte sich alles verändert. Er war ihr fremd geworden. Nachts im Bett rückte sie von ihm ab, lag auf dem Rücken, starrte in die Dunkelheit, weinte in sich hinein. Mathis schien es nicht einmal zu bemerken, spürte nicht, dass sie litt, dass sie welkte wie eine Blume, der es an Wasser mangelt. Er lag neben ihr und schlief, während sie sich danach sehnte, dass er ihr ein liebes Wort schenkte, sie an sich zöge, tröstete und alles wieder gut würde.
Stattdessen schien es ihr, die Familie falle auseinander. Die drei Grossen waren erwachsen geworden. Noch lebten sie zu Hause, aber sie suchten ihren eigenen Weg. Die zwanzigjährige Martha übernahm immer mehr Pflichten im Haushalt. Barbara glaubte manchmal, ihre älteste Tochter versuche, sie zu verdrängen. Dabei wollte sie die Mutter nur entlasten. Sie war ein seltsames Mädchen, untersetzt und stämmig, dabei wortkarg und spröde. Sie zeigte keinerlei Interesse am anderen Geschlecht. In der Kirche schaute sie nie auf die Männerseite hinüber. Wenn ein Bursche aus der Umgebung ihr schöne Augen machte, sie scherzend ansprach, liess sie ihn mit einem strafenden Blick abblitzen. Mit der Zeit mieden sie die jungen Männer. Sie schien es nicht wahrzunehmen und würde wohl als alte Jungfer enden. Erbittert dachte Barbara, dass das wohl nicht die schlechteste Form sei, sein Leben zu leben.
Peter und Paul waren anders. Wenn sie mit ihrem Vater in den schmucken dunkelblauen Uniformen mit den scharlachroten Auf- und Überschlägen zu den Drillübungen der Landmiliz gingen, so konnte man sicher sein, dass Mathis am Abend allein heimkehren würde. Die beiden jungen Männer, vor überschüssiger Kraft strotzend und stössig wie Stiere, trieben sich bis in den frühen Morgen im Dorf herum, zunächst im Wirtshaus, später auf dem Kiltgang. Sie flüsterten den Mädchen durchs offene Fenster unbeholfene Zärtlichkeiten zu und waren selig, wenn sie von einer, die freizügiger war als ihre grosse Schwester, zu einem Glas Kirschwasser eingeladen wurden. Barbara war überzeugt, dass irgendeinmal einer ihrer Söhne einem dummen Ding, wie sie es selber einmal gewesen war, ein Kind anhängen werde, und man konnte nur hoffen, dass der Pfarrer dann seinen Segen dazugeben würde, bevor das arme Würmchen auf der Welt war.
Peter, der zu einem tüchtigen Bauern herangewachsen war, würde wohl dereinst als Pächter den Hof übernehmen und Salome Staehelin die Zinsen zahlen – genau gleich wie jetzt Mathis ihrer Mutter zinste und vor ihm sein Vater dem alten Remigius Preiswerk die Pacht entrichtet hatte.
Der siebzehnjährige Paul interessierte sich für die Ereignisse in Frankreich, weil er gehört hatte, dass dort jeder Soldat den Marschallstab im Tornister trage. Sehr zum Missfallen seines Vaters, der von seinen taufgesinnten Vorfahren eine tiefe Abneigung gegen alles Militärische geerbt hatte, stand für ihn fest, dass er in einem oder zwei Jahren Handgeld nehmen und sein Glück in fremden Diensten suchen würde.
Barbara musste sich eingestehen, dass ihr die drei Grossen entwachsen waren. Und den Jüngsten, Sämi, hatte ihr zuerst Madame und dann ihr eigener Mann entfremdet. Unverdrossen sass dieser jeden Abend mit dem Kleinen am Tisch und liess sich von ihm erklären, was Sebastian Hoffmann ihn und die Grynäus-Kinder tagsüber gelehrt hatte. Wenn Mathis etwas nicht verstand, fragte er nach und liess nicht locker, bis auch er den Schulstoff, dessen Kenntnis die Voraussetzung für Samuels Aufnahme ins Pädagogium bildete, begriffen hatte. Den Jungen erfüllte es mit Stolz, dass er seinen Vater unterrichten durfte. Seit sie Abend für Abend gemeinsam ihre Köpfe über den Fibeln zusammensteckten, tauchte er kaum mehr im rückwärtigen Anbau des Hauses auf, wo Barbara am Webstuhl sass und mehr und mehr in eine Einsamkeit fiel, aus der sie nicht mehr herausfand. Mit verständnisloser Verwunderung verfolgte sie den verbissenen Lerneifer ihres Mannes, mit dem er, wie sie sich einredete, nichts anderes als Dorothea Staehelin imponieren wollte.
Auch Hanna war unglücklich. Ebenso wie die Mutter spürte sie den Zerfall der Familie. Die Eltern hielten die Sechzehnjährige kurz. Sie durfte sich nicht wie die älteren Brüder in Waldenburg herumtreiben. Martha, die ihren Fragen verständnislos gegenüberstand, gab sich kaum mit ihr ab. Auch Sämi, um den sie sich früher oft gekümmert hatte, brauchte sie nicht mehr. Anfangs hatte sie sich zum Vater und dem kleinen Bruder an den Tisch gesetzt. Doch was die beiden zu besprechen hatten, verwirrte sie. Auch bei der Mutter, die am Bandstuhl Trübsal blies, hielt es sie nicht lange. Vom Hof kam sie nur weg, wenn sie für Madame Staehelin oder die Eltern im Städtchen etwas besorgen musste. Hanna war von Natur aus ein lebenslustiges Wesen, aber jetzt, wo auf Sankt Wendelin kaum mehr fröhliche Worte gewechselt wurden, wo alle anderen mit sich selbst beschäftigt waren, kam sie sich überflüssig vor. Sie verlor sich in Tagträumereien und baute sich eine eigene versponnene Welt auf.
Unberührt von den grossen und kleinen Sorgen der Leute von Sankt Wendelin schritt das Jahr voran. Als man das Getreide eingebracht hatte, als die reifen Äpfel, Birnen und Nüsse geerntet waren und als nach dem dritten Schnitt das Vieh zum Nachweiden auf Wiesen getrieben wurde, kündeten die zarten, blasslila Blüten der Herbstzeitlosen die dunkle Jahreszeit an. Die Zugvögel hatten sich längst Richtung Süden verabschiedet, und in der Abenddämmerung hörte man das dumpfe Brüllen brünstiger Hirschstiere.
Der November brachte eine Reihe von Regentagen und mit ihnen eine feuchte Kälte, die durch Haut und Knochen ging. Das Vieh war jetzt nachts in den Ställen, und bald würde man die Kühe auch tagsüber nicht mehr auf die Weide treiben können. Tatsächlich kam Anfang Dezember der Winter mit Schnee und Eis. Unter seiner Herrschaft erstarrte das Land am Oberen Hauenstein. Aber nach Lichtmess, wenn die Sonne jeden Tag wieder ein wenig früher über dem Hügelkamm erschien und abends etwas später hinter dem westlichen Horizont versank, schien es Mathis Jacob, als spüre er die Kräfte, die sich unter der Erde zu regen begannen. Und wie jedes Jahr war ihm, als sei es ein unfassbares Wunder, wenn im März die Natur zu neuem Leben erwachte, wenn der Schnee an der Sonne schmolz und an den aperen Stellen die ersten Krokusse das Licht des kommenden Frühlings und mit ihm das neue Bauernjahr begrüssten.
Am Gründonnerstag spannte Mathis seine beiden Pferde vor den Pflug, um das Feld für die Aussaat zu bestellen. Ab und zu schaute er hinüber zu seiner Frau, die zusammen mit Hanna ihren Pflanzplätz düngte. Dem Mädchen fiel die unangenehme Aufgabe zu, die stinkende Brühe aus dem Abort hinter dem Haus in einen Eimer zu schöpfen, den sie über die Beete leerte, wo die Mutter sie mit einem Rechen verteilte.
Mathis seufzte. Seine Frau war stets die Seele der Familie gewesen. Doch nun lag manches im Argen zwischen ihm und ihr. Barbara hatte ihre Zuversicht und Fröhlichkeit verloren. Zuerst hatte er geglaubt, es handle sich um eine vorübergehende Weiberlaune. Aber dann hatte er realisiert, dass er der Anlass für ihre Verstimmungen sein musste. Tagsüber behandelte sie ihn wie einen Fremden, nachts verweigerte sie ihre eheliche Pflicht. Er wusste nicht, dass sie ihn in jener Nacht beobachtet hatte, als er Dorotheas Stirn geküsst hatte, wusste nicht, dass sie ihm Treulosigkeit und Verrat vorwarf, wusste nicht, dass sie ihm zürnte, weil sie überzeugt war, er habe ihr mit seinem Lerneifer den kleinen Samuel entfremdet.
Mathis und Barbara Jacob waren einfache Leute, die nie gelernt hatten, über Dinge jenseits des Alltäglichen miteinander zu sprechen. Fühlten sie sich vom anderen verletzt, so schwiegen sie, frassen in sich hinein, was sie beschäftigte, und hofften auf bessere Zeiten.
Drüben im Pflanzgarten streckte sich Barbara, um ihren müden Rücken zu entlasten. Sie stiess mit Hanna zusammen, die mit ihrem Kessel voller Fäkalien hinter ihr stand, und schürfte sich dabei an der schartigen Kante des Gefässes wund. Ein Schwall Hüsligülle schwappte über ihren Arm. «Kannst du nicht aufpassen, du ungeschickter Trampel?», schimpfte sie und gab dem Mädchen eine Ohrfeige.
Hanna stellte den Eimer ab und lief davon.
Barbara schaute ihr nach und wischte sich mit der Hand die Bescherung vom Arm. Sie war es gewohnt, beim Düngen mit Scheisse in Berührung zu kommen. Die Wunde, die nur wenig blutete, war kaum der Rede wert.
«Hast du dich verletzt?», wollte Mathis wissen, der die Szene beobachtet hatte.
«Was kümmert dich das?», fragte sie unfreundlich. «Sorg dafür, dass deine Tochter weiterarbeitet!»
Deine Tochter! Er runzelte die Stirn, schwieg aber und ging zum Stall, wo Hanna weinend hinter der Tür stand. Er legte ihr die Hand auf die Schulter. «Sie hat es nicht so gemeint», sagte er tröstend.
«Natürlich hat sie es so gemeint», schniefte Hanna. «Nichts kann man ihr recht machen. Seit Monaten hat sie für keinen mehr ein gutes Wort.» Und dann, kaum hörbar: «Ich hasse sie.»
Mathis fuhr ihr ungeschickt durchs Haar, das sie zu einem dicken Zopf geflochten hatte. «Nun geh schon wieder an deine Arbeit, Kind. An einer Ohrfeige ist noch niemand gestorben.»
Am Abend mochte Barbara nichts essen. Obwohl das Haus die Wärme dieses schönen Frühlingstags gespeichert hatte, zitterte sie am ganzen Leib und fror erbärmlich. Sie legte sich ins Bett und schlotterte unter den Decken, die ihr Martha gebracht hatte.
Am Morgen des Karfreitags hatte sie hohes Fieber. «Es wird schon wieder werden», sagte sie, als Mathis wissen wollte, ob man Doktor Alioth holen solle. «Mach dir keine Sorgen. Ich brauche jetzt einfach etwas Ruhe. Ihr müsst ohne mich zur Kirche.»
Mathis sah seine Frau verwundert an. Ihre Stimme klang anders als in den letzten Monaten: schwach, ängstlich. Ihre Augen flehten um Hilfe. Er legte seine Hand auf ihre Stirn. Sie war mit kaltem Schweiss bedeckt.
Als er und die Kinder gegen Mittag vom Gottesdienst zurückkamen, lag sie blass und kraftlos im Bett. Ihre Brust hob und senkte sich in raschem Rhythmus. Ihr rechter Unterarm war dort, wo sie sich am Kesselrand geschnitten hatte, gerötet. Als Mathis mit dem Zeigefinger darüberfuhr, schrie sie leise auf. «Nicht!» Sie biss sich auf die Unterlippe. «Das tut weh.» Aber noch immer verweigerte sie starrsinnig den Arzt: «Ich brauche ihn nicht. Morgen werde ich wieder arbeiten. Heute müsst ihr ohne mich auskommen. Lasst mich jetzt in Ruhe.»
Die fünf Kinder, die ums Bett der Mutter standen, schauten sich ratlos an. Dann zuckte Paul mit den Schultern und verliess den Raum. Bis auf Samuel folgten ihm alle, auch Mathis. Der Jüngste kniete sich an den Bettrand und legte seinen Kopf auf die Decke. Die Mutter streichelte seinen Haarschopf. Sie hatte die Augen geschlossen. Ein kaum wahrnehmbares Lächeln spielte um ihre Lippen. Nach einer Weile fiel sie in einen fiebrigen Schlummer. Ihre Hand blieb auf dem Kopf des Kindes. Es wagte nicht, sich zu rühren.
Im Lauf des Karsamstags sah Mathis zwischen der entzündeten Stelle und dem Oberarm der Kranken rote Striche auf der blassen Haut. Barbara schien verwirrt. Sie stammelte Worte, die für ihn keinen Sinn ergaben. Er befahl Hanna, nach Langenbruck zu gehen und den Arzt zu bitten, nach Sankt Wendelin zu kommen. Nach zwei Stunden kehrte das Mädchen zurück. Die Alioths seien über die Ostertage zu Verwandten nach Basel gefahren. Ihre Magd erwarte die Herrschaft nicht vor Dienstag zurück.
Der Zustand Barbaras verschlechterte sich zusehends. Ihr Atem ging keuchend. Sie hatte die Augen jetzt meist geschlossen. Mathis, der vergeblich versuchte, ihr etwas von der Brühe einzuflössen, die Martha zubereitet hatte, wusste nicht, ob sie wach war oder schlief.
Einmal, mitten in der Osternacht, umklammerte sie seinen Arm. «Ich höre den Tod hier drinnen trommeln», flüsterte sie und in ihrer Stimme war Panik. «Hier drinnen.» Sie klopfte sich auf die Brust. Dann sank sie zurück ins Kissen und murmelte unverständliche Worte. Ihm schien, sie sei für ihn nicht mehr erreichbar.
Am Ostersonntag war sie leichenblass, und wenn sie die Augen öffnete, so schienen sie tiefer zu liegen als sonst. Die Nase ragte spitz aus ihrem Gesicht.
Mathis, der jetzt wusste, dass sie sterben würde, wich nicht mehr von ihrem Bett. Er dachte daran, wie er um sie geworben und wie der Landvogt ihnen die Heiratserlaubnis verweigert hatte. Die vielen Jahre, die sie zusammen verbracht hatten, zogen an ihm vorbei, die Geburten der Kinder, die guten und die schlechten Tage. Er dachte an die vergangenen Monate, wie sie mit ihm gehadert hatte, und daran, dass es jetzt für eine Versöhnung zu spät war. Er stützte die Ellenbogen auf die Knie und verbarg sein Gesicht in den Händen. Weinte er? Seine Kinder, die eines ums andere die Kammer betreten hatten, sahen es mit Verwunderung.
Am Abend zündete Martha zwei Kerzen an. Samuel presste sich an Hanna, die ihre Hände auf seine schmalen Schultern legte. Der Atem der Sterbenden ging rasselnd. Kurz nach Mitternacht verschied Barbara Jacob.