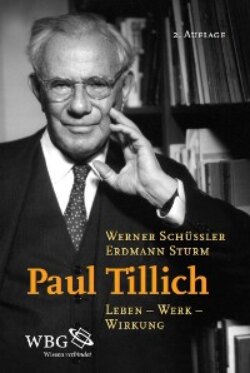Читать книгу Paul Tillich - Werner Schüßler - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ 7 „Unbedingter Sinn“, „Sozialistische Entscheidung“ und „Beurlaubung“ (Frankfurt am Main, 1929–1933)
ОглавлениеAm 1. April 1929 übernahm Tillich – auf Betreiben des preußischen Kultusministers Becker – den durch die Emeritierung von Hans Cornelius frei gewordenen Lehrstuhl für Philosophie und Soziologie einschließlich Sozialpädagogik an der Universität Frankfurt. Mit der Antrittsvorlesung „Philosophie und Schicksal“ (vgl. M I, 307–340) stellte er sich erstmals als Philosoph vor.
In dieser Vorlesung geht es wesentlich darum, dass Erkenntnis schicksalsgebunden ist. Welche Wandlungen, so fragt Tillich, muss die Philosophie erlebt haben, damit sie den Weg von der schicksalslosen zur schicksalsgebundenen Wahrheit gehen konnte? Der entscheidende Wendepunkt ist für ihn die im Christentum gegebene Gewissheit, dass das Schicksal göttliches und nicht dämonisches Schicksal, dass es sinnerfüllend und nicht sinnzerstörend ist. Diese Gewissheit ist aber nicht wie noch für Hegel als Einsicht des Philosophen in einen sinnvollen Geschichtsablauf verfügbar, sie schwingt aber durch all unser Denken hindurch. Es gibt keinen Denkakt ohne die „heimliche Voraussetzung seiner unbedingten Sinnhaftigkeit“. Dieser unverfügbare transzendente Sinn steht, „wie es echt protestantischem Geist entspricht, jeder Verwirklichung unbedingt gegenüber“, er ist die „Rechtfertigung des Denkens“, das, was unser Denken begrenzt, aber auch ins Recht setzt (M I, 318).
So erklärt sich, dass Tillich auch noch 1931 in einem RGG-Artikel über den Religiösen Sozialismus die geschichtliche Situation als Kairos versteht: „Kairos ist immer, wo zeitliche Formen sich wandeln sollen und der ewige Sinn in zeitlicher Erfüllung neu durchbrechen will. … Der Religiöse Sozialismus meint, daß die Erschütterung der bürgerlichen Gesellschaft, ihrer geistigen und gesellschaftlichen Prinzipien einen solchen Kairos darstellt.“ (M III, 216) Der Religiöse Sozialismus enthalte den Protest gegen die profanisierte bürgerliche Gesellschaft, die sich der Transzendenz gegenüber verschließt. Er erwartet, dass die Erschütterung der bürgerlichen Gesellschaft den Weg zu einer neuen Theonomie frei macht.
Seit 1930 gibt Tillich mit Eduard Heimann und anderen die „Neuen Blätter für den Sozialismus“ heraus, eine Zeitschrift, die 1933 sofort verboten wurde. In seinem programmatischen Einführungsartikel „Sozialismus“ (vgl. M III, 189–204) warnt er den Sozialismus vor Orthodoxie und Verhärtung. Der Sozialismus ist eine Bewegung, so stellt er fest, nicht ein Zustand. „Der Sozialismus muß neu gewagt werden, wie er einmal gewagt worden ist. Das Wagnis hört nicht auf, so lange Leben sein soll. Denn Leben heißt vorstoßen ins Unbestimmte.“ (M III, 192) Den Begriff der „klassenlosen Gesellschaft“ ersetzt er durch die Wendung „sinnerfüllte Gesellschaft“ (M III, 198). Kein Einzelner und keine Gruppe sollen aus ihr ausgeschlossen sein. Neu ist, dass Tillich nun die Auffassung vom Menschen in den Mittelpunkt rückt. Alles entscheidet sich mit der Auffassung vom Menschen. Der ältere Sozialismus habe dies nicht gesehen.
Der Artikel ist allerdings nur ein Auftakt. Eine ausführliche Darstellung gibt Tillich in dem 1932 geschriebenen und nach seiner Publikation Anfang 1933 sofort verbotenen Buch „Die Sozialistische Entscheidung“ (vgl. M III, 273–419). Bei der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 wird auch dieses Buch ins Feuer geworfen.
Wenige Tage nach Erlass des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“, am 13. April 1933, wird Tillich als Professor beurlaubt. Max Horkheimer erinnert sich: „Ich habe ihm eines Tages im Februar 1933 eine Reihe von Stellen aus seinen Schriften vorgelesen und gesagt, ich glaubte, wenn er Deutschland nicht verließe, würden sie ihn das Leben kosten.“15
Im Sommer flüchtete Tillich auf die Inseln Rügen und Spiekeroog. Aus den USA erreichte ihn das Angebot einer zweijährigen Gastprofessur am Union Theological Seminary und an der Columbia University New York, übermittelt durch Reinhold Niebuhr, einen der führenden protestantischen Theologen der USA. Tillich zögerte noch. Die amerikanische akademische Welt war ihm fremd, seine Englischkenntnisse waren dürftig. Im Übrigen machte er sich noch Hoffnung auf die Rücknahme der „Beurlaubung“ und auf ein klärendes Gespräch im Kultusministerium in Berlin. Doch seine Ehefrau Hannah war zum Verlassen Deutschlands entschlossen. Das Gespräch im Kultusministerium erwies sich als klärend. Man wollte ihn in Deutschland halten und schlug ihm vor, Deutschland für zwei Jahre zu verlassen. Tillich stellte zwei Fragen: „Was geschieht mit den Juden?“ und „Wie stehen Sie zu unserer modernen Kultur?“ Die Antworten, die er erhielt, ließen ihn nun nicht mehr zögern.16
15 Werk und Wirken Paul Tillichs. Ein Gedenkbuch, Stuttgart 1967, 17.
16 Vgl. Hannah Tillich, From Time to Time, New York 1973, 155.