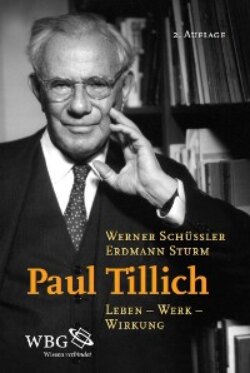Читать книгу Paul Tillich - Werner Schüßler - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ 1 Philosophieverständnis, Ontologie, Existenzphilosophie
ОглавлениеIn seiner Laudatio anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an Paul Tillich im Jahre 1962 sagte Bischof Otto Dibelius: „Was uns Theologen an dem Lebenswerk Tillichs zunächst erregt, ist der Eindruck, daß hier von einem der Unsrigen mit unbedingter Redlichkeit und Energie philosophisch gedacht wird.“26 Das hier angesprochene starke philosophische Interesse Tillichs wurde innerhalb der evangelischen Theologie schon früh wahrgenommen. So weisen die Gutachten zu seiner theologischen Habilitationsschrift recht kritisch auf ein Übergewicht der Philosophie hin. Demgegenüber sind aber die Stimmen von Seiten der Philosophie eher abwehrend. So beklagt sich beispielsweise Professor Hans Cornelius, dessen Nachfolger Tillich 1929 in Frankfurt auf dem Lehrstuhl für Philosophie und Soziologie durch den plötzlichen und unerwarteten Tod von Max Scheler wurde, über seine angeblich mangelnde philosophische Kompetenz, und das besonders in Bezug auf sein „System der Wissenschaften“ von 1923. Diese Schrift zeige „von der Wissenschaft, deren System er geben wolle, sehr unzureichende Kenntnisse, das Buch stehe wissenschaftlich auf sehr niedrigem Niveau, enthalte Banalitäten aller Art und kaum einen Satz, der nicht mit unklaren Begriffen arbeite“27. Demgegenüber lobt der Freund und Theologe Emanuel Hirsch gerade dieses Buch in allen Tönen. Ohne Zweifel ist Tillichs „System der Wissenschaften“ als Versuch eines Theologen zu werten, der Theologie im Reich der Wissenschaften einen Platz zuzuweisen und sicherlich keine „Wissenschaftstheorie“ im herkömmlichen Sinne. So ist es auch nicht verwunderlich, wenn dieses Werk, wiewohl Tillich selbst es für sein eigenes Denken immer als einen wichtigen Meilenstein verstanden wissen wollte, weder in der philosophischen noch in der theologischen Fachwelt besondere Beachtung fand.
Als Privatdozent der Theologie in Berlin hat sich Tillich in verschiedenen Vorlesungen in der Zeit vom Wintersemester 1920/21 bis zum Wintersemester 1923/24 die Philosophiegeschichte eigenständig „angeeignet“. So hat er im Wintersemester 1920/21 über „den religiösen Gehalt und die religionsgeschichtliche Bedeutung der griechischen Philosophie“ (vgl. E XIII, 1–198), im Sommersemester 1921 über denjenigen „der abendländischen Philosophie bis zur Renaissance“ (vgl. E XIII, 199–406) und im Wintersemester 1923/24 über die „Geistesgeschichte der altchristlichen und mittelalterlichen Philosophie“ (vgl. E XIII, 407–638) Vorlesungen gehalten – und das sogar jeweils vierstündig. Allerdings greift Tillich hier vor allem auf die von Karl Praechter, Matthias Baumgartner und Max Frischeisen-Köhler neu bearbeiteten Bände von Friedrich Ueberwegs „Grundriß der Geschichte der Philosophie“28 zurück, denen er den philosophiegeschichtlichen Stoff entnimmt; eigene originale philosophiegeschichtliche Forschungen scheint er nicht betrieben zu haben.
In einem Vortrag mit dem Titel „Der philosophische Hintergrund meiner Theologie“, den er 1960 in Tokio gehalten hat, sucht Tillich seine Beziehung zur Philosophie sich selbst durchsichtig zu machen und betont in diesem Zusammenhang gleich zu Anfang, dass es sich hierbei eigentlich um „eine Beziehung zu vielen Philosophen“ handele (G XIII, 478). Von daher wird auch verständlich, wieso sich die verschiedensten Richtungen auf Tillich berufen können und wieso Tillich auch von recht unterschiedlichen Ansätzen her interpretiert werden kann – von der klassischen Metaphysik her, von der Transzendentalphilosophie her, von der Existenzphilosophie her, von der Lebensphilosophie, ja selbst von der Prozessphilosophie her, um nur einige wichtige zu nennen. Es geht in diesem Paragraphen aber nicht darum, diesen philosophischen Hintergrund seiner Theologie zu durchleuchten, das wird in den verschiedenen anderen Paragraphen mit einfließen, sondern hier geht es darum, das Philosophieverständnis von Tillich aufzuhellen.