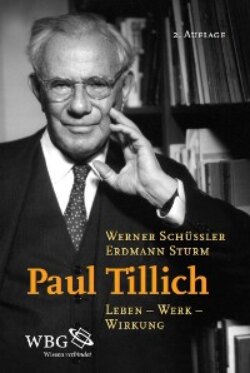Читать книгу Paul Tillich - Werner Schüßler - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Das Philosophieverständnis
ОглавлениеTillichs Nähe zur Philosophie war es denn wohl auch, die ihn geradezu dafür prädestinierte, für die zweite Auflage der „Religion in Geschichte und Gegenwart“ von 1930 den grundlegenden Beitrag „Philosophie. Begriff und Wesen“ (vgl. G IV, 15–22) zu verfassen. Dieser Beitrag beleuchtet allerdings mehr sein eigenes Verständnis der Philosophie, wie es sich auch in seinen anderen Arbeiten immer wieder dokumentiert, als dass er einen „objektiven“ Beitrag zum Thema leistet.
Das, was Philosophie ist, kann Tillich zufolge nicht in einer allgemeinen Definition eingefangen werden, denn es gibt nicht die Philosophie. Philosophie tritt immer nur im Plural auf. Zu verschiedenen Zeiten hat es verschiedene Philosophien gegeben, und das trifft auch auf die Gegenwart zu, was natürlich Konsequenzen für die Frage nach dem Fortschritt in der Philosophie hat; dieser ist anders gelagert als derjenige in Wissenschaft und Technik. Dass die Philosophiegeschichte als eine historische Disziplin im Sinne einer Erinnerung an mögliche Antworten auf menschliche Grundfragen eine Wissenschaft neben anderen Wissenschaften ist, ist fraglos. Aber Philosophiegeschichte ist noch nicht Philosophie selbst; diese ist noch einmal etwas anderes, das sich in Abgrenzung zu Wissenschaft und Religion über sich selbst klar werden muss. Darauf haben im 20. Jahrhundert besonders Martin Heidegger und Karl Jaspers hingewiesen. Dass aber auf der anderen Seite das philosophiehistorische Moment von der Philosophie nie ganz zu trennen ist, macht das eigentliche Problem der Philosophie aus.
„Eine Untersuchung über das Wesen der Philosophie ist … notwendig eine konkrete philosophische Untersuchung und ihr Ergebnis Ausdruck einer bestimmten philosophischen Überzeugung.“ (15) In diesem Satz Tillichs wird das angesprochene Problem der Philosophie deutlich. Denn Philosophie hat immer auch existentiellen Charakter; sie ist keine rein „objektive“ Sicht der Dinge, sondern sie hängt aufs Engste mit der Person dessen zusammen, der sie vertritt. Das heißt, Philosophie hat für Tillich eine wesentlich personale, oder besser: existentielle Ausprägung.
Das wurde nicht immer so gesehen. Aristoteles oder Descartes würden einem solchen Verständnis von Philosophie vehement widersprochen haben. Vertreter des Logischen Positivismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aber auch bestimmte Vertreter der sog. „Analytischen Philosophie“ sind auch heute noch in diesem Punkt anderer Ansicht, wenn sie eine sogenannte „wissenschaftliche“ Philosophie fordern. Tillich steht hier aber den Denkern der Existenz nahe, die eine solche für unmöglich hielten.
Tillich versteht die Philosophie als „die Frage in der radikalen Form“ (ebd.). Ihr Möglichkeitsgrund liegt im Wesen des Menschen selbst als desjenigen Wesens, das – im Gegensatz zum Tier – „Welt“ hat und sich selbst immer schon transzendiert. „Der Mensch ist dadurch charakterisiert, daß er nicht gebunden ist an das, was ihm begegnet, sondern in jeder Begegnung zugleich über sie hinaus sein kann.“ (16) In diesem Sinne ist nach Tillich jeder Mensch ein Philosophierender, wenn auch nur latent – homo naturaliter philosophus!
In der „existentiellen Philosophie“ – wie er sie nennt – sieht Tillich „eine neue schicksalhafte Wendung der Philosophie“, die mit dem griechischen oder mittelalterlichen Denken nicht zu vergleichen ist. „Denn mit der Einbeziehung des Erkennenden in die Erkenntnis – dieses soll ‘existentiell’ heißen – ist an die Stelle der bloßen Gestaltungsfrage die konkrete, historisch-soziologische Sinnfrage getreten. Ihre Beantwortung aber verlangt andere Kategorien und eine andere Haltung als die Philosophie der Weltgestaltung.“ (19)
Und doch fühlt sich Tillich immer auch dem klassischen Verständnis von Philosophie verpflichtet, wenn er diese wesentlich als „Metaphysik“ begreift. Er teilt hier nicht die Auffassung der sogenannten Transzendentalphilosophie verschiedenster Ausprägung, wonach die wesentliche Aufgabe der Philosophie darin besteht, „die Grenzen menschlicher Möglichkeit gegen metaphysische Überschreitungen zu schützen“ – im Sinne eines „antimetaphysischen Kritizismus“ (18).