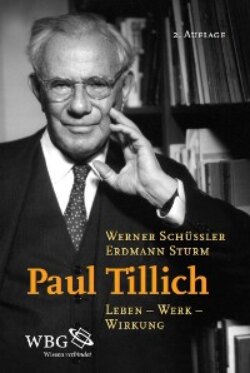Читать книгу Paul Tillich - Werner Schüßler - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Gott als die unhinterfragbare Voraussetzung der Religionsphilosophie
ОглавлениеTillichs Verständnis von Religionsphilosophie schließt sich an das neuzeitliche an, nach dem es hier nicht mehr so sehr um die Frage der natürlichen Theologie oder philosophischen Gotteslehre geht, sondern um die Frage nach dem Wesen der Religion und der religiösen Sprache. Die natürliche Theologie im Sinne der Gottesbeweisproblematik hält Tillich mit Kant für eine erledigte philosophische Frage (vgl. G XIII, 482). Dahinter steht aber letztlich sein protestantischer Standpunkt, nach dem die Vernunft immer auch schon in die Situation der Entfremdung mit einbezogen ist, eine natürliche Gotteserkenntnis darum ausgeschlossen erscheinen muss: „Die Vernunft ist nach theologischer Auffassung nicht nur endlich und deshalb unfähig, das Unendliche zu erfassen, sondern sie ist auch entfremdet von ihrer wesensmäßigen Vollkommenheit. Die Vernunft steht wie alles im Menschen unter der Knechtschaft der Entfremdung. Es gibt keinen Teil des Menschen, der vom universalen Schicksal der Sünde ausgenommen wäre. Für die kognitive Funktion des menschlichen geistigen Lebens bedeutet dies, dass die Vernunft erblindet und unfähig geworden ist, Gott zu erkennen. Die Augen der Vernunft müssen durch die offenbarende Gegenwart des Geistes Gottes im menschlichen Geist geöffnet werden. Nur wenn das geschieht, kann die Wahrheit von der menschlichen Vernunft erfaßt werden.“ (G V, 172)
In seinem Beitrag „The Two Types of Philosophy of Religion“ (vgl. G V, 122–137) von 1946 macht Tillich deutlich, wo er steht; und das ist nicht der Standpunkt der natürlichen Theologie, sondern derjenige einer Religionsphilosophie, die beim Gottesgedanken ihren Ausgangspunkt nimmt. Tillich unterscheidet hier – wie der Titel schon andeutet – zwei Wege der Religionsphilosophie: „Es gibt zwei Wege, auf denen man zu Gott gelangen kann: durch die Überwindung der Entfremdung und durch die Begegnung mit dem Fremden. Auf dem ersten Weg entdeckt der Mensch sich selbst, wenn er Gott entdeckt; er entdeckt etwas, das mit ihm selbst eins ist, obgleich es ihn unendlich transzendiert, etwas, von dem er entfremdet ist, aber von dem er nie getrennt war und nie getrennt werden kann. Auf dem zweiten Weg begegnet der Mensch einem Fremden, wenn er Gott begegnet. Die Begegnung ist zufällig. Wesenhaft gehören sie nicht zueinander. Der Mensch kann sich versuchsweise mit dem Fremden befreunden in der Erwartung, ihm näher zu kommen. Aber er kann keine Gewißheit über ihn erreichen.“ (122) Tillich versteht diese beiden Wege als Symbole für zwei mögliche Typen der Religionsphilosophie: den ontologischen und den kosmologischen Typ.
Den ontologischen Typ sieht Tillich exemplarisch bei Augustinus verwirklicht, der die Gleichsetzung von Gott und Wahrheit vorgenommen hat: „Veritas ist in jedem philosophischen Argument vorausgesetzt und veritas ist Gott“, schreibt Tillich. „Man kann nicht die Wahrheit als solche verneinen, weil man es nur im Namen der Wahrheit tun könnte und damit die Wahrheit bejahen würde. Und wenn man die Wahrheit bejaht, bejaht man Gott.“ (124) Auf die Frage, warum denn nicht alle Menschen diese Gewissheit Gottes haben, antwortet Tillich: „Wir sehen es [sc. das Sein-Selbst] immer, aber wir bemerken es nicht immer, wie wir alles im Licht sehen, ohne das Licht selbst zu sehen.“ (125) Tillich hat zweifellos Recht, wenn er meint, dass man die Wahrheit nur im Namen der Wahrheit verneinen kann. Denn alle Argumente für die Wahrheit stellen einen circulus vitiosus, einen Zirkelschluss, alle Argumente gegen die Wahrheit einen Selbstwiderspruch dar. Aber an Tillich ist doch die kritische Anfrage zu stellen, mit welchem Grund die Gleichsetzung dieser so verstandenen Wahrheit mit Gott vorgenommen werden kann. Ist denn eine einzelne Wahrheit Gott? Ist Gott aber die Wahrheit, woher weiß ich das? Diese Identifizierung ist doch wohl nicht von selbst gegeben. Augustinus hat jedenfalls zu zeigen versucht, dass die absolute Wahrheit mit Gott identisch ist. Dabei ging er von uns bekannten Wahrheiten vor allem aus dem Bereich der Mathematik aus und fragte nach einem Grund für diese vielen ewigen Wahrheiten.37 Anders ausgedrückt: Dass es eine erste Wahrheit gibt, ist für uns nicht unbedingt selbst-verständlich.
Den kosmologischen Typ der Religionsphilosophie sieht Tillich exemplarisch in Thomas von Aquin verwirklicht, der mit seinem rationalen Weg der mittelbaren Gotteserkenntnis „die unmittelbare religiöse Gewißheit“ untergraben habe: „Es ist der Weg eines Schließens, das nicht zu unbedingter Gewißheit führt.“ (127)
Tillich sieht sich selbst in dieser ontologischen Tradition der Religionsphilosophie stehend, und er formuliert das „ontologische Prinzip der Religionsphilosophie“ folgendermaßen: „Der Mensch ist unmittelbar eines Unbedingten gewahr, das aller Trennung und Wechselwirkung von Subjekt und Objekt vorausgeht, im Theoretischen wie im Praktischen.“ (131) Diese Überlegungen stehen ganz auf der Linie dessen, was er schon in seiner Habilitationsschrift dargelegt hat: dass das Identitätsprinzip den Widersprüchen der supranaturalistischen Begriffsbildung als Fundament des systematisch-theologischen Denkens vorzuziehen sei (vgl. E IX, 442). Noch in seinem Beitrag „Der philosophische Hintergrund meiner Theologie“ (vgl. G XIII, 477–488), der auf einen Vortrag in Tokio aus dem Jahre 1960 zurückgeht, bekräftigt er diese Ansicht, wenn er hier davon spricht, dass für ihn die Einheit von Unendlichem und Endlichem zum grundlegenden Prinzip seiner Lehre von der religiösen Erfahrung geworden sei (vgl. G XIII, 480). Das heißt, die Religionsphilosophie hat vom Unbedingten auszugehen, sonst kann sie Gott nicht erreichen. Dass das aber nichts mehr mit dem Begriff einer natürlichen Theologie zu tun hat, wird unmissverständlich deutlich in den letzten Worten seines Vortrages „Die Überwindung des Religionsbegriffs in der Religionsphilosophie“ von 1922, wo es heißt: „Jede Religion und jede Religionsphilosophie [verlieren] Gott, wenn sie sich nicht auf den Boden des Wortes stellen: Impossibile est, sine deo – discere deum. Gott wird nur erkannt aus Gott.“ (G I, 388) Tillichs Ausführungen zur Gottesfrage in seiner „Systematischen Theologie“ (vgl. S I, 193ff.) liegen ganz auf der Linie dieses Wortes. „Eine Religionsphilosophie“, so heißt es hier zusammenfassend, „die nicht mit etwas Unbedingtem beginnt, wird Gott nie erreichen.“ (S I, 242)
In den „Matchette Lectures“, die Tillich 1958 unter dem Titel „The Protestant Principle and the Encounter of World Religions“ an der Wesleyan University in Middletown gehalten hat, spricht er in diesem Zusammenhang von „einem anderen Typ von Religionsphilosophie“, und er führt dazu aus: „[This kind of philosophy of religion] doesn’t argue, it points to something. It brings us into contact with reality with which we can have contact, and it doesn’t do anything other than ask us to look at the phenomenon of the holy and I suggest that this should be the approach to the philosophy of religion.“38