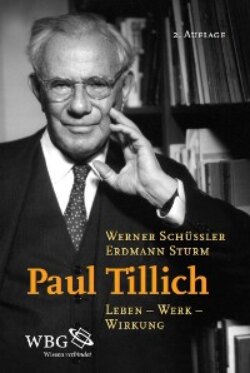Читать книгу Paul Tillich - Werner Schüßler - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. „Als Theologe in philosophischem Material“
Оглавление„Die Geschichte der Philosophie ist die Geschichte der reinen Form, die sich immer löst von der Bedeutungsform, immer sachlicher wird und schließlich wieder sich mit Gehalt erfüllt und eine neue Synthese mit dem Gehalt, ihrer Heimat, eingeht.“ (E XIII, 663) Mit diesem Satz aus der Vorlesung „Geistesgeschichte der altchristlichen und mittelalterlichen Philosophie“ aus dem Wintersemester 1923/24 deutet Tillich die Geschichte der Philosophie in einer Weise, die dem Selbstverständnis der Philosophie recht fremd erscheinen muss, er deutet sie nämlich „theo-logisch“. Und doch haben diese Sätze für das Verhältnis von Philosophie und Theologie bei Tillich paradigmatischen Charakter. Denn bei aller Beschäftigung mit der Philosophie ist er doch letztlich mehr Theologe als Philosoph. So versteht er sich auch in Frankfurt, wo er von 1929 bis 1933 einen Lehrstuhl für Philosophie und Soziologie innehat, als „Theologe in philosophischem Material“ (E VI, 276), wie er sich selbst in einem Brief an den Freund und Kollegen Eugen Rosenstock-Huessy aus dem Jahre 1935 einmal charakterisiert hat.
Aber eines wird hier auch deutlich, dass es wohl keinen zweiten protestantischen Theologen im 20. Jahrhundert gibt, der sich so intensiv mit der Philosophie auseinander gesetzt hat wie Tillich. Aber die Philosophie hat für ihn wesentlich eine propädeutische Funktion: Sie ist ihm also nie Selbstzweck, sondern er versteht sie als „ancilla theologiae“, sie steht im Dienste der Theologie – im richtig verstandenen Sinne.
Sein Versuch, klassische Ontologie und Existenzdenken zusammenzudenken, ein Versuch, der ihn mit dem christlichen Existenzphilosophen Peter Wust verbindet, kann aber nur bedingt gelingen, denn das existenzphilosophische Denken steht immer auch in einem entschiedenen Gegensatz zur klassischen Tradition, wie sich anhand des Werkes von Heidegger oder Jaspers leicht zeigen lässt. Dass auch Tillich diese Verbindung nicht recht gelungen ist, wird schon daran deutlich, dass ein Satz wie der: „Gott ist das Sein-Selbst“, recht unvermittelt neben den existentialistischen Analysen Tillichs steht. Aber gerade in dieser Verbindung von essentialistischen und existentialistischen Elementen sieht Tillich, wie er es einmal in einer Diskussion nach einem Vortrag ausgedrückt hat, „den Weg, auf dem eine zukünftige Philosophie weiter schreiten sollte“.35
26 O. Dibelius, Laudatio auf Paul Tillich, in: Friedenspreisträger Paul Tillich. Stimmen zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1962 mit der Laudatio von Bischof Dibelius und der Friedenspreisrede von Paul Tillich, Stuttgart 1963, 11–16, 13.
27 P. Kluke, Die Stiftungsuniversität Frankfurt am Main 1914–1932, Frankfurt/M. 1972, 539.
28 Vgl. Friedrich Ueberwegs Geschichte der Philosophie des Altertums, 11. Aufl., hg. von K. Praechter, Berlin 1920; Friedrich Ueberwegs Geschichte der Philosophie der patristischen und scholastischen Zeit, 10. Aufl., hg. von M. Baumgartner, Berlin 1915; Friedrich Ueberwegs Geschichte der Philosophie der Neuzeit bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts, 11. Aufl., hg. von M. Frischeisen-Köhler, Berlin 1914.
29 Vgl. z.B. Emil Brunners Kritik in E V, 342f.
30 P. Tillich, Vortrag „Heidegger and Jaspers“ (1954), Typoskript, 10 S., S. 2: Deutsches Paul-Tillich-Archiv an der Universitätsbibliothek Marburg.
31 Vgl. dazu W. Schüßler/E. Sturm (Hg.), Macht und Gewalt. Annäherungen im Horizont des Denkens von Paul Tillich (= Tillich-Studien. Abt. Beihefte, hg. von W. Schüßler u. E. Sturm, Bd. 5), Münster 2005.
32 Im ersten Band von Tillichs „Systematischer Theologie“ nehmen ontologische Analysen einen ganz zentralen Platz ein (vgl. S I, 199ff.).
33 Vgl. P. Tillich, Vortrag „Heidegger and Jaspers“ (1954), a.a.O. (Anm. 30) 6.
34 Vgl. ebd., 7f.
35 P. Tillich, Vortrag „Heidegger and Jaspers“ (1954), a.a.O. (Anm. 30), 10. – Übers. W. S.