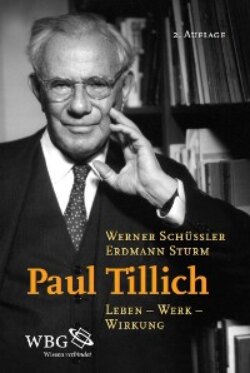Читать книгу Paul Tillich - Werner Schüßler - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
b) Sein als Seinsmächtigkeit
ОглавлениеDas Sein, um das es hier geht, ist keine leere Abstraktion, denn ein so verstandenes Sein könnte nicht den ontologischen Schock bewirken. Sein, das den ontologischen Schock bewirkt, muss nach Tillich verstanden werden als „Macht des Seins“, d.h. als jene Macht, die bewirkt, dass es etwas gibt und nicht vielmehr nichts. Und diese Macht des Seins ist es nach Tillich, die dem Nicht-Sein widersteht; sie findet sich in jedem Seienden.
Die Philosophie stellt die letzte Frage, die gestellt werden kann: Was bedeutet „Sein“? Sie stellt „die Frage nach dem Sein selbst“ (G V, 112). Das bedeutet aber, „daß die Philosophie primär nicht nach dem spezifischen Charakter des Seienden fragt, dem der Dinge und der Geschehnisse, der Gedanken und Werte, der Seelen und Körper, die am Sein teilhaben. Die Philosophie fragt danach, was das Sein selbst ist. Deshalb haben alle Philosophen eine ‘erste Philosophie’ entwickelt, wie es Aristoteles nennt, nämlich eine Deutung des Seins. Und von dieser gehen sie über zur Beschreibung der verschiedenen Arten des Seienden und zum System ihrer wechselseitigen Abhängigkeit, der Welt.“ (G V, 112f.)
Wenn Philosophie als Frage nach dem Sein selbst und den Kategorien und Strukturen, die allen Arten des Seienden gemeinsam sind, verstanden wird, dann ist es unmöglich, eine strikte Trennung zwischen Philosophie und Theologie vorzunehmen. „Denn wie auch immer das Verhältnis von Gott, Welt und Mensch sein mag, es liegt innerhalb des Rahmens des Seins, und jede Interpretation des Sinnes und der Struktur des Seins als Sein hat unvermeidlich Konsequenzen für die Deutung Gottes, des Menschen und der Welt in ihren wechselseitigen Beziehungen.“ (G V, 113)
Aber was ist das Sein? „Es ist es selbst“, hat Heidegger darauf einmal geantwortet. Damit will er – ähnlich wie Jaspers mit seinem Begriff des „Umgreifenden“ – sagen, dass sich das Sein einem direkten Zugriff versagt, umgreift es doch sowohl Subjekt als auch Objekt, ein Gegensatz, in dem der Mensch aber immer steht – denkend wie aussagend. Die klassische Metaphysik hat darum von der Transzendentalität des Seins gesprochen, und sie wollte damit etwas Ähnliches zum Ausdruck bringen, nämlich dass das Sein „überkategorialen“ Charakter besitzt, es also selbst die Kategorien transzendiert. Daraus folgt, dass man „Sein“ nicht definieren, sondern höchstens umschreiben kann. Solche Begriffe, mit denen man das Sein zu umschreiben versucht, hat man in der mittelalterlichen Philosophie „Transzendentalien“ oder transzendentale Begriffe genannt; die bekanntesten sind das unum, das verum und das bonum. Bekannt ist in diesem Zusammenhang auch das auf Aristoteles zurückgehende Axiom: „ens et unum convertuntur“ – Sein und Einheit sind konvertible, also austauschbare Begriffe. Alles, was Sein hat, ist ein Eines; und was sein Sein verliert, verliert immer auch seine Einheit. Diese mittelalterliche Transzendentalienlehre sieht in den Augen von heute häufig nur noch nach einem überholten scholastischen Philosophoumenon aus. Schon Kant wusste ja bekanntlich nichts mehr mit dieser Lehre anzufangen. Tillichs Gedanke, Sein als „Seinsmächtigkeit“ zu verstehen, kann man aber als eine interessante Neuinterpretation dieser klassischen Transzendentalienlehre lesen, die zu weitreichenden Konsequenzen bis hinein in die Theologie und Sozialphilosophie führt.31
An diesen Andeutungen wird schon deutlich, dass Tillich ontologisch ohne Zweifel Realist ist. Für den mittelalterlichen Realismus sind die Universalien, d.h. die Wesenheiten, Wirklichkeiten, wenn auch nicht in dem Sinne, wie die Dinge in Raum und Zeit wirklich sind. Demgegenüber vertritt der Nominalismus die Auffassung, „daß nur die einzelnen Dinge oder Menschen wirklich sind und daß die Universalien nichts als gemeinsame Namen für eine Gruppe von verschiedenen Dingen seien“. Wie Tillich seinen Realismus genauerhin versteht, erklärt er so: „Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht gegen den Nominalismus ankämpfe auf Grund meines verhältnismäßig realistischen Denkens, das Sein als Macht des Seins begreift. Dies ist eine Sünde gegen den Heiligen Geist des Nominalismus und deshalb auch gegen den Unheiligen Geist des logischen Positivismus und ähnlicher Geister. Wenn ich den extremen Realismus auch für falsch halte, nämlich den Realismus, den Aristoteles in Plato bekämpfte und der die Universalien als besondere Dinge in einer anderen, höheren Region betrachtete, so sehe ich andererseits doch, daß es Strukturen gibt, die sich trotz aller Bedrohungen immer wieder verwirklichen, das heißt, daß die Macht des Seins in ihnen dem Nichtsein widersteht, und das bedeutet ‘Realismus’ für mich.“ (E I, 159) Der Realismus betont die Macht des Seins, „die das Individuum transzendiert“ (E I, 169). Allerdings anerkennt Tillich auch das Positive des Nominalismus, dass er nämlich das Individuelle in Schutz nimmt, was ihm zufolge Europa davor bewahrt hat „asiatisch zu werden“ (E I, 160).
Mit der Betonung der Seinsfrage steht Tillich jedem Positivismus, Pragmatismus oder Skeptizismus ablehnend gegenüber. Solche philosophischen Positionen werden ihm zufolge dem Menschen nicht gerecht, denn die Frage nach dem Sein, selbst wenn sie nie definitiv zu beantworten ist, worauf ja schon Aristoteles hingewiesen hat, ist „die wirklich menschliche und philosophische Frage“ (G V, 114).32