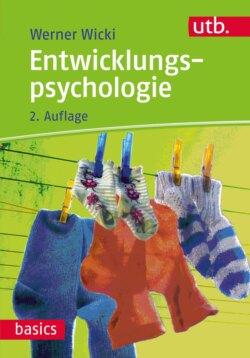Читать книгу Entwicklungspsychologie - Werner Wicki - Страница 24
3.1.3 | Lernen und Gedächtnis
ОглавлениеNeben den bisher beschriebenen Wahrnehmungs- und Kategorisierungsprozessen zählen die Gedächtnis- und Lernprozesse zu den wichtigsten kognitiven Prozessen. Fundamental ist insbesondere die Rolle des Gedächtnisses, denn ohne Speicherung von Information wären alle anderen (höheren) kognitiven Prozesse unmöglich.
Definition
Unter Gedächtnis sind nicht nur bewusstes und willentliches Speichern und Erinnern, sondern auch unbewusste, beiläufige Prozesse zu verstehen, die als implizites Gedächtnis und implizites oder inzidentelles Lernen bezeichnet werden.
1. Lebensjahr
Die experimentelle Säuglingsforschung konnte zeigen, dass sich das menschliche Gedächtnis bereits im Verlauf des 1. Lebensjahres kontinuierlich entwickelt:
Wiedererkennensleistungen (engl. recognition): Sie sind bereits ab der Geburt möglich, insbesondere bei Sinnesmodalitäten (wie dem Hörsinn), die schon vorgeburtlich funktional waren (z.B. DeCasper/Spence 1986). Viele der in den Kap. 3.1.1 und 3.1.2 referierten Studien zeugen von frühen Wiedererkennensleistungen, gemessen als erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber neuen Stimuli im Vergleich zu schon bekannten (die offenbar gespeichert wurden).
Erinnern von Kontingenzen: Nachdem 3 Monate alte Babys mit dem Fuß strampelnd ein Mobile bewegt und die Kontingenz zwischen dem Strampeln und den Bewegungen des Mobiles entdeckt haben, erinnern sie sich einige Tage später in einer ähnlichen Situation wieder daran und versuchen, den Effekt erneut strampelnd hervorzurufen (Rovee-Collier et al. 1980). In vielen weiteren Experimenten konnten Rovee-Collier und Kollegen zeigen, dass die Erinnerungsdauer (gemessen in Wochen nach dem Training) mit dem Alter der Säuglinge und mit der Anzahl der Trainingsdurchgänge linear zunahm. Der wiederholte Einsatz von Erinnerungshilfen (z.B. Zeigen des Mobiles) konnte das Vergessen um Monate hinauszögern (Hayne et al. 2000; Rovee-Collier 1997, 1999). Veränderungen des Kontexts (z.B. veränderte Ausstattung des Bettchens, in dem der Zusammenhang erinnert werden sollte) führten zu drastischen Abrufproblemen (Rovee-Collier 1997).
Lernen durch (aufgeschobene) Imitation von Handlungen: Bereits 6 Monate alte Kinder imitieren eine beobachtete Handlung (z.B. bei einer Spielzeugente einen Knopf drücken, damit diese quakt), sofern sie unmittelbar nach der Beobachtung getestet werden (Herbert et al. 2006). Aber erst ab 9 Monaten imitieren Kinder Handlungen, die sie beobachtet haben, (z.B. ein Spielzeug manipulieren oder einen Knopf drücken) noch 24 Stunden später, obwohl sie die jeweilige Handlung unmittelbar nach der Beobachtung nicht imitieren konnten (deferred imitation). Die älteren Kinder erinnern sich noch nach mehreren Wochen daran (Meltzoff 1985, 1988).
aktives Erinnern
Aktives Erinnern (engl.: recall) zeigt sich insbesondere auch im Zusammenhang mit der Sprachentwicklung: Eineinhalbjährige wiederholen intentional Wörter und kurze Sätze, die ihnen vorgesprochen werden (→ Kap. 3.2).
Bilden von Assoziationen
Die einfachste Form des Lernens besteht nach bisheriger Ansicht beim Säugling in der Bildung von Assoziationen zwischen physikalisch simultan vorhandenen Phänomenen (vgl. klassische Konditionierung). Eine neuere Studie zeigt auf, dass wahrscheinlich bereits 6 Monate alte Säuglinge Objekte assoziieren, die nicht unmittelbar gleichzeitig wahrnehmbar sind (Cuevas et al. 2006).
Definition
Das autobiografische Gedächtnis ist ein eigenes, sich dynamisch ab dem 3. Lebensjahr entwickelndes emergentes System. Es bezieht sich auf vergangene eigene Erlebnisse (Episoden), die explizit unter der speziellen Perspektive des Selbst in Beziehung zu anderen Personen erinnert werden (Nelson/Fivush 2004).
früheste autobiografische Erinnerungen
Das autobiografische Gedächtnis setzt erst gegen Ende des 2. Lebensjahres und vermehrt im 3. Lebensjahr ein (Nelson/Fivush 2004). Solche Erinnerungen konnten für besonders einschneidende Erlebnisse, z.B. eines medizinischen Notfalls, festgestellt werden (Peterson/Bell 1996; Peterson/Whalen 2001). Offensichtlich ist Sprache als Träger der Erinnerungen entscheidend: Kinder erinnerten nur Inhalte, die sie zum Zeitpunkt des Ereignisses bereits sprachlich benennen konnten, also mit ihrem Wortschatz ausdrücken konnten.