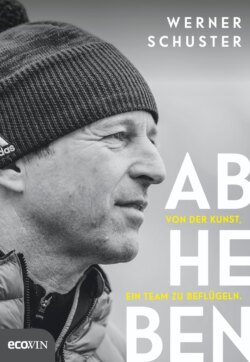Читать книгу Abheben - Werner Schuster - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEs war ein regnerischer Julitag, und die Gischt spritzte mir ins Gesicht auf der Ladefläche des Bundesheerfahrzeugs. Unglücklicherweise hatte ich den Platz direkt an der Ladeklappe gewählt, um mehr Frischluft zu erhaschen. Die Feuchtigkeit wurde durch die Sogwirkung ins Fahrzeug getrieben und durchnässte mich. Ich blickte nachdenklich nach hinten, sah ein Zivilfahrzeug und fühlte mich in eine andere Welt versetzt.
Bis vor Kurzem noch frei und unabhängig und mit großem Gestaltungsfreiraum meines Sportlerlebens, war ich jetzt uniformiert einer unter vielen und gleichzeitig durch hierarchische Strukturen total entmündigt. Der Umgangston beim Militär, die Einschüchterungen und das gezielte »Gefügigmachen« irritierten mich sehr. Es waren nur sieben Wochen, bis ich wieder in meine geschützte Werkstätte, den Spitzensport, zurückkehren durfte, aber diese Wochen haben nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Als Kadersportler hatte man die Möglichkeit, an ein Sportleistungszentrum zu wechseln. Eigentlich eine fantastische Einrichtung mit vielen Möglichkeiten und Freiheiten, aber mir war der Sprung aus Stams in diese andere Welt zu heftig. Hier war der Umgangston rau, und es ging nicht darum, die Dinge einfühlsam, wertschätzend und logisch zu bearbeiten, sondern nach Vorschrift korrekt. Ein solcher Zugang bereitet mir bis zum heutigen Tag Schwierigkeiten.
Diese Wintersaison verlief überhaupt nicht nach Wunsch. Ab Februar herrschte akuter Schneemangel, und die Möglichkeiten, Kaderergebnisse zu erzielen, waren eingeschränkt. Erstmalig in meiner Karriere verlor ich den Status, permanentes Mitglied des österreichischen Skiverbandes zu sein. Zum ersten Mal machte sich in meinem Leben so etwas wie Orientierungslosigkeit breit.
Als Sportler müsste man, pragmatisch gesehen, danach lechzen, einen Platz beim Bundesheer zur Ausübung des Spitzensportes zu ergattern. Sozial abgesichert, mit optimalen Trainingsbedingungen. Den rauen Umgangston musste man dafür einfach wegstecken. Ich hatte das nicht geschafft, und somit war die beste Alternative, ein Studium zu beginnen. Alles andere lässt sich mit der notwendigen Reisetätigkeit eines Spitzensportlers nicht vereinbaren. Eigentlich hatte ich nie studieren wollen. Das ewige Hineinpauken von mehr oder weniger sinnvollen Inhalten ohne das Gefühl, etwas Produktives geleistet zu haben, ermüdete mich, aber ich wollte meine Freiheit zurück.
Kleinlaut fragte ich meine Eltern, ob sie ein Studium wirtschaftlich unterstützen würden, da ich auch noch weiter Ski springen wollte. Selbstverständlichkeit schlug mir entgegen, und obwohl ich keinen konkreten Plan vorweisen konnte, umfing mich wieder dieses Urvertrauen, das ich so zu schätzen wusste.
Gemeinsam mit einem Kollegen vom Militärdienst startete ich das Sportstudium an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Durch meine gute und vielseitige Grundausbildung im athletischen Bereich kam es auch vor, dass mich Studentinnen fragten, ob ich ihnen beim Hochsprung helfen könne, das erforderliche Limit zu überspringen. Einmal endete eine Trainingssession mit einer netten Südtirolerin nach einem Nasenbeinbruch im Krankenhaus. Vielleicht fehlte mir als Spitzensportler doch ein wenig das Einfühlungsvermögen für Otto Normalverbraucher.
Sportlich schaffte ich 1991 wieder den Sprung in den B-Kader und trainierte zusammen mit den Nachwuchshoffnungen Werner Rathmayr, Andreas Goldberger und Martin Höllwarth. Skisprungtechnisch war es eine unglaublich interessante Zeit, weil eine neue Stilrichtung, der V-Stil, aufkam. Der Schwede Boklöv wurde zunächst massiv von den Wertungsrichtern benachteiligt, obwohl er schon den Gesamtweltcup gewonnen hatte. Die Stilrichtung fand Nachahmer mit Kiesewetter, Zünd etc., und die FIS musste das Bewertungssystem nachjustieren. Daraufhin ordnete der österreichische Nationaltrainer und Visionär Toni Innauer eine Stilumstellung für alle österreichischen Skispringer an. Er war felsenfest davon überzeugt, dass dieser Stil aerodynamisch Vorteile brächte und Toptalente sich einen Vorsprung erarbeiten könnten, wenn sie sich mit dieser Technik anfreunden würden.
Auch ich versuchte mich in der neuen Technik, aber mit bescheidenem Erfolg. Im Herbst entschied ich, zur alten Technik zurückzukehren, weil ich mir davon mehr Stabilität versprach. Dies sollte sich als fatale Fehlentscheidung entpuppen.
Die Saison 1991/92 brachte den Durchbruch für den V-Stil, wesentlich mitgeprägt von Österreich und dem Visionär Innauer, aber auch andere Nationen waren nicht untätig, und der 16-jährige Finne Toni Nieminen gewann so die Vierschanzentournee und Olympiagold in Albertville auf der Großschanze. Umso bemerkenswerter, dass das zweite Olympiagold auf der Normalschanze an den Routinier Ernst Vettori ging, der es als erster etablierter Springer geschafft hat, einen Titel in der alten und neuen Stilrichtung zu gewinnen. Weißflog folgte zwei Jahre später in Lillehammer.
Ich versuchte, nachdem ich bei der Olympiaqualifikation für Albertville gescheitert war, die Umstellung doch noch zu schaffen und begab mich mit meinem Vater nach der Skiflugveranstaltung in Oberstdorf auf selbige Anlage mit einem spektakulären Plan: Am Scheitelpunkt des Aufsprunghügels des Monsterbakkens baute ich eine zehn Zentimeter hohe Schneeschanze. Mit der entsprechenden Geschwindigkeit sollte es mir gelingen, vom Boden abzuheben, direkt in den steilen Teil des Aufsprungs einzutauchen und den Hang hinunterzugleiten. Zu dieser Zeit war das ein probates methodisches Mittel, die Flugphase zu simulieren. Man spürte unmittelbar nach dem Absprung den Staudruck unter den Skiern und konnte dadurch schnell versuchen, die erforderliche V-Gleitposition einzunehmen. Das alles war schon auf kleineren Schanzen, wo Sprünge auf 20 oder 30 Metern möglich waren, gemacht worden, aber niemals auf einer Flugschanze.
Ich war überzeugt von meinem Plan und nahm Anlauf direkt unter dem Schanzentisch dieser ehrfürchtigen Anlage, beschleunigte auf circa 70 bis 80 Stundenkilometer, hob auf dem kleinen, fast unsichtbaren selbst gebauten Schneehügel ab und glitt den immens steilen Aufsprunghang hinunter. Geschätzte 70 Meter Flug konnte ich genießen. Ich versuchte, meinen gewohnten Parallelstil ad acta zu legen und das neue Gefühl, die gespreizte Haltung der Skier, das sogenannte V, zu verinnerlichen. Der Sessellift brachte mich zügig wieder nach oben, und so konnte ich fünf, sechs Versuche in kürzester Zeit absolvieren. Am liebsten hätte ich jedes Mal gejuchzt in der Luft. Getragen von dem immer besser werdenden V-Stil und dem einzigartigen Gefühl mit einer besonderen Idee, weit abseits des Logischen und Vernünftigen, den Spirit eines ambitionierten Sportlers im Grenzbereich weiter auszubauen, genoss ich das Treiben. Vor meinem vermeintlich letzten Versuch stellte ich fest, dass meine Skispitze, verursacht von den harten Landungen auf eisigem Untergrund, einen Riss im Material aufwies. Euphorisiert von den vergangenen 90 Minuten dachte ich, dass die notwendige Stabilität für einen weiteren Flug ausreichend sei und stürzte mich ein letztes Mal ins Tal. Ich hob ab, und ein nie enden wollender Gleitflug in meinem neuen Stil endete mit einer Landung, bei der es mir plötzlich, wie von Geisterhand, ein Bein nach hinten zog. Ich überschlug mich auf dem eisigen Untergrund mehrmals und verlor beide Skier, die damals noch mit der 40 Jahre alten Kabelzugbindung an den Füßen befestigt waren. Dabei spürte ich einen stechenden Schmerz, der auch nicht wegging, als ich nach einer schier endlosen Rutschpartie endlich zum Stillstand kam. Beim Versuch aufzustehen knickte mein Knie weg, und ich fiel gleich wieder hin. Mein Vater eilte herbei, und auf seine Schultern gestützt versuchte ich, das Auto zu erreichen. Ich hatte meinen Ausflug teuer bezahlt. Was für ein Wechselbad. Der Tag hätte mein Neustart in die V-Stil-Ära sein sollen. Stattdessen kam ich wegen eines Materialdefektes beim Versuch, mich in Siebenmeilenschritten den etablierten Stars der Szene anzunähern, zu Sturz und zog mir die erste (und einzige) schwere Verletzung in meiner Skisprungkarriere zu.
Im Krankenhaus in Oberstdorf angekommen erhielt ich nach allen Untersuchungen und einer schlaflosen, schmerzgeplagten Nacht die Diagnose Kreuzbandriss, Innenbandriss, Meniskusschaden. Der Plan der Ärzte war niederschmetternd: in 10 bis 14 Tagen Operation, dann sechs Wochen Gips. Zum Glück hatte ich einen rührigen Vater, der seine Kontakte spielen ließ, und ich kam zu Dr. Schenk ins Montafon, wurde am gleichen Abend noch operiert, saß fünf Tage später schon wieder auf dem Ergometer und wurde in den Therapiealltag überführt. Diese Diskrepanz in Diagnose und Nachbehandlung ist mir bis heute schleierhaft und steht für mich immer noch als Synonym der Mehrklassengesellschaft im Gesundheitssystem.
Tatsächlich erholte ich mich, trotz nicht perfekter Rehabilitation, im angekündigten Zeitfenster und kehrte ins Wettkampfgeschehen zurück. Langsam begann ich allerdings zu spüren, dass man nicht mehr unweigerlich auf mich zählte. Das neue Trainerteam setzte auf die Jugend, da war man als 23-Jähriger schon am Abstellgleis.
Aufgrund eines Sturzes von Heinz Kuttin wurde ich dann aber ganz kurzfristig doch noch für das Springen zu Saisonbeginn in Oberwiesenthal nachnominiert. Das Problem war nur, dass der Mannschaftsbus schon unterwegs war und ich die siebenstündige Autofahrt selbstständig absolvieren musste. Dank meiner Eltern und der schlechten öffentlichen Erreichbarkeit des Kleinwalsertals war ich schon früh in den Genuss eines eigenen Autos gekommen, und so brach ich nun gegen Abend alleine mit meinem Ford Escort auf. Das Wetter war miserabel, und der Nebel wurde immer dichter. Kurz vor der tschechischen Grenze sah ich keine zehn Meter weit, und die Schneewände flößten mir Angst ein. Mit einem mulmigen Gefühl fuhr ich im Schneckentempo weiter, und als dann plötzlich ein Schlagbaum quer zur Straße hereinragte, war ich wirklich erleichtert, obwohl der Zöllner äußerst mürrisch war. Nach abenteuerlichen sieben Stunden kam ich weit nach Mitternacht im Mannschaftshotel an. Die verantwortlichen Trainer empfingen mich ähnlich dem tschechischen Zöllner – glücklich waren sie mit meiner Nachnominierung nicht.
Das Wettkampfwochenende war eines der bemerkenswertesten, das ich in meinem Leben durchlaufen habe. Ich kam vom ersten Sprung weg gut mit der Schanze zurecht, hatte wieder richtig Freude beim Skispringen. Meine Trainer setzten mich in die erste Startgruppe – dort starten immer die Schwächsten – obwohl meine Trainingsleistungen auf mehr hindeuteten. Auch das konnte nicht verhindern, dass ich in dem international ordentlich besetzen Feld zweimal Zweiter wurde, geschlagen nur von meinem Landsmann Franz Neuländtner. Dies hatte wiederum zur Folge, dass ich gemäß Absprache für das Weltcupspringen in Sapporo nominiert werden musste.
Die beiden Trainer beorderten mich nach dem Wettkampf in ihr Zimmer und teilten mir wenig begeistert diese Entscheidung mit. Vom Ausgebooteten zum Weltcupstarter. Innerlich zutiefst befriedigt und zugleich ernüchtert von der Gesamtsituation, trat ich die Heimreise wieder ganz alleine in meinem Auto an und schwor mir auf der langen Autofahrt, dass ich derartige Situationen einfühlsamer und respektvoller lösen würde, sollte ich einmal Trainer werden. Trotz Euphorie fühlte ich mich gedemütigt.
In den Folgejahren pendelte ich zwischen Kontinentalcup und Weltcup. Namen wie Weißflog, Goldberger, Sakala und Bredesen dominierten die Szene. Alles Sportler, die bedeutend kleiner und dadurch auch leichter waren als ich. Die letzten drei lieferten sich ein packendes Finish, und ich konnte bewundern, wie aggressiv sie mit überlangen Skiern das Luftpolster suchten und die sensible erste Flugphase überbrückten.
Instinktiv spürte ich, dass es mit meiner Statur nahezu unmöglich war, eine derartige Technik zu springen, die Gesetze der Physik waren nicht außer Kraft zu setzen. Zweifel kamen auf, und der schleichende Prozess begann, der Karriere als aktiver Skispringer Adieu zu sagen und sich vermehrt auf die Ausbildung zu konzentrieren. Ich war tief im Herzen gar nicht traurig. Die Bühne gehörte nun Funaki, Goldberger und anderen, und ich akzeptierte das. Auf keinen Fall wollte ich jungen Talenten einen Startplatz wegzunehmen. Ich hatte meine Zeit gehabt mit tollen Momenten und wundervollen Reisen, die man normalerweise in diesem Alter nicht machen kann. Ich hatte interessante Teamkollegen, die teilweise zu Freunden geworden sind, und tolle Trainer, die mir bei der Entwicklung meiner Persönlichkeit geholfen haben.
Bei einem der inzwischen raren Besuche im Kleinwalsertal informierte ich meine Eltern von meinem Plan. Meine Mutter, aber auch mein Vater, der unzählige Stunden und Tage mit mir an der Schanze verbracht hatte, reagierten gelassen und verständnisvoll. Da war es wieder, dieses Urvertrauen. Ich durfte immer meinen Weg gehen, wurde liebevoll unterstützt und gefördert, aber niemals gedrängt. Mit einer Selbstverständlichkeit ließ man mich gewähren und gestalten. Manchmal frage ich mich, ob mehr Druck etwas gebracht hätte. Vielleicht hätte ich das eine oder andere Heimtraining konsequenter absolviert. Vielleicht hätte ich mich mit einer gesünderen Ernährung, die für einen Skispringer essenziell ist, meinem Gewichtsoptimum eher genähert. Trotzdem: Eigene Erfahrungen machen zu dürfen und Eigenverantwortung zu übernehmen schärft die Persönlichkeit. Fehler machen zu dürfen und dafür geradezustehen beziehungsweise im Zweifelsfall aufgefangen zu werden macht mutig und frei. Für das alles bin ich sehr dankbar.