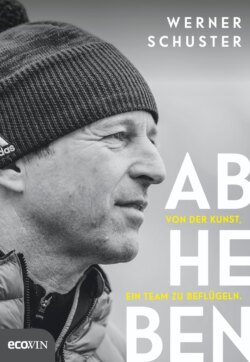Читать книгу Abheben - Werner Schuster - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Warum ich Trainer werden
und Menschen entwickeln wollte
ОглавлениеJugendsportmultiplikator – Arturo Hotz, der Mann, der uns das Denken lehren will – Rückkehr nach Stams – Erste Erfolge und Mentor Liss – Gereift angreifen mit der nächsten Generation – Papa sein hilft – Schlieri, das Jahrhunderttalent – Verbessern oder gut sein lassen – Endlich Weltmeister – Die Sache im Blick – Anruf aus der Schweiz – Die meinen das ja ernst – »Eine Medaille machen ist doch kein Problem« – Zäsur in Deutschland – Als junger Österreicher privilegiert zwischen den Stühlen – Die innere Zerrissenheit und der hartnäckige Hüttel – Das Brechen von Grundsätzen – Mit Naivität ins Abenteuer
Eigentlich hatte ich nie einen klaren Plan gehabt, was ich außer dem Skispringen beruflich machten wollte. Lehrer zu werden war zwar auch nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste gewesen, aber es erschien mir als eine vernünftige Basisausbildung, mit der man sich eventuell auch in der freien Marktwirtschaft behaupten konnte. So war ich beim Studium Psychologie/ Philosophie/Pädagogik gelandet, und das hatte ja immerhin auch einen Bezug zum Sport. Kaum war die Skispringerkarriere beendet und das erste Vorlesungsbündel in Psychologie zusammengestellt, klingelte in meiner Studenten-WG das Telefon. Am anderen Ende der Leitung war Toni Innauer, zu diesem Zeitpunkt Sportdirektor des österreichischen Skiverbandes. Die österreichische Bundesregierung wolle den Sport intensiver unterstützen und rief dafür eine erstklassige Zusatzausbildung ins Leben. Das Projekt hätte den klingenden Namen Jugendsportmultiplikatoren/Nachwuchstrainerakademie. Mit dem Begriff konnte ich nichts anfangen, aber ich zeigte mich interessiert. Innauer erklärte mir, dass es hier um eine Zusatzausbildung, gepaart mit Praxiserfahrung in Form einer Projektbetreuung gehe. Der Haken an der Sache war: Ich musste zu einem Hearing nach Obertraun und mich »qualifizieren«.
Eine völlig neue Welt für mich als Vollblutsportler, der bis vor Kurzem noch alle möglichen Schanzen dieser Welt bezwungen hatte. Typen in Anzug und Krawatte und ein förmlicher, eher steifer Umgang miteinander. Ich wanderte von Tisch zu Tisch beziehungsweise von Raum zu Raum und musste diverse Fragen beantworten. Ein Professor fragte mich, was denn so mein Ziel sei als Trainer. Ziel als Trainer? Darüber hatte ich mir noch nie den Kopf zerbrochen. Ich war mir ja nicht einmal im Klaren, ob ich überhaupt Trainer werden wollte. Was möchte der Mann wohl von mir hören? Was muss ich antworten, um das Hearing zu bestehen?
»Nationaltrainer«, antwortete ich stolz.
»Nur Nationaltrainer?«, sagte der Professor und hielt mir einen Vortrag über die Besonderheit dieser Ausbildung und welche Möglichkeiten uns da geboten würden. Das verlange natürlich auch außergewöhnliches Engagement.
Geknickt ging ich nach Hause und erzählte Toni Innauer, das sei wohl nicht das Richtige für mich und ich wäre im Hearing vermutlich durchgefallen, nichtsahnend, dass ich hier in der Sportpolitik angekommen und meine Aufnahme in das Projekt eine abgekartete Sache war. Denn der österreichische Skiverband, als einer der mächtigsten Verbände in Österreich, hatte das Recht, Leute in dem Projekt zu platzieren, und entschied letztlich über die Auswahl.
Also absolvierte ich, obwohl ich maximal Nationaltrainer werden wollte, neben meinem Studium eine Zusatzausbildung in Sachen Nachwuchstraining, die mich zum bestausgebildetsten Skisprungtrainer Österreichs machen sollte.
Einer der Professoren, die uns ständig begleiteten auf unseren Seminaren, war Arturo Hotz. Ein kleinwüchsiger Schweizer Querdenker, der europaweit Vorträge hielt und als Koryphäe in Sachen Bewegungslernen und Koordination galt. Seine Impulsreferate waren interessant und unterhaltsam, aber auch anstrengend, glitt er doch immer wieder ins Philosophische ab. Es rumorte unter uns Praktikern, klang doch vieles auf den ersten Blick abgehoben und beinahe ein wenig weltfremd. Einmal hatte ich die Möglichkeit, mit ihm unter vier Augen an der Bar entspannt zu plaudern, und ich nützte die Gelegenheit, ihm die Stimmung in der Gruppe wiederzugeben. Wenn mich etwas störte, konfrontierte ich mein Gegenüber und nahm kein Blatt vor den Mund. Er reagierte erstaunlich gelassen und sagte fast ein wenig mitleidig zu mir: »Weißt du, Werner, mein Ziel ist es nicht, euch Wissensinhalte zu vermitteln und Rezepte zu liefern. Mein Ziel ist es, euch das Denken zu lehren!«
Wir sollten also lernen zu denken? Dieser Satz sollte mich eine Weile beschäftigen. Vieles, was ich in diesen drei Jahren speziell von Arturo lernte, begriff ich erst später, als das Seminar schon beendet war. Viele seiner Ansätze, die im ersten Moment abstrus wirkten, kamen mir zu einem verspäteten Zeitpunkt wieder ins Gedächtnis, und erst dann begriff ich die Zusammenhänge. Einer seiner Leitsätze war, dass wir uns im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit befinden. Das Bild mit den Spannungsfeldern verwende ich heute noch oft. Schade, dass Arturo so früh verstorben ist. Ich hätte gerne 20 Jahre später mit ihm bei einem Glas Wein einen Rückblick auf diese spannende Zeit und auf das Gelernte, das mich nachhaltig prägen sollte, gemacht.
Teil meiner Ausbildung war es, eine kleine Trainingsgruppe im Raum Seefeld zu betreuen, wo ich mich um skispezifische Ergänzungseinheiten in der Skihauptschule Neustift kümmerte. Dies ermöglichte mir einerseits, moderne Aspekte des Trainingsprozesses zu erproben, und mir gleichzeitig meine ersten Sporen im spezifischen Arbeiten mit jungen Skispringern zu erarbeiten. Meine Skisprungtruppe war ein bunter Haufen, von mir einmal liebevoll »das gallische Dorf« genannt. Das Leistungsgefälle war enorm und für einen ehemaligen Sportler, der bis vor Kurzem noch im Weltcup mit den Besten der Besten agiert hatte, eine harte Probe, sich auf diese grundlegenden Probleme der motorischen Ansteuerung einzulassen. Schlussendlich waren es die weniger talentierten Schüler, die bei mir den größten Lernprozess entfachten. Ich war gezwungen, mich hineinzufühlen in Schwierigkeiten, deren Lösungen mir selbstverständlich erschienen. Ich war gezwungen, methodische Schritte zu entwickeln für Bewegungsfolgen, die begabte Sportler instinktiv zu lösen imstande sind. Ich war wieder angekommen an der Basis meines Sportes und lernte das Skispringen von der Pike auf neu.
1998 standen die Abschlussprüfungen der Diplomtrainerausbildung an, und ich näherte mich dem Ende meines Studiums, als sich ein weiterer nahtloser Übergang in meinem Leben abzeichnete. Im Schigymnasium Stams wurde eine Trainerstelle frei, und ich war erste Wahl. Ich war modern ausgebildet, voll motiviert und »überfällig«, mein Wissen anzubringen, dennoch war es nicht selbstverständlich, in diesen erlesenen Kreis aufgenommen zu werden. Das Studium sollte auch nebenbei beendet werden können.
In Stams gab es zu diesem Zeitpunkt ungefähr 35 Springer und 5 Trainer. Man arbeitete in Kleingruppen, und das System war von großem Vertrauen und Wertschätzung geprägt. Der Trainer bekam eine Altersgruppe zugeteilt, mit der er vier oder fünf Jahre arbeiten durfte und dadurch die Möglichkeit bekam, einen systematischen Aufbau durchzuziehen. Viele talentierte junge Burschen, unter anderem Andreas Kofler, und ein außergewöhnlich begabtes Mädchen namens Daniela Iraschko meldeten sich in diesem Jahr zur Aufnahmeprüfung an.
Im September 1998 war es dann endlich so weit. Auftaktsitzung, Organisatorisches, Sonstiges und dann ging es zum Sportplatz. Ich fragte noch den sportlichen Leiter Paul Ganzenhuber, ob ich ihm täglich oder wöchentlich berichten müsse über meine Vorhaben, worauf er erwiderte: »Werner, du bist vom heutigen Tag an für die konditionelle und technische Entwicklung dieser Gruppe verantwortlich. Ich stehe dir bei Fragen gerne zur Verfügung und werde dir auch mal über die Schulter schauen, aber du hast mein volles Vertrauen.« Mit offenem Mund nahm ich die Aussage zur Kenntnis und machte mich ans Werk. Einerseits freute ich mich über die Vorschusslorbeeren, andererseits beängstigte mich die Situation. Ich war für das Schicksal der hoch motivierten Talente, die alle mit großen Plänen nach Stams gekommen waren, verantwortlich. Jeder und jede wollte ihre sportlichen Träume verwirklichen, die nicht gerade klein waren, und ich sollte der Türöffner sein.
Die ersten Tage waren akribisch durchgeplant, und der Enthusiasmus war groß. Alle waren mit Begeisterung dabei, und es herrschte eine positive Dynamik. Ich gewann schnell das Vertrauen und damit auch Selbstvertrauen. Es dürfte der vierte oder fünfte Trainingstag gewesen sein, als ich mich nach einer weiteren gelungenen Trainingseinheit in mein Auto setzte und die halbstündige Heimreise nach Innsbruck antrat. Gedankenversunken und zutiefst zufrieden rekapitulierte ich die Tage und dachte mir: »Das ist ja genau das, was du schon immer machen wolltest.« Ich war angekommen in meinem Traumjob, ohne bewusst jemals darauf hingearbeitet zu haben.
Ich schrieb keine Stunden auf. Ich rechnete keine Zusatzleistungen ab. Ich kannte keine Sperrstunde. Ich telefonierte auch nachts, wenn es notwendig war. Ich hatte nur das Projekt und meine Verantwortung im Auge, und danach richtete sich mein Einsatz. Meine Arbeit war es, elf jungen Menschen dabei zu helfen, ihren sportlichen Traum zu verwirklichen, und diese Verantwortung nahm ich wahr. Das Schöne war, es kam mir nicht wie Arbeit vor. Trainer am Schigymnasium war nicht mein Beruf, sondern meine Berufung.
Praktischerweise konnte ich mich bei den ersten Trainingslagern mit meinem Kollegen Alois Lipburger, dem Liss, meinem Lieblingstrainer aus vergangenen Tagen, zusammentun. Liss war nach Jahren der Absenz und der beruflichen Umorientierung wieder ins Trainergeschäft eingestiegen und übernahm die erste Klasse der nordischen Kombinierer. Ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, dass es mir als Rookie vergönnt war, die Skispringer zu trainieren, und mein Mentor in der Sparte Nordische Kombination gelandet war, aber fachlich gesehen wäre es umgekehrt nicht gegangen.
Ich nutzte jede Gelegenheit, mich mit ihm auszutauschen und mir Tipps zu holen. In meinen Ausbildungsjahren hatte ich jede Menge Tools in meinem Rucksack angehäuft, aber mir fehlte noch das Gespür, wann ich was am besten einsetzen sollte. Die Wirkungsweisen und Lernkurven der Sportler hatte ich noch nicht im Gefühl und war, wie die meisten Anfänger meiner Zunft, übermotiviert und ungeduldig. Nichtsdestotrotz stellten sich auch schnelle Erfolge ein, und eines Tages saß ich mit Liss auf der Terrasse des Bundessportheims in Faak am See und erzählte ihm begeistert von meinen Erlebnissen und Gedanken. Christian Nagiller, später Weltcupsieger, hatte sich in wenigen Wochen zur Nummer eins in meiner Trainingsgruppe aufgeschwungen, und ich bildete mir ein, ihm mit ein paar Kniffen dorthin verholfen zu haben. Liss war die Entwicklung von Nagiller nicht verborgen geblieben, und er schlüpfte wieder in die alte Trainerrolle, indem er mir väterlich mitteilte: »Werner, du kannst was!«
Gute Freunde: Alois Lipburger, genannt Liss (links) und Toni Innauer (rechts)
Das war für mich wie ein Ritterschlag, motivierte mich ungemein für die kommenden Aufgaben und brachte mir ein weiteres Stück mehr Selbstsicherheit.
Der Winter stand vor der Tür, die Wettkampfsaison begann. Auch wenn man sich für alle nur das Beste wünscht: Performance auf den Punkt zu bringen ist wieder eine eigene Qualität, und leider kann nicht jeder gewinnen. In der Realität ist man prozentuell eher von Enttäuschten umgeben als von glücklichen Siegern. Die Selektion ist gnadenlos. Hier war ich als Psychologe gefragt und schrieb mir auf die Fahnen, keinen zurückzulassen. Nach einem Wettkampf brauchen einen vor allem die Verlierer, für die Sieger ist die Welt ohnehin in Ordnung.
Diese Situation forderte mich. Ich musste anerkennen, dass es auch mit dem größtmöglichen Einsatz nicht realisierbar war, aus allen Sieger zu machen. Die Sportler Woche für Woche zu trösten und den Eltern die Situation hoffnungsvoll und respektvoll, aber auch mit der notwendigen Portion Realismus darzulegen, verlangte mir als Jungtrainer alles ab.
Ich war noch nicht einmal ein halbes Jahr im Amt, schon musste ich mein Motiv überdenken. Meine Aufgabe war es, den Talentiertesten und Motiviertesten die Möglichkeit zu eröffnen, eines Tages Weltklasseleistungen zu erbringen. Der Prozentsatz der »Gescheiterten« liegt allerdings bei weit über 90. Wenn es also gelingt, pro Jahrgang österreichweit tatsächlich einen Sportler an die Spitze zu führen, dann kann man sich schon glücklich schätzen.
Auch wenn ich sogar mehrere Jahre im Weltcup gesprungen war, als Sportler war ich im engen Sinne auch ein Gescheiterter, aber ich fühlte mich nicht so. Mein Leben hatte Inhalt, und ich genoss es zu reisen und auf meinem Level Erfolgserlebnisse zu feiern. Viele Freundschaften bauten sich über die Jahre auf, auch internationale, und gerne erinnere ich mich an das eine oder andere Erlebnis aus dem Sportlerleben zurück. Kollegen, die eine Stufe früher scheiterten, erlebten Vergleichbares. Der Sport lehrt dich Demut und Disziplin. Man lernt den Umgang mit Druck und Wettkampf, Frust und Scham. Elemente, die einem im späteren Leben auf irgendeine Art und Weise wieder begegnen. Natürlich gibt es auch Frustrierte, die nur mehr ungern über die Sport- und Ausbildungszeit sprechen. Meist hat das aber einen direkten Zusammenhang mit dem Umgang der Vertrauensperson Trainer und dem notwendigen Verständnis und Respekt, der in diesen Fällen gefehlt hat.
Hier galt es anzusetzen. Ich nahm mir vor, so zu arbeiten, dass meine Sportler zu mir sagen: »Trainer, es war eine coole Zeit in Stams!«, wenn ich sie nach vielen Jahren wieder treffen würde. Respektvoller, einfühlsamer und vertrauensvoller Umgang einerseits, aber auch die notwendige Disziplin und Konsequenz, um den Begabtesten ein Weiterkommen zu ermöglichen. Mit anderen Worten: jeden an sein persönliches Limit führen!
Das erste Jahr verging wie im Flug, drei meiner Jungs stiegen in den C-Kader auf, und ich wurde vom österreichischen Skiverband mit der Gesamtleitung dieser Nachwuchsmannschaft beauftragt. Die Leistungsdichte war enorm, und wir dominierten die Nachwuchsserie, den Alpencup, nach Belieben. In den Vereinen wurde gute Grundlagenarbeit geleistet, wir hatten eine sensationelle Dynamik im Trainerteam, die sich auf die Sportler übertrug, und führten sie Schritt für Schritt an die Weltklasse heran. Auch meine erste Junioren-Weltmeisterschaft wurde ein Triumph. Mit dem erfahrenen Trainerkollegen Harald Haim an meiner Seite gewannen wir Teamgold, und wäre das Einzelspringen nicht wegen Wetterkapriolen abgesagt worden, hätte es noch mehr Medaillen für Team Rot-Weiß-Rot gegeben.
Der Trainerjob beseelte mich und war meine Berufung. Ich wollte etwas bewegen und etwas vermitteln. Genau so, wie ich es erfahren durfte. Mein Anspruch war, meine Sportler besser zu machen und ihnen eine erfüllte und gewinnbringende Zeit zu ermöglichen. Ihnen Orientierung zu geben und Werkzeuge fürs Leben zu vermitteln. Jeden bestmöglich zu begleiten und die Erfahrung machen zu lassen, mit einem guten Konzept und hoher Willenskraft Berge versetzen zu können. Grenzerfahrungen zu machen und trotzdem Sicherheitsstandards einzuhalten.
2001 hatte ich zwar endlich neben dem Job mein Studium beendet, aber das Jahr 2001 brachte nicht nur Sonnenschein. Liss war inzwischen zum Cheftrainer der österreichischen Skispringer aufgestiegen und verunglückte auf der Heimfahrt vom Weltcupspringen in Willingen tödlich. Die Beisetzung in Stams in der Basilika war ein herzzerreißender Moment. Tausende Leute waren gekommen, um sich von einem weit über die Sportgrenzen beliebten und geschätzten Menschen zu verabschieden. Er hatte also nicht nur bei mir tiefe Spuren hinterlassen. Mein Trainerdasein ist stark von ihm geprägt, und darauf bin ich stolz.
Die Geburt meines ersten Sohnes Jonas im Sommer 2003 veränderte mein Leben enorm. War ich bisher in meiner Sportblase gefangen und lebte in engen Leitplanken meine Emotionen aus, brachte die Geburt und dabei speziell die gemeinsame Zeit mit meiner Frau Annika im Krankenhaus eine bisher unbekannte Intensität an Gefühlen hervor. Das Wunder Leben relativierte so manches bisher Erlebte. Die neue Verantwortung und Gewichtung in meinem Leben sollte sich auch positiv auf mein Trainerdasein auswirken. Situationen im Traineralltag, die mir extrem bedeutsam erschienen und mich zur Weißglut gebracht hatten, verlangten mir immer öfter ein Lächeln ab. Ich bekam ein besseres Gefühl durch mehr innere Gelassenheit, wann es sich lohnte, sich über etwas aufzuregen. Mein Fanatismus und meine Begeisterung für das Skispringen blieben mir erhalten, aber ich betrachtete die Menschen, mit denen ich arbeite, aus einem leicht veränderten Blickwinkel.
Im Jahr 2005 stießen zwei äußerst begabte Athleten des Jahrgangs 1990 zu meiner Trainingsgruppe in Stams: Mario Innauer und Gregor Schlierenzauer. Beide kannten sich seit ihrer Anfangszeit im Verein Innsbruck Bergisel, waren freundschaftlich miteinander verbunden und pushten sich gegenseitig zu Höchstleistungen. Sie dominierten ihre Altersklasse nach Belieben und hatten mein C-Kader-Team schon punktuell verstärkt, obwohl altersgemäß im Alpencup noch gar nicht startberechtigt. Während Mario Innauer mit einer soliden Grundtechnik, hohem athletischen Potenzial und einer enormen Willensstärke auffiel, punktete Gregor Schlierenzauer mit einer sehr feinen technischen Klinge und einem enormen Fluggefühl. Aus sportlichem Elternhaus, mit einem Vater, der gerne selber die österreichische Alpinszene als Athlet bereichert hätte, die Mutter eine warmherzige Frau, die die sportlichen Ambitionen des Kindes mit Feingefühl und gutem Instinkt unterstützte. Der Onkel ein ehemaliger Spitzensportler und Ratgeber im Hintergrund. Aufgewachsen im damals erfolgreichsten Verein Österreichs, dem SV Innsbruck Bergisel mit einem außergewöhnlich guten Schülertrainer Markus Maurberger. Zudem bekam er die eine oder andere Zusatztrainingseinheit von Toni Innauer, der früh erkannte, dass die Symbiose von Gregor und seinem Sohn Mario eine klassische Win-win-Situation sein konnte.
In den ersten Entwicklungsjahren gab es keinerlei Leerlauf in der Karriere von Gregor Schlierenzauer. Er lernte sofort die richtige Technik und wurde altersgemäß gefordert und gefördert. Körperlich und entwicklungsmäßig ein wenig hinter Mario Innauer, musste er das technisch kompensieren, um in der Pubertät Schritt halten zu können.
Diese beiden Sportler verstärkten nun meine Trainingsgruppe, und wir entfachten eine Dynamik, die ihresgleichen suchte. Ich fühlte mich sehr geehrt, die Verantwortung für diese beiden zusätzlich übernehmen zu dürfen. Gleichzeitig war es eine heikle Mission, den Sohn des Sportdirektors und den gut behüteten und von Onkel und Vater kompetent und kritisch begleiteten Gregor Schlierenzauer zu trainieren.
Zu beiden hatte ich sehr schnell einen guten Draht, und der Alltag lief problemlos. Mit Arthur Pauli, dem Juniorenvizeweltmeister von 2005, Thomas Thurnbichler und Andreas Strolz hatte ich weitere Hochkaräter in meiner kleinen Truppe, die jedes andere Team der Welt verstärkt hätten. Diese Dynamik galt es zu moderieren, um keine unnötigen Reibungsverluste zu erzeugen.
Die Sommervorbereitung machte richtig Spaß, und wir kamen gut voran. Bei Gregor musste ich manchmal innehalten, weil er technisch so ausgereift war und ich vor der Frage stand: Sollte man dem technischen Idealbild nacheifern oder Individualität zulassen?
Ich war kein Traineranfänger mehr, und meine Theorien hatte ich mehrfach erprobt und erfolgreich angewendet. Ein junger Sportler mit einem derart hohen Grundniveau war mir bis zum damaligen Zeitpunkt noch nicht untergekommen, und ich wollte Gregor schließlich nicht schlechter machen. Oft bin ich wach im Bett gelegen und habe gegrübelt, ob ich weiter offensiv meinen Überzeugungen folgen oder eher defensiv das Vorhandene pflegen sollte. Ich spürte die Verantwortung und trug sie in einem unsichtbaren Rucksack mit mir herum.
Schlussendlich entschied ich mich, weiterhin mutig und offensiv seine schon ausgezeichnete Technik weiter zu verfeinern und schreckte auch vor kleinen Veränderungen nicht zurück. Mit einer klaren Vision im Kopf versuchte ich, ihn mit geschickten und ausgeklügelten Maßnahmen, speziell das Material betreffend, durch die Pubertät zu führen. Er war ein kluger und interessierter Athlet und hinterfragte jeglichen Schritt. Mit Transparenz und Klarheit zog ich ihn auf meine Seite und trieb die Entwicklung voran.
Zu Beginn der Wintersaison 2005/06 hatte Mario Innauer die Nase vorn, und wir standen nur noch drei Wochen vor der Junioren-Weltmeisterschaft in Kranj/Slowenien. Gregor, obwohl schon qualifiziert, haderte mit dem Rückstand und wurde ungeduldig. Er schob das Problem aufs Material und forderte Hilfe von mir. Er war ein schlanker Athlet und musste vergleichsweise kurze Skier springen, was sich als fehlende Tragfläche und Unterstützungsfläche im zweiten Flugdrittel bemerkbar machte. Ich hatte das Problem erkannt und schon die erforderlichen Schritte eingeleitet, forderte aber eine technische Verbesserung als Grundvoraussetzung ein. Nachdem er dies mehrmals trotzig ablehnte, kam es im Fernsehraum beim Videostudium zu einer härteren Auseinandersetzung, schlussendlich verließ er den Raum mit Tränen in den Augen.
Wir machten gerade in Schonach Station, und sein Kumpel Mario Innauer dominierte den Alpencup nach Belieben. Ich dachte, ich hätte das Vertrauen von Gregor nach der Diskussion des Vortags verloren. Umso erstaunter war ich über sein strahlendes Lächeln beim Frühstück – er sendete Signale, das Besprochene und am Vortag noch abgelehnte technische Detail entschlossen umsetzen zu wollen. Sein erster Sprung war grandios, und er fand sich nur knapp hinter seinem Konkurrenten Innauer wieder, und obwohl sein zweiter Sprung nicht dieselbe Qualität hatte, war ich unheimlich stolz auf ihn. Wieder hatte er feuchte Augen, aber das Erlebte hat unser Vertrauensverhältnis noch einmal gestärkt, und die Junioren-WM konnte kommen.
Mario Innauer war sich seiner sehr sicher und nahm immer seltener Hilfe von außen an, während Gregor mir vollends vertraute und die Kooperation Trainer–Athlet vorbildlich lebte. Gregor sprang wie von einem anderen Stern, hielt der Drucksituation stand, ließ sich in diesen emotional intensiven Momenten auch helfen und wurde Weltmeister. Mario belegte Platz sieben. Nachdem wir dann auch noch den Teamtitel gewonnen hatten, war ein neuer Star geboren. Gregor war Doppelweltmeister der Junioren mit 16 Jahren.
Im darauffolgenden Sommer war die Trainingsgestaltung sehr schwierig, weil Gregor, gestärkt durch die Erfolge, immer besser und die Lücke zum restlichen Team immer größer wurde. Praktischerweise trainierte er immer noch bei mir, weil der Schulalltag sich schwer mit dem Rhythmus der Profis vereinbaren ließ. Immer öfter tauchte Nationaltrainer Alexander Pointner bei uns im Training auf, um sich ein Bild von Gregor zu machen. Er wollte ihn für den Sommer-Grand-Prix in Hinterzarten nominieren. Ich machte klar, dass ich dem nur zustimmen würde, wenn ich das Gefühl hätte, dass er unter die besten 15 kommen könnte. Schließlich war er erst 16 Jahre alt. Dass ein Nachwuchstrainer aufbegehrt, war neu im System und stieß Pointner sauer auf. Er pochte auf die Hierarchie, aber harrte der Dinge.
Bei einem Trainingskurs im Juli war Franz Neuländtner, langjähriger Rennservice-Betreuer der Skifirma Fischer, vor Ort und beobachtete Gregor. Die Kluft zwischen ihm und dem restlichen C-Kader war wieder einmal groß, aber ich war trotzdem nicht vollends zufrieden. Ich erzählte Franz, dass man von oberster Stelle Gregor gerne zum Sommer-Grand-Prix mitnehmen würde und ich ihn nur unter den erwähnten Voraussetzungen freigeben wolle. Da schaute mich Franz verdutzt an und sagte: »Werner, wenn der so springt, dann kommt er locker aufs Podium in Hinterzarten.« Ungläubig nahm ich das zur Kenntnis und gab den Athleten frei. Franz sollte recht behalten. Gregor wurde mit 16 Jahren bei seinem ersten Auftritt bei den »Großen« Dritter und düpierte den Großteil der Weltklasse.
Obwohl er kurz darauf in Courchevel sogar gewann, trainierte er im Herbst, dem Schulrhythmus geschuldet, wieder bei mir, und ich bekam das Vertrauen der Skiverbandsführung, Gregor auf den Winter vorzubereiten.
Wieder entstand eine harte Diskussion mit Nationaltrainer Pointner, der Gregor unbedingt zum Weltcupauftakt in Kuusamo nominieren wollte. Ich argumentierte mit Unerfahrenheit und trainingstheoretischen Überlegungen. Zudem brachte ich die unsichere Wettersituation in Finnland ein und dachte, ich hätte mich durchgesetzt. Diesmal spielte Pointner aber die Hierarchiekarte aus und forderte vehement ein Einlenken von meiner Seite. Ich blieb trotzdem stur, denn mir war der Athlet ans Herz gewachsen, und ich hatte zu viel investiert, um seine Karriere unter fragwürdigen Bedingungen leichtfertig aufs Spiel zu setzen, und schlug als »Schiedsrichter« Sportdirektor Innauer vor. Dieser folgte glücklicherweise meiner Argumentation und ich gewann Zeit, Gregor in Lillehammer bestmöglich auf den Weltcupstart vorzubereiten. Nachdem auch eine letzte Feinabstimmung mit dem Skimaterial erfolgreich verlief, reiste ich entspannt nach Hause und freute mich schon auf das Weltcupspringen in Lillehammer, das ich mir zu Hause auf dem Sofa ansehen würde. Mein Job war erledigt.
Gregor Schlierenzauer, mit 16 Jahren auf dem Gipfel
Gregor Schlierenzauer belegte in Lillehammer die Plätze eins und drei und gewann bis zum Beginn der Vierschanzentournee fünf Weltcupspringen. Ich durfte einen talentierten jugendlichen Skispringer zwei Jahre formen und weiterentwickeln und mit 16 Jahren direkt in der Weltspitze abgeben. Das passiert nicht allzu oft in einer Trainerkarriere. Zudem konnte ich für mich verbuchen, immer den Athleten und die optimale sportliche und persönliche Entwicklung im Auge behalten und nicht die Eigen-PR in den Vordergrund gerückt zu haben.
Die Medien stürzten sich auf den Jungstar, und es war interessant und zugleich befremdend zu sehen, wer sich alles zu Wort meldete und den Anspruch erhob, den entscheidenden Anteil zu Gregors Erfolg beigetragen zu haben. Im doch sehr familiären Skisprungzirkus sprach sich international jedoch schnell herum, wo die Wurzeln dieser Entwicklung lagen. Schließlich platzierten sich in Bischofshofen beim Tourneeabschlussspringen, das Gregor gewann, mit Arthur Pauli und Mario Innauer zwei weitere Jungs aus unserer Trainingsgruppe in den Top 15.
Mitte Januar 2007 klingelte mein Telefon, und das Display wies eine Schweizer Telefonnummer aus. Am anderen Ende der Leitung war Gary Furrer, der Sportchef der Schweizer Skispringer. Er erzählte mir, dass der aktuelle Nationaltrainer Berni Schödler am Ende des Jahres sein Amt ruhend stellen werde und sie an mir als Nachfolger interessiert wären. Ich fühlte mich geschmeichelt, lehnte aber dankend ab. Ich hatte eine junge Familie und fühlte mich als Nachwuchstrainer in Stams privilegiert und pudelwohl. Furrer meinte, er würde sich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal melden.
Im März fuhren wir mit den restlichen Nachwuchssportlern meines Teams zur Junioren-WM-Vorbereitung nach Norwegen, als plötzlich wieder mein Handy mit der inzwischen bekannten Schweizer Nummer läutete. Gary Furrer wiederholte sein Anliegen, mich als neuen Cheftrainer zu gewinnen, und schlug ein Treffen mit mir vor. Ich war verdutzt ob der neuerlichen Offerte und musste erst einmal durchatmen. Schließlich war Doppelolympiasieger Simon Ammann nach einer längeren Durststrecke gerade frischgebackener Weltmeister in Sapporo geworden, und zudem gab es in diesem Team mit Andreas Küttel einen weiteren absoluten Weltklassespringer. »Die meinen es wirklich ernst«, schoss es mir durch den Kopf.
Zum ersten Mal hielt ich inne und überlegte ernsthaft, ob ich diese Möglichkeit leichtfertig ein zweites Mal ausschlagen konnte. Ich war 37 Jahre alt, hatte durch die Entwicklung von Gregor und dem Rest der Mannschaft das Selbstvertrauen, dass meine Theorien in der Praxis greifen, und fühlte mich voller Energie. Das Gefühl, den Wechsel in die Schweiz vollziehen zu müssen, wurde immer stärker. Zudem gab es die Möglichkeit, sich in Stams karenzieren zu lassen. Meine Lust war groß und das Risiko überschaubar. Jetzt galt es, die Sache kommunikativ anzupacken. Die erste Station war natürlich meine Familie. Meine Frau hatte Bedenken, schließlich hatten wir im Frühjahr 2006 unseren zweiten Sohn Jannik bekommen, und sie wollte natürlich keine alleinerziehende Mutter sein, auch Jonas war noch keine vier Jahre alt. Doch schon als Nachwuchstrainer war ich ja viele Wochenenden unterwegs gewesen, und so konnte ich sie zum Glück überzeugen, vor allem auch mit dem Argument, dass es ohnehin nur drei Jahre sein würden.
Im Nachhinein betrachtet habe ich meiner Familie viel zugemutet, vielleicht sogar zu viel. Aus drei Jahren wurden schließlich zwölf, und wenn man bedenkt, dass beide Großeltern, die fantastisch mitgearbeitet haben, nicht einmal in einem Umkreis von zwei Stunden wohnen, dann kann man sich vorstellen, wie oft meine Frau alleine war und die Gesamtsituation mit zwei kleinen Kindern geschultert hat.
In der Schweiz wurde ich sehr nett aufgenommen und hatte schnell das Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Die mediale Einführung meiner Person mit über 20 Journalisten übertraf meine Erwartungen, und daran konnte man auch ablesen, welchen Stellenwert sich Küttel und Ammann unter der Leitung meines Vorgängers Berni Schödler in den Vorsaisonen erarbeitet hatten.
Mit Andreas Küttel war ich schon auf der einen oder anderen Schanze dieser Welt ins Gespräch gekommen, aber Simon Ammann war für mich bisher nicht greifbar gewesen. Medial hatte ich seine Erfolge und sein Auftreten verfolgt, seine Medaillengewinne bewundert, aber in letzter Konsequenz keine weiteren Informationen über ihn. Umso neugieriger war ich auf unser erstes Treffen. Unkompliziert und offen trat er mir entgegen und erzählte viel Persönliches. Bei der Frage nach seinen Zielen und Träumen traute ich meinen Ohren kaum: »Ich würde so gerne mal eine ganze Saison konstant durchspringen, um eine Chance auf den Gesamtweltcup zu haben, aber das fällt mir unheimlich schwer. Weißt du, bei einem Großereignis die Leistung auf den Punkt zu bringen ist für mich nicht so schwer, aber von November bis März die Leistung abrufen bereitet mir Mühe.«
Ich kippte fast aus den Schuhen. Träumte doch die ganze Welt davon, einmal eine Medaille bei einem Großereignis zu machen, saß hier ein Doppelolympiasieger und Weltmeister vor mir, der dies als weniger schwierige Übung beschrieb, den aber andere Limits bei der Leistungsentfaltung beschäftigten.
Ich fühlte mich auf dem Prüfstand als Trainer, erwartete er sich doch eine Perspektive, um dieses Problem zu lösen. Schließlich wollte er sich mit dem neuen Trainer weiterentwickeln. Ich atmete einmal tief durch und erläuterte ihm in ruhigem und sachlichem Ton einen technischen Lösungsansatz. Aus der Ferne habe ich das Gefühl, dass seine Sprungtechnik mental und physisch sehr anspruchsvoll sei und kein Mensch der Welt in der Lage wäre, über vier Monate den erforderlichen Frischelevel aufrechtzuerhalten, sodass Einbrüche vorprogrammiert seien. Die Antwort stellte ihn zufrieden, und die Arbeit konnte beginnen.
Das Jahr in der Schweiz war in Summe für mich ein Lernjahr im Weltcup. Meine Vision war es, ein Team rund um die beiden Topstars aufzubauen. Ich musste jedoch sehr bald erkennen, dass man zwar in Österreich in puncto Nachwuchsrekrutierung aus dem Vollen schöpfen konnte, es hier aber ungleich schwieriger war, den Anschluss an die Elite herzustellen. Weiters war ich damit konfrontiert, dass im Weltcup ein rauer Umgangston herrschte und das Materialthema ein viel dominanteres ist als in der Jugendausbildung, wo doch der Mensch im Mittelpunkt der Entwicklung steht. Leistungsmäßig konnte ich Ammann und Küttel im etablierten Kreis der Top Ten halten, aber die erhoffte Weiterentwicklung der beiden blieb aus. Die Anschlussleistungen, insbesondere von Guido Landert, hatten sich verbessert, aber das interessierte die Medien wenig, und ich sehnte das Saisonende herbei.
Nahezu zeitgleich spürte man eine enorme Unruhe im deutschen Team. Nach erfolgsverwöhnten Jahren unter Trainer Reinhard Hess und den Vorzeigeadlern Martin Schmitt und Sven Hannawald klaffte zwischen Anspruch und Wirklichkeit schon seit geraumer Zeit eine Lücke, die im Laufe der Jahre größer statt kleiner wurde. Bei der Skiflug-Heim-WM in Oberstdorf war man von den Medaillen sehr weit weg, was die Verantwortlichen für eine Zäsur nutzten. Alle im Skisprungzirkus, insbesondere die breit gefächerte mediale Seite, warteten gespannt, was der Deutsche Skiverband für Maßnahmen ergreifen würde, um in Zukunft wieder zu den Sieganwärtern zu gehören. Schließlich war der deutsche Markt enorm wichtig, und von einer funktionierenden deutschen Skisprungmannschaft würden wiederum alle profitieren. Startrainer wie Toni Innauer, Mika Kojonkoski oder Tommi Nikunen standen auf der Spekulationsliste ganz oben.
Da aber just in diesem Jahr wegen des kurzfristig gescheiterten Fernsehvertrags mit dem Privatsender RTL Millionen in der Kassa fehlten, beauftragte man Horst Hüttel mit der sportlichen Leitung der Skisprungmannschaft. Hüttel hatte sich in der Nordischen Kombination einen Namen gemacht und überzeugte die Verantwortlichen mit einem hohen Sachverstand und außergewöhnlichem Engagement.
Hüttel würde ich als einen langjährigen, grenzüberschreitenden Freund und Kollegen bezeichnen. Wir waren in den 80er-Jahren als Schüler schon gegeneinander gesprungen, hatten uns später als Trainer wiedergetroffen und uns gut verstanden.
Irgendwann im März 2008 klingelte das Telefon, und am anderen Ende der Leitung war Horst Hüttel. Er schilderte mir die Situation in Deutschland, erläuterte mir seine Idee, mich als neuen Bundestrainer gewinnen zu wollen und bat mich um ein Treffen. Gestresst und ausgelaugt vom Saisonverlauf versuchte ich, ihn abzuwimmeln, argumentierte mit meiner Unerfahrenheit und einer mündlichen Zusage den Schweizern gegenüber, bis Olympia in Vancouver 2010 zur Verfügung zu stehen. Er reagierte verständnisvoll, pochte aber auf ein persönliches Treffen und meinte, er käme sofort zu mir nach Mieming. Es war 21.30 Uhr.
Am nächsten Tag stand er vor meiner Tür, mit mehreren Aktenordnern bewaffnet. Begeistert offerierte er mir seine Pläne und die Möglichkeiten, die Skisprungdeutschland seiner Meinung nach bieten würde. Ich wäre das Puzzleteil, das ihm dazu fehlte. Er schmierte mir Honig um den Mund, dass er meine Trainerqualitäten schon sehr lange beobachte, von meinen Erfolgen beeindruckt sei und mir vollen Rückhalt geben würde. Kurz: Er überrollte mich wie eine Dampfwalze.
Die Situation raubte mir den Schlaf. Ein junger, bisher nur in Insiderkreisen bekannter österreichischer Trainer hatte die Wahl, Cheftrainer in der Schweiz oder in Deutschland zu sein. Nach außen versuchte ich, mir nichts anmerken zu lassen, und spulte mein Programm wie gewohnt ab. Im Skisprungzirkus lag eine gewisse Spannung in der Luft, wurde doch heftig spekuliert, wer denn dieses Amt in Zukunft bekleiden könnte. Wurde ich in eine Diskussion zu dem Thema hineingezogen, hielt ich mich bedeckt. Alles kam mir ein wenig unwirklich vor.
Hüttel ließ nicht nach und arrangierte ein Treffen mit dem deutschen Generalsekretär und übergeordneten Sportdirektor Thomas Pfüller. Wir trafen uns an der Autobahnraststätte Pettnau bei Telfs zum thematischen Austausch. Pfüller, dem ich offensichtlich kein Begriff war, testete mich und wollte von mir ein Konzept und Ansatzpunkte hören. Dabei schilderte ich ihm unverblümt meine Eindrücke und die Arbeitsweise, die ich an den Tag legen würde, um den deutschen Skisprung nachhaltig voranzubringen. Ich nahm kein Blatt vor den Mund und scheute mich auch nicht, kritische Themen anzusprechen. Ich hatte aus der Ferne beobachtet, dass unter den deutschen Trainerkollegen mehr gegeneinander als miteinander gearbeitet wurde. Die Tatsache, dass ich den Job nicht unbedingt brauchte, machte mich frei, und meine Ansätze schienen Eindruck hinterlassen zu haben.
Meine Gedankenwelt war durcheinander, hatte sich doch in meinem bisherigen Leben alles so schön gefügt: Schule, Stams, Studium, Karriereende mit Übergang in das Multiplikatorenprojekt, Trainer in Stams, ÖSV, Schlierenzauer, Schweiz. Nun schien erstmals das Timing schlecht zu sein. Würde ich mir selber treu bleiben, dann müsste ich noch die nächsten zwei Jahre in der Schweiz bleiben und dann auf den nächsten Schritt hoffen. Doch mir war klar, dass dann in Deutschland ein anderer am Steuer sitzen und ich möglicherweise nicht mehr gebraucht werden würde. Ich war innerlich zerrissen.
Das Weltcupfinale in Planica stand an. Noch war nichts entschieden, aber die Anzeichen in meinem Kopf verdichteten sich. Die sportlich geprügelte deutsche Mannschaft mit den Athleten Schmitt, Uhrmann, Neumayer und Späth reagierte auf die harsche Kritik der Medien an den Routiniers mit einem eigens bedruckten T-Shirt, das auf die prekäre Nachwuchssituation hinwies. Spekulationen über die Zukunft des einstigen Big Players im Skisprungzirkus prägten den Small Talk. Ich hielt mich zurück und versuchte, sportlich meinen Auftrag zu erfüllen und dem begnadeten Flieger Simon Ammann mithilfe eines Materialkniffs für den Sonntag noch einmal neues Leben einzuhauchen. Nachdem das zumindest einen Durchgang lang geklappt hatte, kam es im Umziehcontainer noch zu einem emotionalen Gespräch. Ammann, der in meine Situation eingeweiht war, sagte zu mir: »Werner, bleib doch bei uns.« Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: »Eigentlich ist es mir auch egal, wenn du gehst. Ich bin dir dankbar für deine Impulse. Ich weiß, was ich zu tun habe und werde den Weg mit dir oder auch ohne dich fortsetzen.« Das saß und beeindruckte mich nachhaltig. Ammann wurde zwei Jahre später Doppelolympiasieger, Skiflugweltmeister und Gesamtweltcupsieger. Trotz mir oder wegen mir, das werden wir wohl nie erfahren.
Training mit Simon Ammann im Dezember 2007 in Engelberg
Nach Gesprächen mit meiner Familie und meinen engsten Freunden sagte ich in Deutschland zu. Wieder mit dem Gefühl, ein überschaubares Risiko einzugehen, da ich im Falle eines Scheiterns nach Stams zurückkehren konnte. Weiters wuchs die Überzeugung, dass es, berücksichtigte man die Treue, mit der der Deutsche Skiverband seine Trainer behandelte, eine einmalige Chance war, die sich zudem finanziell auszahlte. Ich sagte Horst Hüttel zu.
Die Arbeit in der Schweiz musste noch sauber abgeschlossen werden, und ich fuhr eines Morgens Ende März um sechs Uhr früh zu Hause los, um rechtzeitig bei der Saisonanalyse in Einsiedeln in der Schweiz zu sein. Die Autofahrt kam mir ewig lang vor, schließlich fuhr ich die Arlbergstrecke zum gefühlt hundertsten Mal. Dabei wälzte ich alle verfügbaren Argumente zum wiederholten Male hin und her, immer in der Hoffnung auf ein Aha-Erlebnis und vollste Überzeugung und Zufriedenheit. Stattdessen kamen wieder größere Zweifel auf, und ich wollte plötzlich doch noch alles rückgängig machen. Hektisch verließ ich auf halber Strecke kurz nach dem Grenzübergang in Feldkirch die Autobahn, steuerte einen Parkplatz an und zückte mein Handy. Um kurz vor halb acht klingelte ich Horst Hüttel aus dem Bett und teilte ihm mit, dass ich in der Schweiz bleiben werde.
»Spinnst du«, entgegnete er mit forscher Stimme und bot seine ganze Überzeugungskraft auf, um mich zu beruhigen. Ich machte einen Rückzieher vom Rückzieher, brachte die Analysesitzung in der Schweiz professionell über die Bühne und kehrte gedämpft, aber auch irgendwie erleichtert am Abend in den Schoß der Familie zurück.
Die Entscheidung war gefallen, und das Abenteuer konnte beginnen.