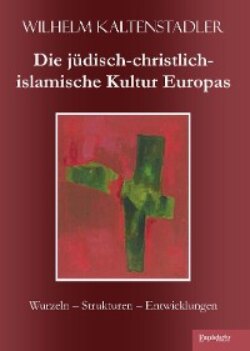Читать книгу Die jüdisch-christlich-islamische Kultur Europas - Wilhelm Kaltenstadler - Страница 11
Christlich-jüdische Symbiose?
ОглавлениеBei der Beurteilung der Juden durch die christliche Umwelt muss man sich, um zu einem objektiven Urteil zu gelangen, vor Augen halten, dass die uns überlieferten antijüdischen Gesetze, Regelungen, Erlasse weltlicher und kirchlicher Obrigkeiten nicht immer mit der tatsächlichen Behandlung jüdischer Menschen übereinstimmen. Vorindustrielle Epochen sind auch dadurch charakterisiert, dass gesetzliche Regelungen und Erlasse oft nur auf dem Papier standen und nicht befolgt wurden. ‘Potemkinsche Dörfer’ gab es also nicht nur in Russland. Wenn wir die auf uns gekommenen Quellen zur jüdisch-christlichen Geschichte, welche wie gesagt nicht immer objektiv und zuverlässig sind, auswerten, dann stellt man mit Erstaunen fest, dass es durchaus Epochen in der europäischen Geschichte gab, in denen Juden von den Christen weitgehend toleriert wurden und in denen es sogar Ansätze einer christlich-jüdischen Symbiose gab. Diese Phasen der Toleranz äußerten sich auch darin, dass sowohl Juden und Jüdinnen wie die heilige Teresa von Avila zum Christentum als auch Christen – vor allem auf dem Balkan und in Iberien – zum Judentum oder Islam konvertierten.
Bei der Analyse der christlichen Toleranz im Mittelalter ist auch zu beachten, dass die tolerantia des Mittelalters nicht immer und überall dem heutigen Begriff „Toleranz“ entspricht, sondern bei vielen mittelalterlichen Autoren, wie z.B. bei Wilhelm von Tyrus (+ 1186) und dem Spanier Rodrigo Ximénes de Rada (+ 1247), auch durch humanitas, humanus, moderatio, moderatus, discretus, clementia (clemencia), patientia (pacientia), patiens (paciens) und pacificus wiedergegeben werden kann.89 Von einer echten Toleranz im Sinne einer Gleichwertigkeit und –behandlung der Juden und Moslems kann allerdings bis weit in die Neuzeit hinein keine Rede sein. Die Toleranz der vorindustriellen Gesellschaft läuft also weitestgehend auf eine Duldung der „Anderen“ hinaus. Man musste die Juden und teilweise auch die iberischen Moslems schon deswegen dulden, weil vor allem die adelige und kirchliche Führungsschicht auf sie nicht zuletzt wirtschaftlich angewiesen war. Wirklich tolerant gegen die Juden waren selbst protestantische Fürsten nicht. Nur relativ wenige von ihnen waren wie z.B. der Große Kürfürst bereit, aus rein pragmatischen Erwägungen Juden und Kalvinisten ins Land zu lassen bzw. sogar zu rufen.90 Die Einsicht in die volkswirtschaftlichen Vorteile, die sich aus den wirtschaftlichen Aktivitäten der Juden ergaben, überwogen in solchen Fällen in der Regel die Bedenken gegen sie. Wenn sich die Juden wie in den Niederlanden, in Polen, seit dem Großen Kurfürsten auch in der Mark Brandenburg eher als in anderen Ländern halten konnten, dann war das also nicht unbedingt Ausdruck menschlicher Toleranz oder gar christlicher Nächstenliebe.
Als Historiker muss man sich sehr davor hüten, geschichtliche Verhältnisse nur aus der Sicht der Normen- und Rechtssphäre zu betrachten. Sowohl aus jüdischer wie auch aus christlicher Sicht zeigt der Verlauf der mittelalterlichen und neuzeitlichen Geschichte, dass verschiedene Herrscher und Regenten sich nicht bzw. nicht immer an die Beschlüsse der Päpste, Bischöfe und anderer Potentaten hielten und Juden sogar als Hoffaktoren, Minister, Berater und Sprachlehrer, nicht zuletzt auf der iberischen Halbinsel im Mittelalter, einsetzten. Auch kleinere Herrschaften wollten bzw. konnten auf solche jüdische Experten nicht verzichten. Selbst Königin Christine von Schweden (1626-1689) behielt nach ihrer Abdankung und Konversion zum Katholizismus (1655) ihren jüdischen Hoffaktor bei. Sie feierte mit „ihrem Juden“ sogar im Jahre 1667 in Hamburg die Krönung von Clemens IX. zum römischen Papst.91 Diese wenig bekannte Episode legt nahe, dass es zumindest seit dem 17. Jahrhundert eine friedliche Koexistenz von Vatikan und europäischem Judentum gegeben hat. Vor allem die europäischen Eliten wussten nicht nur das wirtschaftliche Know-how, sondern auch das intellektuelle Niveau der Juden sowie deren Vertrautheit mit dem Alten und Neuen Testament zu schätzen.
Bei der Behandlung der Juden durch die europäischen Eliten gab es allerdings eine breite Skala: Getaufte Juden, Konvertiten, wurden anders behandelt als nicht getaufte, wohlhabende anders als arme Juden. Aus den rigiden Vorschriften des „Freisinger Rechtsbuches“, welche die rechtlichen Beziehungen zwischen Juden und Christen minimierten, könnte ein Historiker, der die rechtliche Normierung der sozialen Realität gleichsetzen würde, auf die Idee kommen, dass den Juden bereits im Hohen Mittelalter jeglicher Eintritt in die ‘bessere’ christliche Gesellschaft und der soziale Aufstieg völlig unmöglich geworden war.
Dieses „Freisinger Rechtsbuch“ von 1328, das sich auf den Bayerischen Landfrieden von 1300, das Augsburger Stadtrecht (1276/1281) und vor allem auf den Schwabenspiegel stützt, enthält „hauptsächlich Vorschriften über Diebstahl, Erbrecht und die Juden“. In diesem Buch mit insgesamt 278 Artikeln werden Juden in vielen Punkten mit Christen gleichbehandelt, z.B. im Fall von Totschlag. Wichtig erscheint mir die Bestimmung, dass Juden nicht zwangskonvertiert werden durften. Allerdings waren Konvertierte voll ins bürgerliche Leben integriert und es wurde von Seiten der Christen alles getan, z.B. durch Sammlungen in Kirchen, dass der getaufte Jude wegen „leiblicher Not“ nicht mehr ins Judentum zurückfalle.92 Bestimmungen zu den Juden finden sich auch in „Des Kaisers Buch“ im oberbayerischen Landrecht von Kaiser Ludwig dem Bayern aus dem Jahre 1346. Der Art. 184a über die Juden wurde seltsamerweise später aus den Handschriften getilgt.93 Er wurde wohl als zu judenfreundlich empfunden.
Auf eine wohl positive Bewertung der jüdischen Kultur durch die christliche Umgebung deutet die erstaunliche Tatsache hin, dass auf den Wappen adeliger Familien, die unverkennbar jüdische Namen tragen, im Raum Freising im 15. Jahrhundert jüdische Symbole auftauchen. Ob man daraus den Schluss ziehen kann, dass es sich um Familien jüdischer Provenienz handelt, lässt sich nicht mehr klären, ist aber in Anbetracht der noch im 9. und 10. Jahrhundert im Raum Freising vorkommenden alttestamentlichen Namen wahrscheinlich. Das Wappen der adeligen Familie der Jud von Bruckberg „zeigt einen bärtigen Judenkopf mit dem entsprechenden spitzen Hut. Auch der Grabstein des Paulus Jud von Bruckberg von 1475 in der Bruckberger Pfarrkirche enthält das gleiche Wappen“94. Das Wappen der Familie Jud ist in stilisierter Form in Apians Wappensammlung abgebildet.95 Die schönste Darstellung bietet das Allianzwappen der Herren Jud und Radlkofer. Dieses befindet sich als Malerei auf dem Vorsatzblatt eines Psalters der Dombibliothek Freising. Diese Inkunabel ist 1477/78 gedruckt worden und befand sich im Besitz des altbayerischen Adelsgeschlechtes der Herren von Bruckberg.96 Der spitze Judenhut befindet sich hier sowohl auf dem Wappenschild als auch oberhalb der Wappenkrone. Aus dem beigefügten Text geht hervor, dass es sich um die Jud von Bruckberg handelt. Der spitze Judenhut scheint jedoch ursprünglich im Raum Freising nichts Ehrenrühriges gewesen zu sein. Denn selbst im Moosburger Graduale, „das der Dekan Johannes Perkhauser zwischen 1354 und 1360 für die Stiftskirche St. Kastulus in Moosburg zusammengestellt hat“, trägt der bärtige heilige Joseph „einen spitzen Judenhut.“97
Auf dem Grabstein in der Abb. 3 (unten) segnet Jesus vom Kreuz aus mit erhobenen Händen zwei Ritter. Der zu seiner Linken ist der Jud von Bruckberg, deutlich an seinem Wappen mit dem jüdischen Spitzhut erkennbar, der zu seiner Rechten höchst wahrscheinlich ein knieender christlicher Ritter, der keine Kopfbedeckung trägt. Auch in der nicht weit entfernten romanischen Kirche von Ainau (wohl um 1230 errichtet), heute in der Stadt Geisenfeld gelegen, zeigt das Tympanon beim Kircheneingang „die Seelen in Abrahams Schoß umgeben von Propheten und überragt von Christus als ‘Maiestas domini’“.98 Auch hier steht Jesus in der Mitte.
Abb. 1 und 2: Wappen der Jud von Bruckberg im Psalter des Nicolas (de Lyra), im unteren Bild ein Ausschnitt
Abb. 3: Grabstein mit Wappen der Jud von Bruckberg an der Außenwand der Pfarrkirche Bruckberg, Foto Sommerer Geisenfeld
Neben den Bruckbergern taucht auch das Geschlecht derer von Judmann, ein Name, der unverkennbar jüdisch klingt, seit der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Raum Regensburg und in Oberbayern auf.99 Der erste uns bekannte Judmann ist Gerold Judmann von Reichertshausen im Landkreis Freising. Nach Auffassung von Strzewitzek stammt Gerold nicht aus dem Geschlecht der Judmann, sondern der Sippe der Waldecker.100 Wie aber ein Waldecker zum Namen Judmann kam, ist aber nach wie vor nicht ausreichend geklärt. Gerold war sogar Bischof von Freising. Schlecht soll er jedoch sein Bistum elf Jahre lang verwaltet haben, deshalb wurde er wohl auch außerhalb des Münsters (monasterium) in der Vorhalle begraben. Nahe beim Grabstein von Gerold von Judmann befindet sich auch derjenige des Domdekans Tolkner (nach Goerge Tolknar), gestorben 1397. Auf dem oberen Teil des Tolkner’schen Grabsteins sieht man in seinem Wappen eine Katze mit einer Maus im Maul. Dabei sollen nach Sighart „früher“, also vor 1859, noch folgende Zeilen zu lesen gewesen sein:
„So wahr die Katz die Maus nit frisst / Wird je ein Jud ein wahrer Christ.“101
Diese Inschrift richtet sich nicht generell gegen die Juden, sondern wohl gegen Konrad von Tolkner. Wahrscheinlich ist die Initiative zum Anbringen dieser Inschrift unten am Tolkner’schen Grabstein von Freunden und Verwandten des gedemütigten Gerold von Judmann ausgegangen. Die obigen Verse deuten unverkennbar eine jüdische Vergangenheit bzw. Herkunft von Tolkner an. Darin sahen wohl manche Mitglieder des Freisinger Domkapitels und der Freisinger Geistlichkeit eine Schwachstelle Tolkners. Zudem war ja allgemein bekannt, dass Tolkner Gerold von Judmann 1230 in Rom verklagt und dessen Absetzung wegen der Verschleuderung von Freisinger Kirchengütern bewirkt hatte. Dem Streit zwischen Gerold Judmann mit Konrad von Tolkner lag eventuell auch ein politisches Motiv zu Grunde. Denn Gerold hatte Freising von dem judenfreundlichen Herzog Ludwig dem Bayern, dem späteren Kaiser, zu Lehen genommen und damit die politische Autonomie des Hochstifts Freising in Frage gestellt. Am 29. Juli 1230 setzte ihn dann der Papst wegen schlechter Bistumsverwaltung ab. Kaiser Ludwig bestätigte dieses päpstliche Urteil, er wollte es sich nicht noch weiter mit der Kurie verderben. Gerold starb als Canonicus am 29. März 1231.102 Sein 1,93 Meter hoher Grabstein, mit einer lateinischen Inschrift versehen, befindet sich als eine in einen Pfeiler eingemauerte rechteckige rote Marmorplatte in der Pauluskapelle des Freisinger Domes.103 Dieser Grabstein von Gerold Judmann weist keine erkennbaren jüdischen Symbole auf. Von den Judmanns hört man dann lange nichts mehr. Wie aus dem Nichts tauchten Ende des 14. Jahrhunderts die Judmanns im bayerischen Adel auf und starben wie so viele Adelsgeschlechter im 15. Jahrhundert aus.
In der Urkunde vom 12.12.1421 werden eine Reihe von Adeligen genannt, welche den Münchner Herzogen Ernst etc. versprachen, sich für eine bestimmte Zeitdauer „aller Gewaltthat zu enthalten.“104 Dazu gehörten auch die Judmanns. Ein Henricus Judmann von „Staingriff“, wohl die Hofmark Steingriff im Landgericht Schrobenhausen, wird Anfang des 15. Jahrhunderts als Domherr und späterer Dekan (Dechant) zu Freising genannt.105 Der Grabstein des 1436 Verstorbenen befindet sich im Kreuzgang des Domes zu Freising. Zu Füßen von Heinrich Judmann ist dort „das Wappen der Judmann, nämlich in einem blauen rechten Schrägbalken drei weiße Judenmützen, zu sehen.“106 Die Judmanns waren keine adelige Randerscheinung, denn Ulrich Judmann (1377 urkundlich genannt) war der Schwager des Hanns von Preysing zu Kronwinkel107, einem Geschlecht, das im Herzogtum Bayern bis zum Ende des Alten Reiches wichtige Positionen am Hofe der Wittelsbacher einnahm. Mit seinem Enkel Hanns starb das Geschlecht der Judmanns 1497 aus.
In der Geschichte Iberiens und Südfrankreichs lassen sich Beispiele für den Aufstieg von Juden in den Adel und in die hohe Geistlichkeit nachweisen. Das wohl bekannteste Beispiel ist Christoph Columbus, der als Sohn eines Juden 1451 in Genua geboren und in Spanien geadelt wurde. Der Großinquisitor Torquemada hatte eine jüdische Großmutter. In diesem Sinne kann man auch für Bayern nicht ganz ausschließen, dass die Jud von Bruckberg und die von Judmann jüdische Wurzeln haben, die allerdings weiter zurückreichen könnten als bis zum 14. Jahrhundert.
Abb. 4: Oberer Teil der Grabplatte mit Inschrift von Henricus Judmann, Foto: Herr Sommerer Geisenfeld
Eine einmalige Erscheinung in der Judenpolitik des späten Mittelalters, einer Epoche, in welcher der Antijudaismus immer mehr zunahm, ist Ludwig der Bayer, der einzige bayerische Wittelsbacher auf dem Kaiserthron im Mittelalter. Er war auch der erste, der nicht vom Papst, sondern vom römischen Volk zum Kaiser proklamiert worden war.
Unter seiner Herrschaft entstand auch das Freisinger Rechtsbuch. Thomas Heinz hat Ludwigs Beziehungen zu den Juden für so wichtig erachtet, dass er dazu das umfangreiche Kapitel „Ludwig der Bayer und die Juden“ in seine Ludwig-Biographie eingebaut hat. Heinz zeigt hier, dass der Kaiser schon zu Beginn seines politischen Auftretens nicht nur den Landesfürsten, sondern auch dem in Avignon residierenden Papst gegenüber eine unzweideutige Haltung in der Behandlung der Juden an den Tag legte. Er schritt immer wieder massiv gegen marodierende Adels- und Bauernbanden, welche die Juden vor allem in Franken, im Rheinland und im Elsass verfolgten und ermordeten, ein. In Mandaten und Erlassen forderte er die Landesfürsten auf, Leib und Gut der Juden zu schützen. Den seit dem 14. Jahrhundert immer mehr um sich greifenden Klischees der Hostienschändung, Ritualmorde an Kindern und der Brunnenvergiftung durch Juden stand er äußerst ablehnend gegenüber. Absolut heftig war sein Eingreifen, als man in München die Leiche eines männlichen christlichen Knaben entdeckte. Die sog. öffentliche Meinung erklärte diesen Todesfall, ohne dass irgendwelche Beweise vorlagen, als jüdischen Ritualmord. Den Juden drohte daraus ein ähnliches Schicksal wie 1298 in Franken, als die dortige Rindfleischbande allein in Würzburg 900 Juden gelyncht haben soll. Kaiser Ludwig war über diese Anschuldigung und das Verhalten der Münchner Bürger den Juden gegenüber so empört, dass „er es gestattet habe, die Wallfahrer [die an den sog. Tatort gezogen waren und den toten Knaben als Martyrer verehrten] auszuplündern und zu verprügeln.“ Der Kaiser soll sogar den Befehl erteilt haben, „die an der Fundstelle der Leiche errichteten Buden sowie ein Kreuz niederzureißen und die Trümmer wegzuräumen.“ Ludwigs Chronist, der ansonsten dem Kaiser sehr positiv gegenüberstand, ließ sich auf Grund dieses Vorgehens gegen die Judenfeinde zu der Aussage hinreißen, dass der Kaiser „nicht im Einklang mit dem katholischen Glauben und der Gerechtigkeit gestanden hätte.“
Auch im Elsass schritt Ludwig gegen eine antijüdische Bande vor Colmar im Frühjahr 1338 ein. Diese Bande war nahe daran, die nach Colmar geflüchteten Juden umzubringen. Am 11. März 1338 entschied auf Antrag der Herzöge von Österreich (Vetter von Ludwig) das kaiserliche Hofgericht, „daß jedermann, der die unter deren Herrschaft stehenden Juden erschlagen habe oder daran eine Mitschuld trage, den Klägern mit Leib und Gut verfallen sei.“ Am 16. Mai 1338 wies Ludwig den Herrn Gerlach von Limburg und die Stadt Limburg an, „die von den benachbarten Herren und Bauern bedrängten Juden als des Reiches Kammerknechte zu schützen und wieder in die Stadt aufzunehmen.“ Die kaiserliche Protektion reichte aber nicht immer aus, die Juden gegen marodierende antijüdische Banden zu schützen. Besonders die „Judenschläger“ unter der Führung des „König der Armleder“ trieben ihr Unwesen und „rotteten im süddeutschen Raum viele jüdische Gemeinden gänzlich aus.“ Überlebende Juden sind unter anderem auch in die Schweiz und wohl auch in die Papststadt Avignon geflüchtet. In Zürich wurde ihnen nicht nur das Gast-, sondern oft sogar das Bürgerrecht gewährt.108
Kaiser Ludwig schützte nicht nur die deutschen Juden, sondern war auch bereit, die in England und Frankreich schlecht behandelten Juden als (steuerpflichtige) Kammerknechte in Deutschland aufzunehmen, und gestattete auch den Angehörigen des niederen Adels, kleinere Gruppen von ausländischen Juden anzusiedeln. Ludwig war in einem Maße Schutzherr der Juden im Reich, dass sogar seine Gemahlin ihm vorwarf, „sich als ein Freund der Juden zu verhalten.“ Noch weiter ging sein Sohn Ludwig, Markgraf von Brandenburg, der in seinem Vater „einen Feind der christlichen Religion“ gesehen haben soll. Kaiser Ludwig, der viele Jahre lang im Machtkampf gegen die Päpste von Avignon einen schweren Stand hatte, machte sich mit seinen judenfreundlichen Maßnahmen nicht nur bei Papst und Kirche, sondern auch beim ‘christlichen’ Volk verhasst und schwächte damit seine Machtbasis.109 Diese gerechte Behandlung der Juden hat sich auch nicht gerade positiv auf die Beurteilung des Kaisers in der (bis heute fortwirkenden) nationalen Geschichtsschreibung ausgewirkt. Für die Päpste von Avignon, welche dem Exkommunizierten die Absolution verweigerten, war er der Drache der Apokalypse, sein plötzlicher Tod bei der Jagd in den Wäldern von Fürstenfeld wurde auch als Gottesgericht gedeutet. Die Geistlichkeit in München verweigerte dem Toten darum auch eine würdige feierliche Bestattung, wie sie einem Kaiser zugestanden hätte. Wir dürfen davon ausgehen, dass sich gewiss noch weitere positive Beispiele bei näherem Nachforschen auf Seiten des deutschen Adels finden ließen. Auch Bürger und Bauern waren nicht immer und überall Feinde der Juden, wie die Beispiele der Rindfleisch- und Armlederbande um 1300 herum verdeutlichen.
Juden waren in ganz Europa bis weit in die Neuzeit hinein häufig Hof- und Hausärzte höchster Kreise. Es ist nicht zu übersehen, dass trotz der rigiden Bestimmungen des Laterankonzils, der oft judenfeindlichen regionalen Rechtsbücher und des Antijudaismus der Massen die kirchlichen und weltlichen Machthaber mit den Juden vielfach recht eng zusammenarbeiteten und letztere in der Regel unter ihren besonderen Schutz stellten. Diese soziale und wirtschaftliche Symbiose äußert sich unter anderem auch darin, dass betuchte Juden, z.B. jüdische Bankiers, bis weit in die Neuzeit hinein sehr häufig in unmittelbarer Nähe der Domkirchen lebten und unter dem Schutz des Bischofs standen.
Wenig bekannt und in der europäischen Forschung kaum beachtet ist die erstaunliche Tatsache, dass die Juden mehr als in allen anderen europäischen Staaten in Italien „am relativ ruhigsten und sichersten leben konnten.“ Natürlich gab es auch in Italien und von Seiten des Vatikans Verordnungen und Erlasse, die sich gegen die Juden richteten. Auch in Italien und Rom wurden die Juden in Gettos, oft auch eine Schutzmaßnahme, eingeschlossen, „aber oft existierten diese Bestimmungen nur in der Theorie und wurden nicht oder kaum in die Praxis umgesetzt.“110 Wie wenig es berechtigt ist, von einem judenfeindlichen Vatikan zu sprechen, zeigt die Tatsache, dass immer wieder Männer jüdischer Herkunft als Päpste gewählt werden konnten. So wurde Pietro Pierleoni, der um 1090 in Rom zum Christentum konvertierte, 1116 Kardinal, 1121 päpstlicher Legat in England und Frankreich und 1130 als Anaklet II. sogar Papst.111
Wenig bekannt ist auch die Tatsache, dass neben dem Osmanischen Reich der Vatikan gegen den ausdrücklichen Rat der jüdischen Gemeinde von Rom den größten Teil der aus Spanien Ende des 15. Jahrhunderts vertriebenen Juden aufnahm.112 Ein jüdisches Ghetto, „Il Ghetto“, wurde in Rom südlich des Largo Argentina auf Veranlassung von Papst Paul IV. erstaunlicherweise erst im Jahre 1555 eingerichtet. Reiseführer deuten dieses römische Ghetto (und überhaupt die jüdischen Ghettos in Europa) allzu simplifizierend als Zeichen eines seit dem späten Mittelalter wachsenden Antijudaismus und die römischen Juden als „Opfer päpstlicher Willkürherrschaft.“113 Dazu scheint auch der seit dem 15. Jahrhundert überlieferte Nacktlauf der Juden inkl. deren Verunglimpfung (sogar im Winter) durch die römische Masse gut zu passen. Es gab wohl auch in Rom unsoziale Gepflogenheiten, denen sich nicht einmal der Papst entziehen konnte. Auch in Rom war es eine ‘bewährte’ Methode, dass die Volksmasse bei gewissen Gelegenheiten ihren Zorn und Frust an den Juden als Sündenböcken ablassen durfte. Übertreibungen und Eskalationen wurden allerdings durch den Papst sanktioniert.
Die wachsenden Ressentiments gegen die Juden gingen also im Fall von Rom nicht vom Vatikan und der römischen Elite aus, sondern wohl eher von der großen Masse des Volkes. Warum hätte der Vatikan so viele vertriebene spanische Juden in Rom und im Vatikanstaat aufnehmen und willkommen heißen sollen, nur um sie dann in Ghettos zu diskriminieren? So eine Betrachtungsweise wäre fern jeglicher Logik.
Die Klimaverschlechterung des ausgehenden Mittelalters und der frühen Neuzeit führte in Verbindung mit den negativen Auswirkungen des Frühkapitalismus zu erheblichen Preissteigerungen der Lebensmittel und Grundbedürfnisse114 und wohl auch zu einer massiven Verschlechterung der Einkommens- und Vermögensverteilung der breiten Volksmassen. Das frühkapitalistische Wachstum (Bergbau- und Großhandelsgesellschaften) kam ebenso wie die Globalisierung des 21. Jahrhunderts nicht einmal in Rom (von anderen Regionen ganz zu schweigen) der großen Masse des Volkes zu gute. Die wachsende „antikapitalistische Bewegung in Deutschland“115 ist ohne steigende Massenarmut nicht erklärbar. Die Masse der Menschen sah darum auch hier die Schuld bei den Juden.
Es ging aber auch anders. Im Bereich der bürgerlichen Alltagskultur finden wir z.B. seit dem 16. Jahrhundert in Franken erfreuliche Formen des Zusammenlebens und –wirkens zwischen Christen und Juden, welche vielfach den Rang von Bürgern hatten. So hatten in manchen fränkischen Orten Juden wie Christen die Pflicht zur Tag- und Nachtwache. An manchen Orten Frankens mussten sie sogar am gemeinen Rügegericht mitwirken. Die Gemeinde Forth bei Erlangen bestand aus „Juden und Christen“. Es gab sogar einen eigenen Judenschultheiß im Dorf, der die Rechte und Belange der Juden gegenüber der Obrigkeit zu vertreten und sich um den Schutz der Juden gegen Angriffe von Nichtjuden zu kümmern hatte. In größeren Fürstentümern war der Judenschutz eine Angelegenheit der Landesfürsten. Dieser Judenschutz konnte sogar wie ein Nutzungsrecht an andere Fürsten übertragen werden.116
Bei der kommunalen Rechnungslegung feierten Juden und Christen gemeinsam.117 „In Biebelried (Franken) erhielt 1556 ein Jude (sogar) das Amt des Försters.“118 Auch in einigen Gemeinden von Schwaben „hatten die Juden vollen Anteil an den Gemeindegütern und den Nutzungen.“119 Wie stark nicht nur das städtische (Fürth, Nürnberg, Würzburg etc.), sondern auch das Landjudentum in Franken die fränkische Kulturlandschaft prägte, zeigen die neueren Forschungen der Arabistin Frau Rajaa Nadler im oberfränkischen Ermreuth. Sie zeigt, dass es in Franken nicht nur Antijudaismus und Antisemitismus von Seiten der christlichen Bevölkerung gab (und auch heute noch gibt), sondern dass es immer wieder Epochen eines harmonischen und toleranten Zusammenlebens gab.120
Neben den drei fränkischen Regierungsbezirken war in Nordbayern das wittelsbachische Fürstentum Pfalz-Sulzbach ein weiteres Territorium, in welchem der Landesfürst bereits ab 1666 den Juden ein dauerndes Aufenthaltsrecht mit weitreichenden Freiheiten auch im wirtschaftlichen Bereich gewährte. So konnte sich die Stadt Sulzbach zu einem der größten Druckorte für hebräische Literatur in ganz Europa entwickeln. Es war auch ein bevorzugter Standort für lutherische, reformierte und katholische Drucker. Die Angehörigen der drei christlichen Konfessionen und die Juden konnten hier in Frieden und Wohlstand zusammenleben. Mit dem sog. Simultaneum, einem Toleranzedikt für die christlichen Konfessionen, hatte Christian August von Sulzbach bereits wenige Jahre nach dem 30jährigen Krieg neue Maßstäbe der Religionspolitik gesetzt. Unter solchen in Europa bisher nur wenig bekannten Voraussetzungen konnte sich die Sulzbacher Residenz zu einem europäischen Geisteszentrum entwickeln. Seit 1668 trug zudem das Wirken des Universalgelehrten und Literaten Christian Knorr von Rosenroth zu einer weiteren Belebung des Sulzbacher Musenhofes bei. Er „übersetzte zahlreiche Werke der Frühaufklärung ins Deutsche“ und die hebräische Kabbala ins Lateinische. Mit dem Sulzbacher Musenhof standen so bedeutende Gelehrte wie der Philosoph Leibniz und Franciscus Mercurius, der Alchemist, Kabbalist, Theosoph, Arzt, Rosenkreuzer in einer Person war, in reger Verbindung.121 Mercurius war seit 1677 Quäker und wie sein Freund Knorr von Rosenroth ein guter Kenner der hebräischen Sprache und der jüdischen Kultur. Bei der Ansammlung von so viel Geist verwundert es nicht, dass sich die hebräischen Druckereien als besonderer Ausdruck des jüdischen Kulturlebens in Sulzbach trotz der seit dem frühen 19. Jahrhundert wachsenden „Deutschtümelei“ bis 1851 in Sulzbach halten konnten.
Diese Deutschtümelei, deren „infantilen Extremismus“122 bereits Heinrich Heine verachtete, nahm erst in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, besonders nach der Gründung des Deutschen Reiches, extreme Ausmaße an und schlug immer mehr in einen rassistisch geprägten Antisemitismus um. In der Zeit zwischen dem Wiener Kongress und der Revolution von 1848 war jedoch das Zusammenleben zwischen Christen und Juden noch nicht so stark vergiftet und in manchen Gegenden Deutschlands noch durchaus erträglich. Es gab allerdings schon vor 1848 Theaterstücke wie „Die Judenschule“ und „Unser Verkehr“ wie auch ‘historische’ Abhandlungen, in denen Juden offen verhöhnt wurden. Im „Judenspiegel“ von 1819 war die Tötung eines Juden keine Sünde und kein Verbrechen, sondern nur ein „Polizeivergehen“.123 Der latente Antijudaismus konnte jedoch bei besonderen Gelegenheiten auch vor 1848 immer wieder wie eine Pest offen ausbrechen. Selbst in einer so weltoffenen und toleranten ‘englischen’ Stadt124 wie Hamburg, in der seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert Juden und Christen – Heinrich Heine bezeichnet die Hamburger Christen als „getaufte Juden“, die Hamburger Juden als „ungetaufte Juden“ – harmonisch zusammen lebten und Geschäfte betrieben, machte in der sog. Juli-Revolution von 1830 „der Pöbel in den Straßen Jagd auf Juden oder warf ihnen die Fenster ein, wenn sie am Abend Licht zu machen wagten. Viele Häuser wurden demoliert.“ Das Haus des in Hamburg höchst beliebten Kaufmanns Salomon Heine, Onkel und Finanzier von Heinrich Heine, am Jungfernstieg „entging gerade noch einem Steinhagel“.125 Solcher Antijudaismus gewann immer mehr Raum in einer Zeit, als sich Juden in allzu leichtfertigem Verzicht auf ihre Tradition allzu schnell an die deutsche Kultur assimilierten. Juden wurden damals verhöhnt, nicht weil sie ihre jüdische Tradition pflegten, sondern weil sie als „sterile[n] Mischlinge aus Deutschtum und Judentum“ (Heine) ihre Tradition vergaßen und die allen Juden gemeinsame Tora verleugneten.126 Tora bedeutet wörtlich die von Gott ausgehende „Weisung“.
Das in manchen Regionen wie z.B. im katholischen Rheinland noch sehr harmonische Zusammenleben von Christen und Juden im sog. Vormärz äußerte sich auch im Bildungswesen. Am Düsseldorfer Lyzeum hatte z.B. Heinrich Heine (1797-1856) „viele katholische Priester, unter ihnen auch einige Jesuiten“127 als Lehrer. Hier legte Heinrich Heine den Grundstock für seine spätere Einstellung zum Katholizismus:
„Ich habe eigentlich immer eine Vorliebe für den Katholizismus gehabt, die aus meiner Jugend herstammt und mir durch die Liebenswürdigkeit katholischer Geistlicher eingeflößt ist.“
Das Verhältnis von Harry Heine und seiner Familie zum Katholizismus nahm in Düsseldorf sogar groteske Züge an. Die Familie von Heinrich Heine wohnte in Düsseldorf in einem Haus, dessen Bewohner nach altem Herkommen bei Prozessionen einen katholischen Altar vor dem Haus zu errichten und zu schmücken hatten. Vater Samson Heine „setzte seinen Stolz darein, diesen Altar so kostbar wie möglich zu machen; und der junge Harry wirkte freudig mit“128. Dort nahm er die „katholische Humanität“ als wichtigen Bestandteil seines Lebens in sich auf. Aus der Sicht der von ihm in Düsseldorf genossenen katholischen Erziehung waren für ihn „Freisinnigkeit und Katholizismus“129 keine Gegensätze. Sein offenes Bekenntnis zum Judentum war für den offiziell zum Protestantismus konvertierten Heine kein Hindernis, sich in der Kirche St. Sulpice in Paris mit seiner Crescentia Mathilde, geb. Mirat, katholisch trauen zu lassen.130 Sie konnte bei ihm ungehindert ihren Glauben praktizieren. Seine Liebe zur katholischen Mathilde war, wie es bei König Salomo heißt, „stark wie der Tod.“ Es gibt also nicht nur eine christliche Toleranz den Juden, sondern auch eine jüdische Toleranz Christen gegenüber. Heinrich Heine und seine Liebe zur katholischen Mathilde ist nur ein Beispiel unter vielen.
Die in diesem Kapitel dargestellten positiven Beispiele christlicher und jüdischer Toleranz dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Antijudaismus und -semitismus diese positiven Ansätze einer jüdisch-christlichen Symbiose immer wieder und im 19. und 20. Jahrhundert in wachsendem Maße in den Schatten stellten.