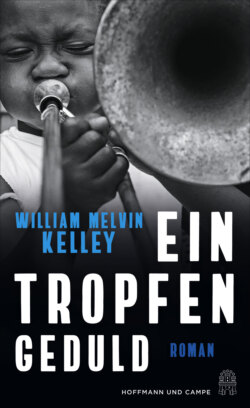Читать книгу Ein Tropfen Geduld - William Melvin Kelley - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеAls Ludlow acht Stunden später erwachte, nahm er als Erstes die Autos und Menschen auf der Straße wahr. Er drehte sich um und legte die Finger auf den Wecker (ein ganz normaler, nur ohne die Glasabdeckung), stellte fest, dass es ein Uhr war, und krabbelte aus dem Bett. Neben dem Fußende fand er das zusammengeknüllte Taschentuch, das er am Abend zuvor verwendet hatte, und schleuderte es weg, zum ersten Mal verärgert über das, was er damit tat. Das würde jetzt nicht mehr genügen.
Er hatte überhaupt keinen Hunger, und da er sich davor scheute, mit jemandem zu reden, weil er befürchtete, dass inzwischen alle Welt wusste, was vergangene Nacht zwischen ihm und Malveen geschehen war, blieb er in seinem Zimmer und setzte sich ans Fenster, durch das ein warmer Wind hereinwehte. Er spielte lautlos auf seinem Instrument, dachte aber in den folgenden fünf Stunden, anders als erhofft, kaum an Musik. Stattdessen ging er in Gedanken immer wieder durch, was geschehen war, und sann über sein Leben seit Verlassen des Heims nach. Schließlich glaubte er, das Wesentliche begriffen zu haben.
Das Leben war außerhalb des Heims genauso, wie es im Heim gewesen war. Die Leute, die über einem waren, versuchten einen unten zu halten, und die Leute, die unter einem waren, versuchten einen nach unten zu ziehen.
So einfach war das. Dass das im Heim galt, wusste er schon lange. Der Fehler war gewesen, zu glauben, dass es draußen anders sein würde, besser. Aber es würde niemals besser oder anders sein. Als er das erkannte, fühlte er sich nicht mehr ganz so mutlos.
Genau in diesem Moment klopfte Etta-Sue Scott an die Tür. Mit seiner neuen Erkenntnis im Kopf öffnete er ihr.
»Mama hat gemeint, Sie kommen sonst um diese Zeit immer zum Essen runter. Sie macht sich Sorgen.«
»Muss sie nicht.« Er wandte sich bereits wieder dem Fenster zu. »Ich hab keinen Hunger.« Er wusste, wie er klingen wollte, nämlich verärgert, und war überrascht, dass seine Worte ziemlich genau so herauskamen.
Ein langes Schweigen folgte; sie blieb auf dem Flur stehen, obwohl er die Tür offen gelassen hatte. Als sie schließlich wieder sprach, war etwas aus ihrer Stimme verschwunden – Mitleid vielleicht, oder Herablassung –, und sie klang nervös. »Essen Sie heute woanders?«
»Ich ess heute gar nicht. Ich mach eine Diät.« Das war noch besser. Ganz plötzlich wurde ihm klar, warum er früher nie so hatte reden können: Er hatte nicht dahintergestanden.
»Sie sind doch nicht zu fett.« Das meinte sie vollkommen ernst.
»Aber meine Füße. Vom vielen Stehen. Ich hab fette platte Füße.«
Sie stutzte, dann kicherte sie. »Ach, Sie halten mich zum Narren.« Sie war überhaupt nicht verärgert. »Fette platte Füße!« Sie hörte auf zu lachen. »Wollen Sie wirklich nichts essen?«
»Nein. Ich hab keinen Hunger.« Er sagte es noch eine Spur harscher.
Ein kurzes Schweigen. »Mister Washington? Es ist nicht wegen mir, dass Sie nicht zum Essen kommen, oder?«
Das überraschte ihn. Er konnte sich nicht entscheiden, ob er seine Überraschung zeigen sollte oder nicht. Also antwortete er mit einer Frage. »Wieso, was haben Sie denn getan?«
»Na ja, ich … vielleicht war ich gestern ein bisschen kurz angebunden.« Sie hielt inne. Ehe er etwas dazu sagen konnte, fuhr sie fort: »Das war nicht wegen Ihnen. Mama und ich haben uns gestritten, bevor Sie runtergekommen sind. Herrgott, ich bin fast zweiundzwanzig! Ich wohn seit vier Jahren nicht mehr zu Hause, jedenfalls die meiste Zeit, aber wenn ich hier bin, sagt sie mir immer, was ich tun und lassen soll, als wär ich ein kleines Kind.« Jetzt schlurfte sie in ihren Hausschuhen ins Zimmer. »Das macht mich so wütend! Ich will nicht gesagt kriegen, was ich wann zu tun habe. So wie gestern, als Sie unten waren und sie gemeint hat, ich soll nicht in das Lokal, wo Sie arbeiten. Aber wenn ich nun einfach Lust habe, mal vorbeizukommen, ein bisschen zuzuhören und vielleicht ein Bier zu trinken? Sie denkt ja, ich wär eine ganz Schlimme, wenn ich in Willson City bin, dabei stimmt das überhaupt nicht« – sie war einen Moment lang verlegen –, »aber wenn ich nach Hause komme, behandelt sie mich wie ein Baby.«
Ludlow hatte auf einen bestimmten Ton in ihrer Stimme gehorcht, den Kopf in ihre Richtung geneigt. Es war nicht das erste Mal, dass jemand, den er überhaupt nicht kannte, ihm mehr erzählte, als diese Person hätte erzählen sollen, mehr als Ludlow hören wollte. Im Boone’s war das schon einige Male passiert. Dieser Ton bedeutete, dass die betreffende Person nicht mit Ludlow sprach, sondern mit sich selbst, so als wäre er gar nicht da, oder als hätte seine Blindheit nichts mit seinen Augen zu tun – als hinderte sie ihn nicht daran, zu sehen, sondern daran, gesehen zu werden. Als Etta-Sue aufhörte zu reden, hing er weiter seinen Gedanken nach. Ja er merkte überhaupt erst, dass sie aufgehört hatte zu reden, als sie wieder anfing.
»Ich wollte Sie also nicht kränken oder so, als ich gestern so kurz angebunden war. Ich war einfach sauer auf Mama. Es wär schön, wenn Sie zum Essen runterkommen würden, falls Sie wirklich nichts anders vorhaben.« Ihre hohe Stimme brach fast unter der Bürde der Entschuldigung.
Ludlows normale Reaktion wäre es gewesen, ihr zu verzeihen, wenn es denn überhaupt irgendetwas zu verzeihen gab. Aber damit hätte er seinen momentanen Vorteil aufgegeben. »Sie haben mir nichts getan.« Er sagte es so, als hätte sie ihm sehr wohl etwas getan und als wäre er immer noch böse auf sie. »Ich hab bloß einfach keinen Hunger.«
Sie blieb einen Moment stumm, dann sog sie an ihrer Zunge. »Na gut.« Sie schlurfte Richtung Tür. »Ich sag Mama Bescheid.« Sie war traurig. Einen Augenblick lang hätte er am liebsten eingelenkt und ihr gesagt, dass er mit ihnen essen würde, aber er wagte es nicht. Er wollte sich nie wieder selbst in eine Situation bringen, in der man ihn so leicht erniedrigen, verletzen oder beschämen konnte. Denn wenn sich die Gelegenheit dazu bot, würde irgendwer sie garantiert ergreifen. Ein Klappern und Klacken, als sie die Tür zumachte, dann waren ihre Schritte nicht mehr zu hören.
Wenig später, gegen sieben, kam Hardie, um ihn abzuholen. Ludlow ging ihn an, kaum dass er ins Zimmer getreten war. »Du hast mich vielleicht reingeritten, du Mistkerl.«
Hardies Stimme lächelte. »Wie das?«
»Mit Malveen. Du hast mir alles falsch erklärt.« Mit den Fingern inspizierte er den frisch gebundenen Knoten seiner Fliege.
»Was ist denn passiert? Hast du nicht gekriegt, was du wolltest?«
Er erzählte nur die halbe Wahrheit. »Sie hat mich rausgeschmissen, als ich überhaupt nichts anhatte. Ich musste mich im Flur anziehen, vor einer ganzen Schar kichernder Huren.« Wenn er daran dachte, spürte er wieder, wie peinlich und peinigend das gewesen war. Aber das war ihm nicht anzuhören.
»Wirklich? Das hätt ich gern gesehen.«
»Das hätte dir mal passieren sollen!«
»Nur zu gern. Für ein Nümmerchen mit der hätt ich das riskiert.«
Ludlow wusste nicht, was er antworten sollte. Er schnalzte mit der Zunge, so wie Hardie es manchmal tat.
»Na, dann hast du dieses Mal halt verloren. Das nächste Mal gewinnst du. Außerdem wirst du diesen Fehler nie wieder machen – was immer das für ein Fehler war.« Hardies Stimme wurde vom Ächzen des Federrosts begleitet, er hatte sich gesetzt. »Man kann nicht immer gewinnen.«
»Das will ich aber, jedenfalls so oft es geht.« Ludlow zog sein Jackett an.
Hardie schnaubte. »Wer will das nicht, Mann.«
Ludlow lachte. Er wollte Hardie gegenüber keine Rolle spielen. Tatsächlich fühlte er sich ihm gegenüber jetzt aber anders als zuvor. Er fühlte sich ihm zum ersten Mal ebenbürtig, und Hardie schien das nichts auszumachen.
Als sie das Boone’s betraten, kam Small-Change gleich angerannt: »Was hast du denn mit der angestellt, Kleiner?«
Ludlow wurde heiß. Jetzt würden gleich alle erfahren, was in der vergangenen Nacht wirklich gelaufen war. »Wovon redest du?«
»Mach mir nichts vor, Kleiner. Ich hab Malveen heute getroffen, und sie hat gesagt, dass sie jetzt von einer besseren Bar aus arbeitet, wo die Kerls mehr Drinks spendieren. Ich hab gesagt, gut, dann arbeiten wir beide dort, aber sie hat gesagt: Nein, das geht nicht. Ich frage, warum denn nicht? Und sie sagt, weil es nicht geht, ganz einfach. Lass mich in Ruhe. Aber Small-Change ist ein kluges Köpfchen und lässt sich nicht so leicht abwimmeln!« Sie klang triumphal, fast freudig. »Also hab ich weitergebohrt. Und irgendwann hat sie dann gesagt, sie will wegen dir nicht mehr im Boone’s arbeiten. Weil sie dich nicht ausstehen kann.«
Ludlow blieb ruhig, es war seine einzige Chance. »Und warum nicht?«
»Sie hat gesagt, du hättest sie mies behandelt. Sie meint, du hast sie übers Ohr gehauen.«
»Ich hab was?« Ihm war klar, dass er nichts anderes tun konnte, als Fragen zu stellen, wenn er sich nicht verraten und bloßstellen wollte.
»Du hast sie übers Ohr gehauen. Sie hat gesagt, du hättest ihr was versprochen und sie dann mies behandelt.« Small-Change war nicht wütend. Was sie anstachelte, war reine Neugier. »Was hast du ihr versprochen?«
Er holte sehr tief Luft, ehe er antwortete. »Was geht dich das an, Baby?«
»Nichts.« Sie hielt inne. »Du bist ein böser Mann, Ludlow Washington.« In ihrer Stimme schwang Bewunderung mit.
»Tja, dann komm mir einfach nicht in die Quere.« Diesmal musste er nicht erst tief Luft holen.