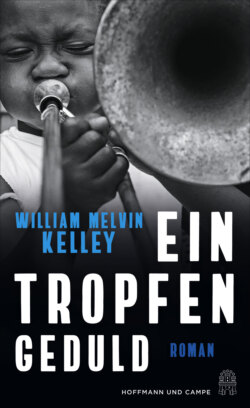Читать книгу Ein Tropfen Geduld - William Melvin Kelley - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеLudlow wurde in einem Haus nicht weit von Boone’s Café untergebracht. Sein Zimmer war sieben Schritte lang und fünf Schritte breit – mehr Platz, als er je in seinem Leben für sich allein gehabt hatte. Es gab ein Bett, lang und schmal und hart, und eine Kommode mit blasiger Oberfläche. Und sogar ein Fenster, das zur Straße hinausging. An den meisten Abenden, wenn die Luft schwer war, lachten und scherzten Leute unter seinem Fenster, und aus vier oder fünf Jukeboxen in der Nachbarschaft drang Musik zu ihm herein. Würzige Barbecuesoße von einem Stand an der Ecke blähte seine Nasenflügel. Sowohl vor als auch nach der Arbeit setzte er sich ans Fenster und spielte sein Instrument nur mit den Fingern. Er lebte seit drei Monaten nicht mehr im Heim.
Schon seit Ewigkeiten – seit dem Moment, als der Direktor ihm gesagt hatte, dass man seine Familie nicht ausfindig machen könne – hatte er die Tage bis zu seinem achtzehnten Geburtstag gezählt, ab dem er kein Staatsmündel mehr sein würde. Eine offizielle Zeremonie würde es nicht geben, nur eben den achtzehnten Geburtstag und seine Einbestellung zum Direktor. Der Direktor würde ihm sagen, dass er gehen konnte, vielleicht auch, dass man ihm eine Stelle besorgt hatte.
Aber dann war Ludlow lange vor seinem achtzehnten Geburtstag einbestellt worden – einen Monat nach dem sechzehnten. Der Direktor hatte ihm gesagt, dass er ab diesem Tag und für die kommenden zwei Jahre unter der Vormundschaft eines gewissen Mister Bud Rodney stehen werde, eines schwarzen Bandleaders in New Marsails. Ludlow solle auf der Stelle seine Kleider zusammenpacken, Rodney werde in zwei Stunden kommen, um ihn abzuholen.
Während er in den Raum zurückging, den er sich in den vergangenen Jahren mit zwanzig anderen Jungs geteilt hatte, versuchte er vergeblich, sich zu erklären, wie es zu dieser Wendung gekommen war. Er beschloss, Rodney auf der Fahrt nach New Marsails danach zu fragen.
»Dann stellen wir das gleich mal klar.« Rodney war einen Kopf kleiner als Ludlow, seine nölige Stimme drang von unten an Ludlows Ohren. »Du bist aus dem Heim rausgekommen, weil ich ein hübsches Sümmchen für dich bezahlt hab.« Er hielt inne, wartete wahrscheinlich auf eine Antwort. Aber Ludlow war zu überrascht, um irgendetwas zu sagen, wobei er sich schon fragte, was er wohl wert gewesen war. Rodney fuhr fort: »Ich hab dich letztes Jahr bei der State Competition spielen hören.« Das war ein jährlich ausgetragener Wettbewerb zwischen den Bands der staatlich geführten Schulen und Heime. »Ich hab mir gedacht, früher oder später wird dir jemand viel Geld bieten, mehr als ich zahlen kann, aber ich wollte dich nun mal in meiner Band haben. Also bin ich zu deinem Direktor und hab ihm ein bisschen Geld auf den Tisch geblättert, und er hat dich mir überlassen.« Rodney war ziemlich stolz auf sich. »Um das also klarzustellen, Kleiner: Du bist jetzt mein Sohn, und in den nächsten zwei Jahren spielst du für niemand anders und machst mir keinen Ärger. Denn sonst landest du wieder im Heim.« Ludlow nickte. Er war verkauft worden, hatte einen neuen Herrn, aber wenigstens war er nicht mehr im Heim. Er entspannte sich und genoss die Fahrt, noch nie zuvor hatte er in einem Auto gesessen.
Es war keine schlechte Wendung gewesen. Mister Rodney zahlte ihm einen besseren Lohn, als er ihn sonst irgendwo hätte kriegen können, allerdings entdeckte Ludlow schnell, dass er nur ein Drittel von dem erhielt, was die anderen in der Band bekamen. Aber das spielte keine Rolle. Ab und zu dachte er an seinen früheren Herrn, der, nun ohne Sklave, noch ein weiteres Jahr im Heim bleiben musste.
Das Haus, in dem er wohnte, gehörte einer Frau mittleren Alters, Missus Bertha Scott, die auf ihren knarrenden Holzböden herumpolterte, als wären ihre Füße ebenfalls aus Holz. Sie mochte Ludlow sofort, das verriet ihre Stimme. Obwohl sie keine Pension führte, sondern nur ein Zimmer ohne Verpflegung vermietete, bewirtete sie ihn manchmal in ihrer Küche. Ludlow wusste nicht, ob er sie mochte, er hatte bisher zu selten mit Frauen zu tun gehabt, um das beurteilen zu können. Wenn er in ihrer Küche saß und ihr Essen verspeiste, während sie zwischen Herd, Anrichte und Eisschrank herumwuselte, überließ er das Reden größtenteils ihr. »Ich hab nichts gegen Musiker. Die meisten Leute meinen ja, die wären gottlos, aber ich denk mal, Jesus vergibt Musikern ihre Sünden genauso, wie er dem Dieb vergeben hat.« An diesem Tag hatte sie einen besonderen Schmortopf für ihn gekocht, und jetzt stand sie am Herd und schöpfte ihm eine Portion auf einen Teller, während er dasaß und über sein Besteck strich.
»Gott mag Musik bestimmt auch – alle Arten von Musik. Ihr könnt ja nichts dafür, denk ich mal, dass ihr in so Kaschemmen spielen müsst, mit all den Flittchen in ihren hautengen Kleidern. Aber selbst die sind zum Teil anständige Mädchen, nur halt auf Abwege geraten. Bitteschön, mein Junge.« Der Teller klirrte, als sie ihn zwischen seine Hände stellte. Er neigte den Kopf und wartete darauf, dass sie ihm sagte, was wo auf dem Teller lag, aber wie üblich vergaß sie es.
»Ma’am, Sie –« Er sprach es ins Leere, war sich nicht sicher, wohin sie gegangen war.
»Tschuldigung, mein Sohn. Na dann schaun wir mal, wie ihr das macht.« Ihr Atem wärmte seine linke Gesichtshälfte. »Der Schmortopf liegt zwischen vier und acht Uhr. Ich hab dir auch ein paar Erbsen aufgetan, die sind ungefähr bei neun und zehn. Ein Paar Scheiben Cornbread auf zwölf, und auf eins und zwei eine gekochte Kartoffel. Ein Glas Wasser hinter dem Teller bei zwölf. Hast du’s?«
»Ja, Ma’am. Danke.« Er griff nach der Gabel, zielte auf den Bereich, wo der Schmortopf sein sollte, und spürte, wie sie in ein Stück Fleisch sank. Er führte es zum Mund und kaute, der Saft rann in seine Kehle. Dann wollte er die Kartoffel aufspießen, doch sie rutschte weg, und die Gabel stieß auf den Teller.
Missus Scott war um den Tisch herumgepoltert und hatte sich ihm gegenüber gesetzt. »Oh, die hätte ich ein bisschen zerdrücken sollen. Moment.« Sie verschob den Tisch ein kleines bisschen und nahm ihm die Gabel ab, während sie weiterplauderte. »So, jetzt. Wie … wie lang hast du das schon, mein Junge?«
»Ma’am?« Er hatte den Mund voll.
»Wie lang bist du schon –«
»Schon immer, Ma’am.«
Sie schnalzte mit der Zunge. »So eine Schande. Und wie ist das so?« Sie hatten noch nie darüber geredet.
Er versuchte zu antworten, konnte es aber nicht. Er hatte nie sehen können und ahnte deshalb nur vage, was ihm entging. Er saß stumm da, bewegte die Gabel leicht über dem Teller. »Ich weiß nicht, Ma’am.«
Sie sagte ein Weilchen nichts, während er aß. Er fühlte sich unbehaglich, wusste, dass er eine gerunzelte Stirn vorfände, wenn er jetzt ihr Gesicht berühren würde.
»Hast du keine Vorstellung, wie die Welt so ist?«
Er legte die Gabel ab. »Oh doch, Ma’am.«
»Wie ist sie denn?«
Wieder begannen seine Gedanken zu arbeiten. »Ich kenn mich mit Gerüchen und Geräuschen und Formen aus, all so was halt. Aber es gibt ein paar Sachen, die ich nicht verstehe. Nach ein paar hab ich die Männer in der Band gefragt, aber die haben nur gelacht.«
»Ich lach dich nicht aus.« Er konnte sich nicht erinnern, jemals eine so sanfte Stimme gehört zu haben. Und obwohl man ihn schon oft verspottet oder sogar geschlagen hatte, wenn er Fragen stellte, beschloss er, es noch einmal zu riskieren. Befangen und unsicher war er allerdings trotzdem. »Na ja, Ma’am, es geht um die Unterschiede zwischen Menschen.«
»Du willst, dass ich dir etwas über Männer und Frauen erzähle?« Sie war verblüfft und amüsiert.
Es durchlief ihn heiß. Er wusste fast nichts über Sex, aber darum ging es ihm gerade nicht. Ihm war wohl klar, dass er sich diese Dinge von jemand anderem erklären lassen musste. »Nein, Ma’am, nicht das. Ich mein den Unterschied zwischen Farbigen und Weißen. Was ist damit?« Er wartete angespannt auf ihre Reaktion.
»Oh.« Sie war erschrocken. »Ja, ich weiß nicht …«
Er machte einen Rückzieher. »Schon gut, Missus Scott …«
»Jetzt wart mal, Junge. Ich werd’s versuchen, aber ich bin nicht grad ein kluger Kopf. Was weißt du denn schon?«
Er versuchte, das Wenige zusammenzukratzen, was er zu dem Thema wusste. »Im Heim gab’s einen Jungen, der hieß Vierauge – der hatte nämlich so ’ne richtig dicke Brille. Er konnte ein kleines bisschen sehen, wissen Sie. Und den haben wir immer gefragt. Er hat gesagt, der Direktor und Mister Gimpy wären weiß. Wir haben ihn gefragt, was das bedeutet, und er hat gesagt, es gäb zwei Sorten Leute, Weiße und Farbige, und die Farbigen hätten meistens braune Haut. Und wir wären alle farbig, denn die weißen blinden Jungs wären alle in einem anderen Heim, weil es gesetzlich nicht erlaubt ist, dass sie mit uns zusammen sind, weil sie besser sind als wir. Also haben wir gefragt, warum die besser sind als wir, und er hat gesagt, weil sie weiß sind. Also waren wir wieder da, wo wir angefangen hatten.« Er holte tief Luft. »Mir war auch aufgefallen, dass Mister Gimpy und der Direktor anders reden als wir. Also haben wir Vierauge gefragt, ob es am Weißsein liegt, dass sie anders reden, und er hat gesagt, irgendwie schon. Und dann hat er gesagt, die Weißen hätten fast immer glatte Haare und nicht so eine breite Nase. Aber es gab einen Jungen, der war in dem Bett neben meinem, den hab ich mal betastet, und der hatte glatte Haare und eine schmale Nase, wo man den spitzen Knochen drin gespürt hat. Wir haben Vierauge gefragt, ob der weiß ist, aber er hat gesagt, nein, der ist auch farbig, aber sehr hell. Also waren wir schon wieder da, wo wir angefangen hatten.« Er war außer Atem und zitterte, als er fertig war, aufgeregt und froh darüber, dass er das alles gesagt hatte.
Missus Scott saß ihm gegenüber am Tisch und atmete, sonst nichts. Hinter ihr kochte Wasser, und noch weiter weg, auf einer Straße viele Blocks entfernt, hupte ein Auto in den Nachmittag. Schließlich räusperte sie sich. »Also, wie gesagt, ich bin nicht grad ein kluger Kopf, aber ich denk mal, was dein Freund dir da gesagt hat, das stimmt alles, auch wenn manches davon sich widerspricht. Es gibt Farbige und Weiße. Und dass wer farbig ist, erkennt man meistens daran, dass die Leute eher braune Haut haben und meistens auch dicke Lippen oder wirre Haare oder ’ne platte Nase oder so.«
»Und was ist mit den weißen Farbigen?«
»Na, ich denk mal, die sind farbig, weil sie selbst sagen, dass sie es sind. Manche sagen auch, sie wären es nicht, und machen allen was vor.« Sie klang verbittert und fügte rasch hinzu: »Ich verurteil die nicht, so wie manche Leute. Auch wenn keiner so was laut sagt, aber man hat’s so schwer, wenn man farbig ist, dass ich vielleicht auch behaupten würde, dass ich nicht farbig bin, wenn Gott mir die Möglichkeit gegeben hätte. Aber ich bin nicht gerade ein Schneeball.«
»Ist es schlecht, farbig zu sein, Missus Scott?« Er fühlte sich nicht schlecht und fragte sich, ob er einfach nur dumm war.
»Die Weißen behaupten das, und ich denk mal, die meisten Farbigen glauben es auch.«
»Warum?«
»Na, ich denk mal, es ist ihnen so oft gesagt worden, dass sie es halt glauben.«
»Nein, das hab ich nicht gemeint. Warum behaupten die Weißen das?«
Sie zögerte, ehe sie antwortete. »Was Weiße denken, dazu kann ich dir absolut nichts sagen, Junge – nur zu dem, was sie tun!«
Sie schwiegen beide, und Ludlow versuchte, sich einen Reim auf all das zu machen, was sie ihm gesagt hatte. Am Ende war er nicht schlauer als zuvor. Aber er war dankbar. Sie hatte es versucht. Sie war einfach nicht klug genug, um mehr zu wissen als er. Aber eins wollte er sie noch fragen. »Missus Scott?«
»Ja, Ludlow.« Ihre Stimme war heiser.
»Missus Scott, darf ich Ihr Gesicht mal anfassen?«
Sie seufzte; ihr Stuhl scharrte um den Tisch herum über den Boden, stieß gegen seinen und blieb stehen. »Na komm, Junge.«
Er legte die Fingerspitzen dahin, wo die müde, heisere Stimme hergekommen war. Die Lippen waren so dick wie Finger, weich und fleischig. Darüber atmeten zwei riesige Löcher warme Luft. Nicht weit über ihnen ein flacher Nasenrücken zwischen zwei dicken Wölbungen. Die Stirn war breit und fühlte sich fettig an, und das Haar war so borstig wie Besenstroh.
Er hatte eine ungefähre Vorstellung, was sie auf die Frage, die er ihr gleich stellen wollte, antworten würde, und ahnte, dass sie womöglich gekränkt sein könnte, aber es war das erste Mal, dass sich die Gelegenheit bot, das zu fragen, und womöglich auch das letzte Mal. Er musste es tun. »Missus Scott, finden die Weißen Sie hässlich?« Er ließ die Finger neben ihrem Mund liegen, damit er die Antwort spüren konnte.
»Ja.«
»Dann bin ich auch hässlich.«
»Ja, du bist auch hässlich.« Sie hielt inne, dann lachte sie in sich hinein, aber um ihren Mund war alles ganz fest. »Manchmal glaub ich, dass die Weißen sogar die Schönsten von uns hässlich finden.«
Er nickte und nahm die Hand weg. Er wusste nicht, wohin damit, also griff er nach der Gabel und aß weiter.