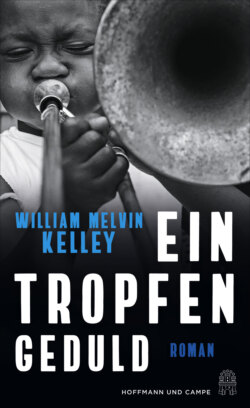Читать книгу Ein Tropfen Geduld - William Melvin Kelley - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеEs war zu still im Haus. Seine kleine Schwester hätte krähend durch den Flur rennen sollen, hinter dem Haus hätte sein Bruder mit einem Stock Steine durch die Gegend schlagen sollen, seine Mutter hätte singen sollen. Wenigstens das kurze, harte Zischen ihres Besens hätte zu hören sein sollen. Doch das Haus war so still, dass das Tropfen der Wasserpumpe in der Küche klang, als würden Steine in einen Teich plumpsen.
So still war es im Haus noch nie gewesen – dabei war es in den vergangenen paar Tagen lauter gewesen als je zuvor. Sein Vater hatte schwere Sachen aus dem Haus getragen und war mit leichterem Schritt zurückgekehrt, hatte die Last irgendwo abgeladen. Seine Mutter hatte mehrmals geweint. Heute Morgen hatte er den Eindruck gehabt, dass alle auf Zehenspitzen um ihn herumschlichen, flüsternd, und dann hatten sie das Haus verlassen und waren weggegangen. Möglicherweise hatte seine Mutter ihn geküsst. Sicher war er sich da allerdings nicht. Er konnte nicht immer unterscheiden, ob er wach war oder träumte.
Aber jetzt war er ganz bestimmt wach. Er spürte es. Er lag auf dem Rücken, fuhr mit den Händen über die Garnknubbel, die seiner Mutter zufolge das Bett zusammenhielten. Einmal war er unter das Bett gekrochen, ein staubiger Hohlraum, und hatte die kalten Sprungfedern angefasst. Er begriff nicht, wie diese weichen Garnknubbel das Bett zusammenhalten konnten.
Schließlich setzte er sich auf, schwang die Beine auf den splittrigen Holzboden und bückte sich nach seiner Latzhose. Als er sie gefunden hatte, auf der Unterseite war sie noch feucht von der Nacht, schlüpfte er hinein und stand auf. Vielleicht waren die anderen ja auf der Veranda.
Er tastete sich rasch durch den Flur. Die Wände waren an verschiedenen Stellen abgestoßen und zerschrammt, seine Lieblingsschramme hatte die Form einer Hand, der ein Finger fehlte. Unter dem Putz waren Holzbalken.
Die winzigen Drahtquadrate der Fliegentür waren heiß. Er drückte die Tür auf, sodass die Scharnierfeder knackte und quietschte. Sein Gesicht und sein Oberkörper, nackt bis auf Latz und Träger seiner Hose, begannen auf der Veranda schon nach kurzer Zeit zu glühen. Es war später Vormittag, die Hitze kam von hoch oben. Auf der Veranda atmete niemand.
Er stand lange in der Hitze und wartete darauf, dass jemand ihn holte. Zu seinen Freunden (die offenbar im kühlen Wald hinter dem Haus spielten) konnte er nicht gehen, denn er wollte nicht fort sein, wenn seine Eltern wiederkamen. Schließlich tastete er sich mit nackten Füßen zum Rand der Veranda vor, setzte sich hin und ließ die Beine baumeln. Hohes hartes Gras wuchs vor der Veranda und kitzelte ihn an den Füßen.
Als die Hitze direkt auf seinen Scheitel brannte, kam jemand. Er hatte sich gerade die Hand aufs Haar gelegt und festgestellt, dass die winzigen Löckchen und Schweißperlen glutheiß waren, da begannen auf der unbefestigten Straße, die vor der Veranda vorbeiführte, Steinchen zu spritzen. Jemand näherte sich in eiligem Gang. Er erkannte die Schritte, die am Anfang des Gartenwegs anhielten. »Papa?«
»Komm, Luddy. Komm, mein Sohn.« Sein Vater bewegte sich auf ihn zu, zog die Füße in den schweren Schuhen nach. Ludlow roch Staub in der Luft. Die Hand seines Vaters nahm seine, hob sie an, und Ludlow sprang auf die Füße. Sein Vater führte ihn zur Straße. Sie bogen nach rechts. Der Staub auf der Straße war so pudrig und trocken, dass er sich anfühlte wie heißes Wasser. Ludlow beklagte sich, und sein Vater nahm ihn auf den Arm, der unter Ludlows Oberschenkeln wie ein Sitz war. Ludlow schlang den Arm um den Hals seines Vaters. Bartstoppeln pieksten in seine Fingerspitzen. Er fragte sich, wo er wohl gerade hingetragen wurde, ob sein Bruder, seine Schwester und seine Mutter ihn dort erwarteten. Der Untergrund war jetzt hart; Ludlow spürte die Stöße durch den Körper seines Vaters. Sie gingen auf Pflaster. Ein Auto tuckerte vorbei und blies ihm warme Luft ins Gesicht. Sie waren auf einer Landstraße, aber es musste eine andere sein als die, zu der sein Bruder ihn immer geführt hatte; er und sein Vater waren in die entgegengesetzte Richtung gegangen.
Sein Vater marschierte jetzt mit gleichmäßigem, schwerem Schritt. Ludlow wippte auf seinem Arm. Unter den Füßen seines Vaters knirschten kleine Steinchen. Autos kamen ihnen entgegen, ein Blubbern, und sausten vorbei.
Sie verließen die Landstraße. Nicht weit von ihnen pfiffen und schnatterten Vögel in den Bäumen. Wieder gepflasterter Boden, dann eine Treppe. Sein Vater lehnte sich gegen eine schwere Tür, trug ihn aus der Hitze. Ludlows nackte Arme wurden kalt. In der Ferne, in einem langen, hallenden Raum, redeten Kinder.
Sein Vater setzte ihn ab, hielt ihn aber an der Hand. Der glatte Steinboden ließ ihn frösteln. Ein Stuhl wurde verschoben, quietschte, hinkende Schritte entfernten sich. Kurz darauf kamen sie zurückgehinkt, von anderen Schritten begleitet.
Ludlow roch Zigarrenrauch.
»Ist er das?«
»Ja, Herr Direktor. Das ist er. Luddy. Ludlow Washington, Sir.« Sein Vater drückte seine Hand.
»Sieht älter aus als fünf.« Der Zigarrenrauch drang in seine Nase.
»Er ist fünf, Sir.« Sein Vater hatte Angst, zum allerersten Mal. »Ich schwör’s.«
»Egal.« Er hielt inne. »Sie können Ihren Namen schreiben, oder?«
Sein Vater ließ seine Hand los. »Ja, Sir.«
»Na gut, dann sagen Sie ihm, dass er sich setzen soll. Mein Gehilfe kümmert sich um ihn. Wir brauchen ein paar Unterschriften von Ihnen.« Der Gehilfe des Direktors kam auf ihn zugehinkt, packte seinen Arm, riss ihn nach vorn. »Setz dich da hin, und keinen Mucks.« Ludlow wurde herumgewirbelt und auf eine hölzerne Sitzfläche gedrückt. Er fuhr mit den Händen darüber und stellte fest, dass es eine Bank war, mit Lehnen an beiden Seiten.
»Was machst du da?« Der Gehilfe war jetzt etwas weiter weg. »Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich nicht rühren!«
Ludlow saß stocksteif da, die Handflächen auf die Bank gedrückt. Wenig später scharrte der Stuhl des Gehilfen über den Boden, und seine Schritte verschwanden hinter dem fernen Geräusch der Kinder. Ludlow blieb wie angewurzelt sitzen. Das war vielleicht ein Trick, so wie er ihn von seinem Bruder kannte: Der sagte manchmal, er gehe kurz weg, Ludlow solle auf ihn warten. Ludlow verfolgte dann, wie sich die Schritte seines Bruders entfernten, bis er sich sicher sein konnte, dass sein Bruder fort war. Erst dann bewegte er sich, und sofort schrie sein Bruder ganz nah bei ihm, denn er hatte sich heimlich wieder zurückgeschlichen. Wenn sein Bruder das machte, lachten sie darüber. Aber der Gehilfe des Direktors spielte nicht, das wusste Ludlow.
Er saß still da und versuchte zu erkennen, wo er war und warum er und sein Vater hierhergekommen waren. Irgendwas in der Luft stach ihm in der Nase. Draußen war Sommer, aber hier drinnen war es kühl und feucht. Es musste ein großes Gebäude sein, denn wenn jemand etwas sagte, hallte es. In der Ferne redeten immer noch die Kinder. Er wusste, dass er hier noch nie gewesen war. Er wollte weg.
Ein bisschen hatte er jetzt Angst, und er versuchte sich aufzumuntern, indem er am Daumen lutschte und ein Lied summte, das seine Mutter ihm beigebracht hatte.
»Wer summt da?« Die Stimme war heiser und klang feucht, so wie wenn sein Bruder versuchte, mit Wasser im Mund zu flüstern. Bevor er antworten konnte, huschten zwei Hände über sein Gesicht, befingerten seine Nase, seine Augenhöhlen, seinen Mund, dann wanderten sie zu den Ohren, den Seiten des Kopfes. Schließlich fuhren sie ihm übers Haar und blieben dort liegen. »Ich kenn dich nicht.« Die wässrige Stimme war verwirrt. »Was machst du hier?«
»Weiß ich nicht.« Auch Ludlow war verwirrt. Noch nie war er jemandem begegnet, der genau das tat, was auch er mit einer unbekannten Person oder Sache getan hätte.
»Du weißt es nicht? Tja, ich schon, glaub ich. Hast du Geld?«
»Nein.«
»Wie heißt du?« Die Hände glitten jetzt auf seine Schultern und dann die Seiten hinab.
»Ludlow Washington.«
Die Hände durchsuchten seine Taschen. »Wie alt?«
Er zögerte. »Fünf.«
»Ich bin sechs.« Die Hände ließen von ihm ab. »Du kommst auf mein Stockwerk, das dritte. Kannst du gut Stimmen wiedererkennen?« Ludlow nickte. »Meine solltest du dir jedenfalls merken, denn du bist ab jetzt mein Sklave. Ich bin dein Herr.«
»Was?« Er begriff nicht, wovon der Junge redete.
Die Hand des Jungen berührte seine Nase, fuhr seitlich über sein Gesicht, packte sein Ohr und verdrehte es schmerzhaft. »Ich hab gesagt, ich bin dein Herr.«
»Mein Herr?« Tränen kitzelten auf Ludlows Wangen, aber er versuchte, lautlos zu weinen.
»Ich bin dein Herr. Das heißt, du gehörst mir, und wenn dich jemand was fragt, sagst du, er soll mich fragen, denn ich bin dein Herr, und ich antworte für dich. Das gilt für alle außer dem Direktor und Mister Gimpy. Für alle Jungs hier.«
Ludlow war überzeugt, dass er nicht mehr lange hier sein würde, aber er beschloss, das Spiel des Jungen mitzuspielen. »Hast du –«
Der Junge schlug ihm ins Gesicht. »Nenn mich Herr, wenn du mit mir redest.«
Ludlow seufzte. »Herr, hast du selbst auch einen Herrn?«
Der Junge verdrehte ihm wieder das Ohr, ehe er antwortete. »Dummer Sklave! Natürlich hab ich einen Herrn. Wir haben alle einen. Unser Leben lang.« Seine Hand ließ Ludlows Ohr los. »Wir sprechen uns oben. Und denk dran, dass ich dein Herr bin.«
»Was macht ihr da?« Der Gehilfe des Direktors schrie aus hallender Ferne zu ihnen herüber. Während die Worte verklangen, näherten sich eilig seine hinkenden Schritte.
»Nichts, Sir. Ich hab mich nur mit dem Neuen angefreundet.« Der Junge war jetzt sehr höflich.
»Weg von ihm, sofort.«
»Ja, Sir. Ich wollte gerade gehen, Sir. Mach’s gut, Ludlow. War nett, mit dir zu reden.« Der Junge ging mit weichen, schnellen Schritten davon.
»Hab ich dir nicht gesagt, dass du stillsitzen sollst?« Die Stimme des Gehilfen war jetzt über ihm. »Wart nur ab, bis die Papiere unterschrieben sind – dich werd ich Mores lehren!« Nicht mal sein Vater hatte je so wütend geklungen. Er fragte sich, was passieren würde, wenn die Papiere unterschrieben waren.
Der Gehilfe zog sich zurück. Es war jetzt ruhig, und Ludlow lauschte nach den Kindern. Ihre Stimmen waren schrill. Er fühlte sich einsam. Sein Magen war durcheinander. Er hoffte, sein Vater würde bald zurückkommen und ihn in die Hitze hinausbringen, zu den Vogelrufen und dem Geruch nach heißem Teer und Gras.
Die Stimme des Direktors näherte sich. »Und vergessen Sie nicht, Sie haben kein Beschwerderecht mehr. Sie haben ihn uns offiziell überantwortet, und er wird bei uns lernen, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber wir sind kein Kindergarten, wir sind eine Schule.«
»Ich mach keinen Ärger, Sir. Ich bin dankbar, dass Sie ihn nehmen.« Sein Vater war jetzt froher.
Ludlow wusste nicht, ob er aufstehen sollte. Er blieb, wo er war. Die beiden Männer standen vor ihm. Die Stimme seines Vaters war höher über ihm, weiter von seinen Ohren entfernt als die des Direktors. »Wenn Sie wollen, sag ich es ihm.«
»Nur zu. Dann müssen wir es nicht tun.«
Die Bank bog sich durch, als sein Vater sich neben ihn setzte. »Luddy, ich muss dir was sagen.« Dann folgte ein langes Schweigen. Ludlow streckte die Hand aus und fand den Arm seines Vaters, der schwitzte. »Du bist nicht so wie die meisten Kinder … du bist … besonders, ja, das ist es, du bist besonders. Und ich muss dich hierlassen, damit du besondere Dinge lernen kannst …«
Er nahm nicht wirklich wahr, was sein Vater sonst noch zu ihm sagte. Er wandte sich nach oben zur Stimme seines Vaters, und ihm wurde klar, dass der Junge und der Gehilfe des Direktors es schon die ganze Zeit gewusst hatten. Er würde hierbleiben. Ja er wusste sogar, dass er sehr lange hierbleiben würde. Er hatte keine Ahnung, wo er war und wie weit weg er war, aber er würde nicht allein nach Hause finden. Er fing an zu weinen.
Sein Vater stand jetzt wieder, eine Hand auf Ludlows Kopf, sodass sein drahtiges Haar raschelte. »Viel Glück, Luddy.« Die Hand war weg.
Der Direktor und seine Zigarre kamen wieder in seine Nähe. »Das sollte genügen.« Der Stuhl des Gehilfen ächzte, und im nächsten Moment wurde Ludlow am Arm gepackt. Er versuchte sich loszureißen, doch es gelang ihm nicht.
»Sie gehen jetzt besser.« Der Direktor war verärgert.
»Ja, Sir.« Die Stimme seines Vaters drang zu ihm. »Viel Glück, Luddy.« Schwere Schuhe entfernten sich hallend, trafen auf das Seufzen einer sich öffnenden und wieder schließenden Tür. Ludlow fing an, mit seinen nackten Füßen auf den Gehilfen einzutreten, und empfing eine schallende, schmerzhafte Ohrfeige.
»Dritter Stock«, rief der Direktor.
Als der Schock der Ohrfeige nachließ, fing Ludlow an, nach seinem Vater zu rufen.
»Und bring ihn zum Schweigen, Herrgott noch mal!«
Ludlow wurde hochgehoben, immer noch strampelnd und schreiend. Er wurde über den Steinboden getragen, hoch über dem Klacken des Hinkeschritts, dann wieder auf den Boden hinuntergelassen und ohne Vorwarnung geohrfeigt, häufiger, als er zählen konnte. Er hörte auf zu weinen und begann zu wimmern. »Hast du dich jetzt beruhigt, du kleiner Scheißer?«
Der Gehilfe des Direktors packte ihn am Handgelenk und schleifte ihn drei hölzerne Treppen hinauf. Als sie den obersten Treppenabsatz erreichten, war Ludlows Hand taub. Ein Türknauf knarrte, und er wurde über eine Schwelle in einen Raum voller Kinder gestoßen. Der Gehilfe war hinter ihm, hielt ihn am Nacken fest. »He!« Die Stimmen verstummten. »Das hier ist Ludlow Washington.« Seine Stimme wandte sich nach rechts. »Du da! Vierauge! Du bist dafür zuständig, dass sein Bett gelüftet wird, wenn er reinpisst. Wenn es nicht gelüftet wird, schläfst du selbst drin.«
»Ja, Sir.« Ludlow erkannte die Stimme nicht.
Der Gehilfe ließ ihn los und knallte die Tür zu. Ludlow stand völlig reglos da und wartete darauf, dass das Stimmengewirr wieder losging. Scharrende Schritte näherten sich von allen Seiten, Flüstern. Dann fingen sie an, ihn zu betatschen. Ihre Hände fuhren über seinen ganzen Körper, besonders über Gesicht und Kopf.
»Der hat ja Ohren wie Schüsseln.«
»Und einen Riesenkopf!«
»Muss ein hässlicher kleiner Scheißer sein.«
»Moment. Lasst mich mal ran.« Alle Hände ließen von ihm ab, bis auf eine. »Das ist er. Ich hab ihn als Erster entdeckt, unten. Das hab ich euch ja erzählt.« Es war Ludlows Herr. Fast war er froh, die wässrige Stimme zu erkennen. »Ludlow Washington?«
»Ja.«
»Ja, Herr.« Sein Herr verdrehte ihm das Ohr. Ludlow war kurz davor, in Tränen auszubrechen, beschloss dann aber, es bleiben zu lassen. Es würde ihm nichts nützen, also blieb er stumm.
»Ludlow Washington, du bist mein Sklave. Habt ihr das gehört, ihr andern? Das ist mein Sklave. Stimmt’s, Sklave?« Er spürte den Atem seines Herrn auf seinem Gesicht. »Sag es.«
Ludlow erschauerte. »Ich bin dein Sklave.«
Damit er das auch nie vergessen würde, verdrehte ihm sein Herr ein letztes Mal das Ohr.