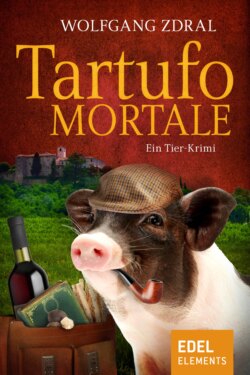Читать книгу Tartufo mortale - Wolfgang Zdral - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеAngefangen hatte alles mit einem Anruf vor zwei Wochen. Ich erinnere mich noch genau daran, weil ich gerade in meinem Zimmer zum ersten Mal Cipolle al forno gegessen hatte, gebackene Zwiebeln mit einer ungewöhnlichen Soße aus Sahne und Aalstücken, und mich zu einem Nickerchen aufs Sofa zurückgezogen hatte. Das Klingeln des Telefons und Eleonoras Stimme rissen mich aus meinen Träumen. Wie ich dem Gespräch entnahm, war ihre Freundin aus Perugia dran. Eine alte Kollegin aus gemeinsamen Studienzeiten in Mailand. Die Fächer Geschichte und Kunstgeschichte hatten beide wohl eher als Nebensache betrachtet, wenn ich Eleonoras Erzählungen von früher Glauben schenken sollte. Stattdessen feiern, ausgehen und mit Studenten flirten. Die Freundin arbeitete mittlerweile in der Touristeninformation der umbrischen Provinzhauptstadt und hatte eine seltsame Anfrage erhalten: Der Vorsteher eines Klosters rief an, ob sie jemanden kenne, der vorübergehend eine historische Forschungsarbeit übernehmen könnte. Das Kloster betreute die Studienkollegin erst seit wenigen Tagen, »wir haben es ganz neu in unser Retreatprogramm ›Klösterliche Stille‹ aufgenommen, ein kleines, abgelegenes Kloster, noch nicht vom Tourismus verdorben – ein Geheimtipp!«, schallte es aus dem Telefon.
»Da habe ich natürlich sofort an dich gedacht, Eleonora«, sagte die Anruferin. »Wo du doch auf deinem Bauernhof einsam in der Provinz hockst und den ganzen Tag nur Misthaufen siehst.« Gelächter, verzerrt durch den Lautsprecher. »Vielleicht hast du Lust, wieder deinem alten Beruf nachzugehen und dir mal andere Luft um die Nase wehen zu lassen. Hier bei uns ist es viel schöner als im Piemont.«
Ich konnte mir ein empörtes Schnaufen nicht verkneifen, denn was konnte schöner sein als die vertraute Umgebung des Piemont, meine Freundin Cleopatra in der Nähe und eine Padrona, die immer für gutes Essen und Barolo-Wein sorgte? Wir hatten in jüngster Vergangenheit einiges durchgemacht: Eleonoras Schwiegervater war auf unserem Bauernhof südlich von Alba ermordet worden. Die Haushälterin ebenso. Auch der Ehemann war ums Leben gekommen. Immerhin konnten wir die Verbrechen aufklären. Nicht zuletzt dank meiner Freundin Cleopatra, einer Sau von Format und adeliger Abstammung obendrein, und meines Trüffellehrlings Caruso. Eleonora hatte daraufhin das Anwesen und die Ländereien geerbt. Dort hätten wir uns eigentlich vergnügen sollen, Tartufi aufspüren, Essen kochen, Barolo trinken. Ich selbst bin leider noch nie über die Grenzen unserer Region hinausgekommen. Meine Vorfahren dagegen hatten in den östlichen Gegenden Italiens gelebt, meine verehrte Ururoma Lucrezia ebenso wie meine Tante in Verona. Ein wenig von dem östlichen Erbe floss sicher auch durch meine Adern. Jedenfalls setzte sich Eleonora am nächsten Tag ins Auto und fuhr nach Umbrien. Sie übernachtete in Perugia und traf sich dort mit dem Abt des Klosters. Nach ihrer Rückkehr setzte sie sich mit ihrem neuen Freund Enrico Fabris auf die Bank vor unserem Haus und ließ sich von der Abendsonne bescheinen.
»Wie war’s?«, fragte Fabris, der erst kürzlich bei uns eingezogen war. Ein Commissario der Mordkommission aus Turin, hatte er Eleonora bei seiner Ermittlungsarbeit auf dem Hof kennen gelernt. Nachdem die Mordfälle aufgeklärt waren, kam der junge Mann zu Besuch. Erst einmal, dann regelmäßig. Und nun war eingetroffen, was ich bereits seit Längerem befürchtet hatte: Seit einem Monat wohnte er ganz auf dem Anwesen der Gobettis, hatte seinen Dienst »bis auf Weiteres« quittiert und konzentrierte sich nun ausschließlich auf die Verwaltung der Ländereien. Eigentlich mochte ich keine Kommissare, denn sie waren alle gleich – eingebildet und in Schubladen denkend, ohne die Kombinationsgabe und dem Esprit der Schweine. Fabris jedoch hatte sich bisher noch keine Schnitzer erlaubt. Nun ja, vielleicht war er ja im Herzen Bauer und nicht Polizist. Den Stall jedenfalls mistete er schon wie ein echter Landwirt aus.
Eleonora verschränkte die Arme hinter dem Kopf. »Ich könnte wieder als Historikerin arbeiten. Wenn auch nur für ein paar Wochen. Und ohne Bezahlung.«
»Kein Honorar? Das ist aber ein seltsames Angebot«, erwiderte Fabris.
»Der Auftraggeber ist ein Kloster. Wie mir Abt Aviano geschildert hat, leidet die Abtei unter, nun ja, Geldmangel. Sie ist klamm, um nicht zu sagen pleite. Die haben ihr letztes Geld in den Umbau des Anwesens gesteckt, um daraus eine Edelherberge für Gäste zu machen. Für Leute, die eine Zeit lang exklusive Abgeschiedenheit und Ruhe suchen. Und so hat schließlich meine Freundin in der Touristeninformation von dem Kloster erfahren.«
»Was hat das mit dir und dem Job zu tun?«
»Der Abt will das Kloster herausputzen. Bislang ist es für Touristen nicht zugänglich, man kann es nicht besichtigen. Das soll sich nun alles ändern. Um besser Reklame machen zu können, will er die Geschichte der Anlage erforschen lassen. Meine Aufgabe wäre es, irgendetwas Aufregendes in der Vergangenheit zu entdecken, was sich gut vermarkten ließe, eine Art historisches Aushängeschild für die Abtei.«
»Und all das für Gottes Lohn?« Fabris kam mit einer Flasche Rotwein und zwei Gläsern aus dem Haus zurück. Er grinste. »Habe gar nicht gewusst, dass du deine Sünden mit einem Ablasshandel wegwaschen willst.«
»Unterkunft, Verpflegung und andere Ausgaben wären natürlich frei.« Eleonora schwenkte den Wein in ihrem Glas. »Die Aufgabe ist nicht ohne. Das erste Mal die Geschichte des Klosters erforschen. Ich habe mich in Perugia schlau gemacht, es finden sich nur wenige dürre Fakten, sonst nichts. Kein Buch, keine längere Abhandlung. Ich würde absolutes Neuland betreten. Vielleicht springt ja sogar eine Publikation in einer wissenschaftlichen Zeitschrift dabei heraus. Und ich könnte endlich einmal auf dem Gebiet arbeiten, das ich studiert habe.«
Fabris nahm die Padrona in den Arm. »Geht dir wohl ab, das frühere Leben. Immer nur Landwirtschaft und Trüffel suchen. Andere wären froh, wenn sie mit dir tauschen könnten.«
»Das ist es nicht. Ich liebe den Hof hier. Aber auch ich habe das Bedürfnis nach Abwechslung. Mal was anderes sehen. Das Angebot klingt nach Urlaub – und als Gegenleistung darf ich Bücher und Urkunden wälzen.«
»Wenn du dich mal nicht täuschst.«
»So schlimm wird’s schon nicht werden. Ich bin zu nichts verpflichtet.« Eleonora nahm einen Schluck aus dem Glas. »Außerdem gibt es noch einen anderen Aspekt, der mir die Sache schmackhaft macht.«
»Ich habe doch gewusst, dass irgendwo ein Haken steckt«, sagte Fabris. »Lass mich raten: Du musst dich als Nonne verkleiden.«
»Viel besser. Ich darf meine beiden Trüffelschweine mitnehmen.«
»Unsere Trifolai? Was sollen die in einem Kloster? Soll das heißen, du willst mich hier allein zurücklassen?«
Eleonora knuffte den Arm ihres Freundes. »Du bist nicht allein. Du hast doch die Nachbarn. Und unsere Viecher im Stall.«
»Soll ich mich zu denen ins Heu legen, während du fort bist? Schöne Aussichten.«
»Ich brauche mein Porcellino dort. Beruflich sozusagen.«
»Du verbringst eh schon viel zu viel Zeit mit dem Eber und seinem jungen Begleiter. Es reicht schon, dass die Schweine mit uns im Haus wohnen.«
»Es sind besondere Schweine, das weißt du doch. Sie sorgen dafür, dass wir von der Trüffelsuche gut leben können. Außerdem brauchst du nicht auf ein Schwein eifersüchtig zu sein.«
Fabris tat zerknirscht. »Ich habe den Eindruck, du bringst dem Tier mehr Zuneigung entgegen als mir, nimmst sogar lieber ein Schwein in den Urlaub mit als mich.«
Eleonora lachte. »Den Urlaub holen wir nach, nur wir beide. Versprochen. Aber Abt Aviano hat angedeutet, dass die Geschichte des Klosters mit einer Legende verwoben ist.«
»Welche Geheimnisse plagen denn den Geistlichen?«
»Er will, dass ich den Goldenen Trüffel finde.«
Fabris blieb der Mund offen stehen. »Willst du mich auf den Arm nehmen? Das klingt verdammt nach Märchenstunde.«
»Das dachte ich zuerst auch. Aber bei dem Goldenen Trüffel handelt es sich tatsächlich um eine Legende, die sich seit Jahrhunderten um das Kloster rankt. Der Abt weiß nicht, ob diese Geschichte wahr ist, ob es überhaupt einen Goldenen Trüffel gibt und was er darstellen könnte. Es kann ein Schmuckstück sein, eine Pflanze, ein Gemälde, ein verschollenes Buch. Oder etwas Geistiges, ein Symbol wie der Heilige Gral, eine Idee, ein alchemistisches Rezept, ein religiöses Ritual. Ich weiß es nicht, der Abt weiß es nicht. Er aber will herausfinden, was dahintersteckt und was es mit der spezifischen Klosterhistorie zu tun hat. Und wenn das sagenhafte Ding noch etwas wert sein sollte, umso besser. Bei den leeren Kassen ...« Eleonora gluckste.
»Der arme Abt steckt sicher in der Zwickmühle. Ein Kloster ist ein Ort der Besinnung und keine Herberge. Als zusätzliches Marketingargument klingt Goldener Trüffel, wie soll ich sagen, betörend. Wer Kunden anlocken will, muss eben die Trommel rühren und darf nicht nur auf Gottes Wort vertrauen.«
»Jedenfalls hat ihn mein Hinweis überzeugt, es könne nicht schaden, meine beiden Trüffelschweine mitzunehmen. Wer weiß, vielleicht finden sie die entscheidende Spur. Wäre ja nicht das erste Mal.«
Bislang hatte ich dem Gespräch nur mit halbem Ohr zugehört. Aber der Begriff »Goldener Trüffel« elektrisierte mich. Nicht nur wegen meiner Leidenschaft für die Pilze, dem fürwahr göttlichsten Lebensmittel auf Erden. Bilder aus meiner Kindheit stiegen hoch, längst vergessene, und mit ihnen die Erinnerung an die Sage von meiner Ururgroßmutter Lucrezia und dem Goldenen Trüffel. Meine Mutter Penelope hatte sie mir oft als Gutenachtgeschichte erzählt. Es handelte sich um eine uralte Schweinesage, von Generation zu Generation weitergereicht. Danach sollte Lucrezia, die Weise, einst den legendären Trüffel entdeckt und damit den Grundstock für den Ruhm unserer Familie als Tartufo-Dynastie gelegt haben. Ein Ruhm, von dem ich heute noch zehrte, denn das Blut Lucrezias pochte auch in meinen Adern, und kein Mitglied unserer Familie ist je über die Jahrhunderte hinweg in solchen Ehren gehalten worden wie diese wunderbar weise Sau. Ich verdankte ihr unendlich viel, meine Fähigkeiten, meine Existenz, meine Bildung – ihre Anlagen, gepflanzt vor Jahrhunderten, machten einen Teil meines Wesens aus, auch wenn ich keinerlei Vorstellung hatte, wer meine Ururoma tatsächlich gewesen war, wie sie ausgesehen hatte. Eleonoras und Fabris’ Unterhaltung reduzierte sich auf ein säuselndes Hintergrundgeräusch, denn meine Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf ein mir bislang vollkommen unbekanntes Gefühl, eine bittere Trauer darüber, meine Ururoma nicht gekannt zu haben. Vermessen und undankbar kam ich mir vor, mit meiner tagtäglichen Arbeit Lorbeeren einzuheimsen, die eigentlich ihr gebührten. War ich ein schlechtes Schwein, dass mir in all den Jahren, die ich bereits auf dieser Erde lebte, nicht einmal der Gedanke gekommen war, der Gründerin unserer Familientradition Dankbarkeit zu erweisen? Geschweige denn mich zu fragen, wie sie gelebt hatte, wie sie gestorben war? Denn ihr Tod musste hohe Wellen geschlagen haben und war bis heute ein großes Rätsel.
Lucrezias Entdeckung habe den Menschen über Jahrhunderte hinweg Glück und Wohlstand beschert, hieß es. Doch es ist nicht überliefert, was genau sie entdeckt hatte. Ruhm erntete sie bei den Menschen nicht – im Gegenteil. Gerüchte besagten, auf dem Goldenen Trüffel habe ein Fluch gelegen, der Tartufo habe letztlich ihren gewaltsamen Tod herbeigeführt – dort in Umbrien, wo sich ihre Spur verlor. Ihr Geheimnis hat sie mit ins Grab genommen, ihre letzte Ruhestätte ist bis heute unbekannt. Die Geschichte des Goldenen Trüffels geriet schließlich mit den Jahrhunderten immer mehr in Vergessenheit. Was blieb, war die Erinnerung in meiner Familie an Lucrezia, mehr ein Gedanke, ein abstraktes Wortgemälde in Form einer Sage, das die wahre Gestalt verbarg. Sollte Eleonoras Vorhaben tatsächlich Gestalt annehmen und ich einen Urlaub in Umbrien verbringen – ich schrieb mir fest hinter die Ohren, für meine geschätzte Ahnin vor Ort zumindest eine Gedenkminute einzulegen.
Die nächsten Tage nahm Eleonora ihr Projekt zielstrebig in Angriff. Sie fuhr nach Mailand, um Bücher zu besorgen, erstellte Listen mit Dingen, die sie mitnehmen wollte, packte mehrere Koffer und ging dabei mit einer Energie zur Sache, die ich schon lange nicht mehr an ihr bemerkt hatte. Schließlich kam der Tag der Abreise, auch dieser viel früher als ich gedacht hätte. Ich fand gerade noch genug Zeit, mich von meiner Freundin Cleopatra zu verabschieden, einer blaublütigen Gascon-Sau aus der Nachbarschaft, eine Contessa de la Rosa, ursprünglich französischer Adel. Ich rieb meinen Rüssel zärtlich an ihrer Backe, sog den Duft von Klee und Minze ein, labte mich an ihren Wohlgerüchen. Sie guckte mich an, als habe sie gerade ein Pfund Limonen zerkaut.
»Jetzt bist du so lieb zu mir und gleich haust du ab, mon cher«, sagte sie. »Schöner Freund! Mich sitzen lassen. Pah!« Sie drehte sich demonstrativ weg.
»Ich werde jede Minute an dich denken«, flüsterte ich ihr ins Ohr, getrieben von einer Prise Schuldbewusstsein. »Was soll ich machen? Job ist Job. Ich kann Eleonora nicht im Stich lassen. Und ich muss sagen, meine liebe Ururoma Lucrezia schafft es mittlerweile schon in meine Träume, und ich freue mich darauf, mit Umbrien den Flecken Erde kennenzulernen, den ich aus den Sagen meiner Kindheit kenne. Du kennst mich doch, weißt, wie viel ich mir auf meine Familie einbilde, und solch eine Gelegenheit bekomme ich nie wieder in meinem Leben. Und wer weiß, nachdem Eleonora nun eh auf den Goldenen Trüffel angesetzt ist, vielleicht kann ich da mit meiner Spürnase auch meinen Teil dazu beitragen und einen Funken mehr Wahrheit in meine Ahnengeschichte bringen. Denn es soll mich der Teufel holen, wenn die mysteriöse Saga um Lucrezia nur erfunden ist. Schweine flunkern nicht.«
»Das verstehe ich ja. Doch wo bleibe ich?«
»Es dauert nicht lange. Höchstens ein paar Wochen. Wenn du Fabris regelmäßig besuchst, kannst du Neuigkeiten von uns aus Umbrien aufschnappen.«
»Très bien. Ein toller Ersatz.«
»Wenn ich zurück bin, feiern wir. Und zwar richtig. Versprochen.« Es verging noch eine halbe Stunde, bis Cleopatra ihren Groll überwunden hatte. Ich bedauerte, dass ich sie nicht mitnehmen konnte. Meine Freundin. Mein Schoko-Bacio.
Die Reise erinnerte mich an eine Kanzone der berühmten Sängerin Albavella Buffa, der vielleicht beliebtesten Sau unter den Mezzosopranistinnen, deren Lieder bildreich und sinnenfroh waren – und wunderbar melodisch! Caruso, mein Trüffellehrling, ein Mangaliza-Schwein, summte Opernarien, während wir auf der Ladefläche des Lieferwagens dahinschaukelten, dem ersten richtigen Urlaub unseres Lebens. Ein erhabenes Gefühl.
Von Alba aus nahmen wir die Autobahn, fuhren weiter bis Modena, bogen ab nach Süden auf die Autostrada del Sole, nahmen die Superstrada nördlich des Lago Trasimeno bis Perugia und legten den Rest der Strecke auf Landstraßen zurück. Ebenen lösten sich mit Tälern ab, Hügel mit Bergen, kahle Gipfel erinnerten an die kreisrund geschorenen Glatzen von Mönchen, getaucht in die Wärme der Sonne. Auf den Kuppen der Hügel drängten sich die Häuser zusammen als suchten sie in der Gemeinschaft Schutz vor dem Nachbardorf. Die Landschaft wechselte in kurzen Intervallen ihr Kleid und schien doch nur eine Farbe zu kennen: Grün. Das kräftige Grün der Maisbeete entlang der Wege, das Grünbraun des Getreidefelds, das bei einem Bauernhof auslief, der Silberschleier auf dem Grün der Olivenbäume, der Hänge von Ferne als gleichmäßige Stickerei der Natur glänzen ließ. Die samtgrünen Reihen der Weinstöcke, die sich den Berg hinaufzogen, den Senken und Plateaus folgten, und das Schwarzgrün des Bergwalds, das sich in ein Grünblau wandelte je weiter die Berge in die Ferne rückten, um am Horizont zu einer mit Wasserfarben gemalten Linie von zartem Blau zu verschmelzen.
Das Tal verengte sich. Eleonora bog ab, eine Serpentinenstraße führte bergauf, der Asphalt schlängelte sich vorbei an Geröllhängen und Buschwerk. Längst hatten wir das letzte Dorf hinter uns gelassen. Die Straße mündete in einen Feldweg, Schlaglöcher schüttelten das Auto wie ein Boot bei rauer See. Plötzlich bremste Eleonora und wir schlitterten auf der Ladefläche nach vorn.
»Finito.« Die Padrona stieg aus. Nun sahen wir den Grund für unseren Stopp: Vor uns versperrte ein Schlagbaum die Weiterfahrt. Darauf war ein Holzschild genagelt, dessen Schrift nur schwer zu entziffern war: »Proprietà privata.«
»Hoffentlich sind wir überhaupt richtig. Einen Wegweiser gibt’s hier offenbar nicht.« Eleonora holte eine Landkarte aus dem Handschuhfach und breitete sie auf der Motorhaube aus. Ihre Finger fuhren auf dem Papier entlang. »Kein Kloster zu entdecken. Hier – ein Punkt. Ohne Beschriftung. Das muss es sein. Wir fahren weiter.« Die Padrona ging zum Schlagbaum und hob ihn hoch, das Gegengewicht knarzte im Gelenk. »Avanti!«
Etwa fünf Minuten blieben wir auf der Rüttelstrecke, als der Weg sich plötzlich verbreiterte und auf einer Hochebene weiterlief. Kirschlorbeer und Zypressen säumten den Rand. Nach einer weiteren Kurve sahen wir schließlich das Kloster vor uns, die Abbazia di Benedetto. Es war ein Bau aus dem frühen Mittelalter, das Gemäuer bestand aus unverputztem Naturstein, abweisend und uneinnehmbar wie eine Trutzburg. Die Anlage bildete ein Rechteck, die Außenmauern umschlossen zwei Innenhöfe, nur vereinzelte Fenster und Schlitze in der Größe von Schießscharten durchbrachen das Bollwerk. Zusätzlich verlief in einigem Abstand um das Kloster eine zweite mannshohe Mauer aus aufgeschichteten Felsbrocken. Ein Campanile mit quadratischem Grundriss überragte die Zypressen, das Flachdach war mit Ziegeln gedeckt und mit einem Bronzekreuz gekrönt. Rundbogen, paarweise angeordnet, strukturierten die Fassade. Gleich hinter dem Anwesen erhob sich der Bergwald, auf dessen gegenüberliegender Seite der Hang steil abfiel und den Blick freigab auf die Berge jenseits des Tals. Keine einzige weitere menschliche Siedlung war zu sehen, kein Ton zu hören außer dem Rauschen der Blätter. Das Panorama vermittelte die Illusion, als wäre das Kloster vom Himmel gefallen und hätte durch die Jahrhunderte hindurch in der Bergeinsamkeit überlebt. Eine Illusion, die durch die gänzlich abgelegene Lage noch verstärkt wurde, denn unten vom Tal aus war das Anwesen nicht auszumachen. Die frühen Baumeister hatten den Ort geschickt gewählt: Die Mauern wirkten abschreckend auf Fremde und flößten sicher auch den Bewohnern selbst Respekt ein, was beides wohl der tiefere Sinn der Architektur war. Denn im Mittelalter war die Klosteranlage die einzige Heimat der Mönche, hier lebten sie, hier starben sie. Ausflüge zu Verwandten oder Freunden waren nicht vorgesehen, die Mönche gingen einen Pakt ein bis zu ihrem Tod, begaben sich freiwillig in diese abgeschlossene Welt mit ihren eigenen Regeln, in der sich alles nur um den Orden drehte – und um Gott. Einflüsse von außen störten nur. Erst nachdem die weltlichen Herrscher den Abteien das Vermögen genommen und ihre Macht gebrochen hatten, mussten sich die Klöster notgedrungen öffnen.
Eleonora ließ den Wagen vor dem Eingangstor neben einigen anderen Autos mit ausländischen Nummernschildern ausrollen und wandte sich an uns. »Ihr müsst euch noch ein wenig gedulden.« Ich inhalierte die Luft. Die Aromen, die meine Sensoren umspülten, signalisierten eine Frische und Erdverbundenheit, wie ich sie vom Piemont nicht kannte. Das Harz der Fichtennadeln, der Saft der Gräser, die Kühle der Steine – alles schien zu atmen, und ich wusste überhaupt nicht, in welche Himmelsrichtung ich meinen Rüssel als Erstes recken sollte. Eine kleine Pause für die Nase war also sehr in meinem Sinn.
Das Eisentor war verschlossen, ein Klingelknopf fehlte. Es dauerte eine Weile, bis Schritte zu hören waren. Und ein Husten. Ein Mönch in Kutte, vielleicht 50 Jahre alt, schlurfte leicht gebeugt auf Eleonora zu und öffnete das Tor.
»Salve, Signora. Sie ...« Der Rest ging in einem Hustenanfall unter. »Verzeihung. Verzeihung. Mein Name ist Fra Stephanus. Sie sind ...?« Durch das Autofenster roch ich kalten Rauch und Nikotin.
»Ich heiße Eleonora Gobetti. Ich bin Historikerin. Abt Aviano hat uns hergebeten.«
»Uns?« Auf der Stirn des Klosterbruders bildete sich eine Falte. Seine Haut war fahl. »Ich sehe keine Begleitung.« Beim Sprechen entblößte er eine Reihe gelber Zähne.
»Hat Ihnen der Abt nicht Bescheid gegeben? Ich habe meine beiden Trüffelschweine mit dabei. Hinten im Auto. Sie werden mich bei meiner Arbeit unterstützen.«
»Trüffelschweine? Benissimo! Hier oben im Wald sollen Tartufi wachsen. Ich hätte nichts gegen ein Trüffelmenü einzuwenden.« Dieser Mönch, dessen Gewand mit Nikotingeruch vollgesogen war, verstand wohl gar nichts von Tartufi. Als ob das Champignons wären, im Treibhaus gezüchtet, fahle Geisterpflanzen. Trüffel waren die Eibenkönige unter den Gewächsen, im Verborgenen lebend und nur durch die Magie von Trüffelschweinen bereit, an die Oberfläche zu kommen. Also durchaus eine künstlerische Tätigkeit, die ich ausübte. Meiner Padrona brachte sie ein Vermögen ein, auch wenn sie sich nichts aus Geld machte. Für die Erdknollen zahlten Feinschmecker rund um den Globus Unsummen. Und dieser Mönch redete, als wollte er eine Tomate im Supermercato erstehen.
»Nun ja, wir werden sehen. Ich würde gerne auspacken.«
»Natürlich, natürlich. Verzeihung. Wie unhöflich.« Sein Atem rasselte. »Sie müssen wissen, wir haben hier oben kaum weibliche Gesellschaft. Bislang jedenfalls. Aber das soll sich jetzt ja ändern.« Stephanus spuckte aus. »Hier soll sich so manches ändern.«
Eleonora öffnete die Hecktür und ließ uns aussteigen. Der Mönch zuckte bei meinem Anblick zurück. »Herrgott im Himmel. Das ist ja ein mächtiges Vieh.« Vorsichtig umkreiste er mich. »Nun, ähh, ich, ich denke, wir alle sind Geschöpfe des Herrn, wie der Heilige Francesco richtig bemerkte. Er predigte sogar zu den Vögeln.« Stephanus versuchte, die beiden Koffer Eleonoras zu tragen, doch fing er dabei so stark zu schnaufen an, dass die Padrona ihr Gepäck lieber selbst nahm. »Scusi, meine Dame. Das Herz.«
Wohl eher die Lunge, dachte ich. Wir folgten den beiden in den Innenhof. Stephanus wollte uns hinausscheuchen. »Für die Tiere richten wir im Stall etwas her. Wir haben auch ein Schwein. Da können sich die drei gleich kennen lernen.«
Eleonora berührte den Mönch am Arm. Er zog seinen Arm weg, als habe ihn eine Wespe gestochen. »Sehen Sie, Fra Stephanus, das sind keine gewöhnlichen Schweine, sondern äußerst schlaue und sensible Wesen. Sie sind es nicht gewohnt, in Ställen zu schlafen. Wir benötigen eine andere Unterkunft für sie. Und Matratzen. Und Schüsseln fürs Essen und Trinken.«
Stephanus starrte die Padrona mit offenem Mund an. »Ma... Ma... Matratzen? Und Schüsseln? Ich ... ich glaube, das sollten wir zuerst mit dem Abt bereden.«
Verstand dieser Mensch nichts von Kultur? Zu glauben, ich würde mich wie eine gewöhnliche Kuh auf kratzigem Stroh räkeln und Wasser saufen? Der sollte mal mein Zimmer im Piemont mit dem Samtsofa und dem Perserteppich in Augenschein nehmen ...
Stephanus rief zu einem ergrauten Mönch hinüber, der weit über 60 sein musste und gerade den Innenhof betreten hatte. »Abt Aviano! Signora Gobetti ist soeben angekommen.«
Der Abt kam zu uns herüber und begrüßte Eleonora mit einer Herzlichkeit, die ernst gemeint zu sein schien. Er trug das Habit, die traditionelle schwarze Ordenstracht der Benediktinermönche, eine Tunika und ein Skapulier, einen weiten Überwurf. Ein Gürtel hielt den Stoff zusammen. Die Füße steckten in Sandalen, das Haar war silbern und kurz geschnitten, Geheimratsecken ließen die Stirn höher erscheinen. Trotz seines Alters wirkte er vital und energiegeladen. Wie Eleonora wusste, hatte er fast sein ganzes Leben hier im Kloster verbracht.
Als er Jungschwein Caruso und mich sah, zog er seine Augenbrauen nach oben, betrachtete uns mit einer irritierenden Ruhe und sagte: »Bei Gott, das sind zwei ungewöhnliche Geschöpfe des Herrn.« Avianos respektvoller Abstand zu Caruso und mir zeugte von großer Achtung. Seinen Hypnoseblick beantwortete ich mit einem freundlichen Grunzen, was ihn dazu brachte weiterzusprechen. »Aber wir haben großes Verständnis für die Tiere. Wir beherbergen selbst eine Sau. Und einer unserer Schutzheiligen ist Antonius der Große, der Patron und Beschützer aller Schweine. Ein Seitenaltar in unserer Kirche ist dem Heiligen gewidmet. Nicht zu verwechseln mit dem heiligen Antonius von Padua, dem Helfer bei verlorenen Gegenständen.«
Ich war beeindruckt, denn mit solch einer Schweinebegeisterung des Klosters hatte ich nicht gerechnet. Ich fühlte mich willkommen. Gerne hätte ich mich mit dem Abt über die Rolle der Schweine in der Geschichte der christlichen Kirche ausgetauscht, denn da hätte ich ihm das eine oder andere Interessante berichten können. Und ich wäre in seinem Ansehen sicher noch weiter gestiegen, hätte er erfahren, dass meine Vorfahrin Lucrezia am Hofe von Cosimo de’ Medici in Florenz gearbeitet hatte. Sie bewohnte ein eigenes Zimmer im Palazzo Medici und galt als Vertraute von Nannina de’ Medici. Lucrezia diente zugleich als Zimmermädchen, Beschützerin und Ratgeberin, auch wenn es Nanninas Bruder Lorenzo de’ Medici nicht mochte, seine Schwester ständig in Gesellschaft einer Sau zu sehen. Aus diesem Grund ist Lucrezia auch in vielen Chroniken unerwähnt geblieben, kein seltenes Schicksal für ein Schwein.
Aviano plauderte noch eine Weile mit Eleonora, hörte sich ihren Wunsch nach angemessener Behausung für Caruso und mich an und versprach, sich umgehend um die Angelegenheit zu kümmern.
Das war vor drei Tagen gewesen. Drei Tage voller Klostergartendüfte, seligem Nichtstun und einer Stille, Ruhe und Bedachtsamkeit, wie ich sie noch nicht erlebt hatte. Keiner der Mönche schien auch nur zu wissen, was eine schnelle Bewegung ist, sie verrichteten ihr Tagesgeschäft, langsam aber stetig, jede Hektik vermeidend. Allein durchs Zuschauen wurde man ruhiger und fand es auf einmal vollkommen in Ordnung, ohne schlechtes Gewissen Löcher in den Himmel zu starren. Ich vermute, es kam daher, weil die Mönche mit einem anderen Begriff von Zeit lebten. Weltliche Sorgen wie »Zeit verschwenden« oder »Zeit ist Geld« drückten sie nicht. Das machte wohl einen Großteil der modernen Faszination aus, die das mönchische Leben auf gestresste Menschen ausübte.
Wir Schweine kannten solche Probleme nicht. Wir lebten nach dem Motto unseres Schweinephilosophen Vestalus: Jede Minute ist ein Trüffel deines Lebens. Speisen oder Schlafen, alles war für uns gleich wichtig, auch wenn ein Happen eine Stunde dauerte. Für normale Menschen war die Zeit eine Peitsche, die sie antrieb, jede freie Stunde kostbar und selten wie ein Barolo von 1972. Das Kloster dagegen bot einen radikalen Gegenentwurf: Zeit ist unendlich, sie geht sogar über den Tod hinaus durch Auferstehung und Einkehr ins Paradies. Die Padres kannten einen Begriff wie Feierabend nicht, sie verwoben Beruf und Freizeit perfekt. Ihr Leben war die Zeit mit sich selbst, eine Selbsterfahrung des Hier und Jetzt und zugleich die Gewissheit für die Zukunft. Immaterielles, das Ich, der Geist bekamen einen neuen Stellenwert, rückten in den Mittelpunkt der eigenen Existenz. Ja, daran konnte ich mich gewöhnen – Meditationen über Tartufi und Rotwein und sich dabei die Sonne auf den Bauch scheinen lassen.
Doch dann riss mich Eleonora abrupt aus der neu entdeckten Welt der Ruhe und nötigte mich im Zuge ihrer historischen Forschungen hinab in die beklemmende Dunkelheit der Krypta. Nun standen wir wieder im Tageslicht, über und über mit Spinnweben bedeckt, wie ich jetzt erst bemerkte, und sortierten unsere Gedanken nach dem rätselhaften Skelettfund in der vergessenen Grabstätte. »Buon giorno«, ertönte es überraschend hinter uns. Es war der Abt, der mit strahlendem Gesicht die Arme ausbreitete, als wollte ein Großvater seine Enkelkinder nach langer Zeit wieder in die Arme schließen. Dabei war es fast unmöglich, dem Oberhaupt des Klosters nicht ständig über den Weg zu laufen, im Garten, in der Küche, im Stall, nach den Andachten, beim Essen. Er schien immer und überall präsent zu sein, tauchte überraschend dann auf, wenn man nicht mit ihm gerechnet hatte. Seine Augen blickten einen an wie ein Suchender, der in die Tiefe der Seele taucht und alle Geheimnisse ans Licht holen will. Ihm schien es von Anfang an selbstverständlich zu sein, dass ich Eleonora auf dem Anwesen begleitete, allein durch die Gänge streifte oder es mir wie ein Schoßhund in den Räumen bequem machte, egal ob Menschen anwesend waren oder nicht.
»Abt Aviano, gut, dass ich Sie sehe, wir müssen reden.« Eleonora klopfte sich den Staub von der Jacke. »Wir haben eine Entdeckung gemacht. Im Gerätekeller. Da ist ...«
Der Klostervorsteher hob beschwichtigend die Hände. »Liebe Signora Gobetti, ihr Eifer ist ehrenwert, sogar im Untergrund sind Sie tätig. Obwohl ich mir Ihre Recherchearbeit anders vorgestellt habe. Doch was Sie mir erzählen wollen, muss warten. Hier oben gehen die Uhren anders. Uns läuft nichts davon.«
»Aber wir ...«
»Schon gut, schon gut, wir werden darüber sprechen. Später. Ich erwarte einen Neuankömmling, den ich begrüßen muss. Einen Künstler. Opernsänger von Beruf. Wie ich gehört habe, von einiger Berühmtheit.« Das Klosteroberhaupt nickte zum Abschied und ging weiter. Unerhört. Ich konnte gerade noch einsehen, dass er, der keine Ahnung hatte, wer Lucrezia war, nicht verstand, was der Skelettfund unter Umständen bedeutete. Dem würde ich selbst nachgehen müssen, wie immer, und das würde ich auch tun. Aber dass dieser Mönchs-Capo, der die historische Untersuchung des Klosters angeordnet hatte, sich nun einfach so abwendete, nur weil der Fund im Keller entdeckt worden war und nicht in der Klosterbibliothek über eine staubbedeckte Chronik gebeugt, wie er es gerne gesehen hätte?
Eleonora starrte ihm nach. »Wenn er nicht will, dann eben nicht. Dann müssen die Toten eben warten.«