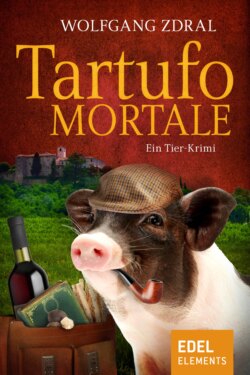Читать книгу Tartufo mortale - Wolfgang Zdral - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеDer Abt ging zum Schrank und holte eine Flasche mit dunkler Flüssigkeit heraus. »Sie verzeihen, Signora Gobetti, aber nach der Aufregung brauche ich jetzt was für die Nerven.« Er schenkte sich ein Glas ein und trank es in einem Zug aus. Ich roch Wermut, Thymian, eine Reihe unbekannter Kräuter – und Alkohol.
»Für besondere Notfälle.« Aviano ging um seinen Schreibtisch herum, setzte sich und stellte Flasche und Glas neben sich ab. »Nehmen Sie Platz, Signora, bitte.« Er sah zu mir hinüber. »Und du wirst meinen Teppich nicht verdrecken, wenn du schon hier im Zimmer sein darfst.«
Ich funkelte ihn an. Hielt er sich für den Papst, der eine Audienz gab? Jetzt hielt man mich auch noch für einen lebenden Schmutzgenerator. Demnach zu urteilen, was ich bislang so gerochen hatte, konnten einige seiner Mitbrüder von meiner Reinlichkeit noch etwas lernen. Ich jedenfalls wusch mich jeden Tag von Kopf bis Fuß mit frischem Wasser, eine Selbstverständlichkeit für jedes Schwein. Den Hals gurgeln, Dehngymnastik für die Muskeln, den Rüssel mit einer ausgefeilten Atemtechnik durchpusten, Riechübungen – meine Morgentoilette beanspruchte ihre Zeit.
»Bei meinem Porcellino brauchen Sie sich keine Gedanken machen, Padre. Das ist ein kluges Tier.«
»Ich hoffe es. Dafür habe ich es auch von Ihnen mitbringen lassen. Für Ihre Mission.« Der Abt zog seinen Ärmel glatt. »Womit wir beim Thema sind. Als ich Sie um Unterstützung bat, dachte ich mehr an historische Studien in den Folianten unserer Bibliothek. Dafür sind Sie mir empfohlen worden. Ich hätte aber nie erwartet, dass Sie Gräber öffnen und die Totenruhe eines Menschen stören.«
»Aber Sie selbst ...«
Der Abt hob die Hand. »Gemach, gemach, Signora. Ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Ich hätte Sie besser instruieren müssen. Mein Fehler, Gott möge mir verzeihen. Sie sind jung, Ihr Forschereifer ... Ich kann es bis zu einem gewissen Grade ja verstehen. Wir sind Ihnen dankbar, dass Sie unentgeltlich Ihre Arbeit tun, eine noble Geste. Dennoch ... ich bitte Sie, die Interessen künftig auf weniger makabre Dinge zu konzentrieren.«
»Abt Aviano, wie soll ich meine Aufgabe erfüllen, wenn ich die Recherchen auf Bücher beschränke? Glauben Sie mir, um handfeste Resultate zu erzielen, braucht es mehr als bloßes Aktenstudium. Lassen Sie meine Schweine und mich nur machen. Sie werden am Ende von den Ergebnissen überzeugt sein.«
»Ich will Ihnen keine Schranken auferlegen. Sie wissen, wie sehr mir daran gelegen ist, die Historie des Gemäuers zu beleuchten. Das ist übrigens ganz im Interesse unserer Ordensleitung. Wir haben es jetzt mit Gottes Hilfe geschafft – und darauf bin ich ein wenig stolz – erstmals Gäste, zahlende Gäste, in unserem Kloster aufnehmen zu können. Ich wünschte, es wäre anders und wir könnten uns ganz unserer geistlichen Arbeit widmen – aber wir brauchen das Geld. Das geht kurzfristig nur mit Tourismus. Und für die Fremden brauchen wir etwas zum Vorzeigen. Eine Attraktion. Dazu ist eine faszinierende Geschichte ideal, die Menschen lieben Geschichten. Schließlich sind wir hier nicht in Assisi, haben kein Grab eines Heiligen. Nur ein Grab mit den Gebeinen einer Frau und einem Schweineskelett. Welch Blasphemie.«
»So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Eher extrem ungewöhnlich«, antwortete Eleonora. »Bisher habe ich keine Erklärung, warum es zu der gemeinsamen Beerdigung kam. Oder ob das Schwein nachträglich in den Sarg gelegt wurde. Was wiederum die Frage aufwirft: Warum? Und von wem? Und wann?«
Aviano ließ sich in die Stuhllehne fallen. »Bene! Sie haben erste Entdeckungen gemacht. Ein Schwein in einer Gruft. Ich habe angeordnet, den Sarkophag wieder schließen zu lassen. Denn bei der Klostergeschichte habe ich an etwas anderes gedacht. Mit einem Schweineskelett locken wir keine zahlenden Gäste hinter dem Ofen hervor, im Gegenteil! Meine Fratelli habe ich zum Schweigen verpflichtet, auf die ist Verlass. Ich zähle darauf, dass auch Ihre Lippen versiegelt sind. Nicht auszudenken, wenn unsere Besucher von diesem Vorfall erführen. Eine Sau und ein Mensch aneinandergeschmiegt. Ich kann mir nur vorstellen, welche Gespenstergeschichten dann die Runde machen würden. Das kann ich im Kloster nicht gebrauchen, nicht an einem Ort der Stille und des Friedens. Die Menschen kommen zu uns, weil sie Ruhe und spirituelle Erbauung suchen. Jede Aufregung ist Gift. Reines Gift. Wir wollen nicht mehr auf uns aufmerksam machen, als fürs Geschäft notwendig ist.«
»Für die Seele oder fürs Geschäft?« Ich hoffte, dass dem Abt der sarkastische Unterton Eleonoras entgangen war.
»Für beides. Ich würde es nicht Geschäft nennen.« Aviano schenkte sich ein zweites Glas ein, setzte es an die Lippen und trank es aus, diesmal langsamer. Nachdenklich betrachtete er das Glas, als könnte er darin die Antwort auf all seine Fragen finden. »Ich bin seit über 40 Jahren in der Abtei, schon als junger Mann kam ich hierher auf den Berg. Meine Eltern habe ich im Krieg verloren. Ein Bombenangriff. Das Kloster gab mir wieder eine Heimat. Alle Höhen und Tiefen habe ich miterlebt, gesehen, wie das einst so stolze Kloster Jahr für Jahr mehr dahinsiechte, trotz unserer Gebete. Als ich zum Abt gewählt wurde, stemmte ich mich gegen diese Entwicklung, begrüßte neue Mitglieder in unserem Konvent. Aber jetzt, in einem Alter, in dem andere Menschen längst im Ruhestand sind, muss ich mir eingestehen, dass meine Mühen nicht von nachhaltiger Wirkung gewesen sind. Wir brauchen einen radikalen Schritt, wenn diese Abtei weiterbestehen soll. Die Antwort heißt sanfter Tourismus für Menschen mit Bildung, die so etwas zu schätzen wissen. Ein einzigartiges Refugium für Gäste, die bereit sind, für das Besondere zu zahlen. Wir bieten eine Atmosphäre der Beschaulichkeit und tun zugleich etwas für das Seelenheil unser Besucher. Das Geld fließt ausschließlich in die Kassen des Klosters. Wir Mönche haben uns zur Armut verpflichtet, privat gehört uns nichts. Was Sie hier sehen ...«, Aviano machte eine ausholende Bewegung, die alles in seinem Büro einschloss: das Ölgemälde mit der Jungfrau Maria, die Aktenstapel, die auf dem Schreibtisch verstreut waren, das Telefon mit Wählscheibe, Radio, Teppich, Schrank und die Couch mit Stickereien, »... gehört dem heiligen Benedikt. Wir sind nichts als seine Diener. Wir verwalten die Dinge lediglich.«
»Ich kann nicht garantieren, dass wir etwas finden werden. Aber der Fund in der Gruft ist ein erster Anhaltspunkt. Wir müssen unorthodoxe Wege beschreiten. Erzählungen, Folklore, Hörensagen. Goldener Trüffel – klingt ungewöhnlich für ein Kloster, gelinde gesagt.«
»Seien Sie optimistischer. Die Legende existiert seit Hunderten von Jahren, sie ist ein Teil der Vita dieses Gemäuers. Da muss etwas in den Dokumenten zu finden sein. Sie kann Teil einer wunderbaren Geschichte unseres Klosters sein, aufgeschrieben von einer wunderbaren Historikerin. Die überdies über archäologische Fähigkeiten verfügt.«
»Warum überhaupt der Aufwand für die Geschichtsrecherchen?«
Aviano seufzte. »Wenn’s nur nach mir ginge, könnte ich darauf verzichten. Obwohl mich die Vergangenheit des Klosters interessiert, sie ist zugleich ein Teil meines Lebens. Aber sehen Sie sich um. Schauen Sie sich die Welt da draußen an. Überall hässlicher Wettbewerb, Unternehmen, die ihre Marktmacht ausreizen, die ihre Vermarktungsstrategien gnadenlos nach rationalen Kriterien exekutieren. Der Einzelne spielt da keine Rolle mehr. Ganz anders bei uns: Da steht der Einzelne im Mittelpunkt. Uns kümmern kommerzielle Kriterien nicht. Wir sind eine Oase in der Wüste der Geldgier. Bisher jedenfalls. Selbst wenn wir mit dem Mammon einen Pakt eingehen, so tun wir das aus anderen Motiven als Firmen. Und wir wissen den lieben Gott auf unserer Seite. Zugleich sind wir unerfahren in der Geschäftswelt, treiben wie der Korken auf einer Welle. Die Wellen erzeugen die anderen, und wir haben uns anzupassen, um nicht unterzugehen. Das heißt, wir müssen uns um so etwas wie ...«, der Abt zögerte einen Moment, bevor er das Wort aussprach, »... wie Marketing Gedanken machen. Mein Gott, wie ich dieses Wort verabscheue, das dürfen Sie mir glauben. Aber was soll’s – die Regeln stellen nicht wir auf. Wir müssen uns ihnen fügen. Deshalb brauchen wir etwas Einzigartiges, eine spannende Historie, prominente Vorfahren, einen Goldenen Trüffel, um aus der Menge der Konkurrenzangebote herauszuragen. Sie finden uns in keinem Reiseführer, keinem Urlaubskatalog. Das wollten wir ganz bewusst so. Die oberste Ordensleitung hat uns das Plazet erteilt. Seit Jahrzehnten leben wir hier ganz unter uns. Beten und arbeiten.«
»Ihre Gästeklause stellt nun allerdings einen radikalen Wandel dar«, entgegnete Eleonora.
»Die Not zwingt uns dazu. Unser Vorteil verwandelt sich nun in einen Nachteil – niemand kennt uns. Wir brauchen mehr Gäste. Keine Massen, bei Gott nicht. Sondern eine Handvoll spirituell Suchender, die unser Angebot zu schätzen weiß. Mehr könnten wir auch gar nicht bewältigen, denn außer unserem Hausmeister-Ehepaar wollen wir keine weiteren Angestellten.«
»Mönche sind allerdings keine gelernten Kellner und Zimmermädchen.«
»Ich weiß, ich weiß. Aber einen anderen Weg sehe ich nicht. Wenn meinen Fratelli an dieser Abtei liegt, werden sie Opfer bringen müssen. Ich sehe den ganzen Prozess als eine Prüfung, die der Herr uns auferlegt hat. Vielleicht kommt die Abtei ja auch draußen ins Gespräch, und wir finden neue Mitbrüder. Lavello war der Letzte – seit Jahren endlich wieder ein junger Mann, der dem Orden beitreten will. Zuwachs in unserer Gemeinschaft, das ist es, was ich mir am meisten wünsche.«
»Was sagen Ihre Mitbrüder dazu?«
»Ganz im Vertrauen – das ist der schwierigste Teil der Operation. Es gibt Vorbehalte. Unmut. Widerstand.«
»Wem passt denn die Linie nicht?«
»Darüber will ich nicht reden, eine innere Angelegenheit des Konvents. Wenn meine Gebete erhört werden, wird sich schon bald die gewohnte Einigkeit wieder herstellen.« Aviano räumte die Flasche in den Schrank.
»Wenden wir uns lieber einem angenehmeren Thema zu. Ich weiß, es ist ein vermessenes Anliegen, aber es wäre die erste Attraktion für unsere Gäste, und ich will gestehen, auch für mich: ein Trüffelessen. Die Wälder rund ums Kloster sollen eine Schatztruhe für diese Pilze sein. Sie haben einen Experten bei sich, dem es ein Leichtes sein würde.« Er zeigte auf mich. »Aber ich verstehe, wenn Sie sich auf Ihre historischen Studien konzentrieren wollen.«
Von draußen hörten wir eilige Schritte. Ein Klopfen, und ohne das »Herein« abzuwarten, trat ein Mönch mit zerzaustem Haar ein. Sein Brustkorb pumpte Luft.
»Padre, schnell! Es ist etwas passiert. Schnell! Wo ist Fra Lavello?«
»Langsam, Fra Gabriel. Warum störst du uns?« Das Gesicht des Abts spiegelte Verdruss.
»Schnell, bevor es zu spät ist. Er blutet. Das Blut ... überall.« Der Mönch hatte sich bereits wieder umgedreht und war aus der Tür gelaufen. Aviano eilte ihm nach. Wir hinterher. Gabriel nahm den Weg quer durch die Rosenrabatte des Kreuzgangs und verschwand in der Tür neben dem Versammlungsraum des Konvents. Nur mit Mühe hielten der Abt und wir Schritt. Eine Treppe führte hinauf in den ersten Stock, den ich noch nicht betreten hatte. Ein langer Gang mit Terrakottafliesen und in gleichem Abstand gereihten Türen. An den Wänden nichts außer Kreuze und Heiligenbilder. Unwillkürlich musste ich an ein Gefängnis denken, aber wir befanden uns im Wohntrakt der Mönche. Die zweite Tür auf der linken Seite stand offen. Ein Zimmer, vielleicht drei Meter breit und vier Meter lang. Vor dem Fenster ein Tisch mit einem Madonnenbild, einem Kerzenhalter und einigen Büchern. Links ein Kleiderschrank, ein Betschemel und ein Stuhl. An der rechten Wand stand ein Bett mit weißen Decken. Zumindest waren sie bis vor Kurzem weiß gewesen. Jetzt zeichneten rote Spritzer ein abstraktes Muster auf die Fläche. Auf dem Bett lag – in vollem Habit – Stephanus. Die Augen waren starr auf die Decke gerichtet, sein Atem rasselte. Auf seinem Kissen hatte sich eine Blutlache gebildet, selbst am Boden waren Blutspuren zu sehen. Der Abt setzte sich auf die Bettkante und berührte den Arm des Mönches.
»Fra Stephanus, kannst du mich hören?« Und zu Gabriel gewandt: »Lauf und hol Lavello!«
Stephanus drehte den Kopf, als hätte er gerade erst bemerkt, dass jemand in seinem Zimmer war. Seine Augen streiften Eleonora, blieben bei mir haften, suchten das Gesicht Avianos. »Ich ... ich.« Ein Hauch, kaum zu verstehen.
»Bleib ruhig, beweg dich nicht. Du musst untersucht werden. Wo bist du verletzt?«
»Ich ... muss ... Ihnen ... etwas ...« Stephanus’ Atem ging schneller. Einen Moment glaubte ich, es würde mit ihm zu Ende gehen. Er versuchte sich aufzurichten, schaffte aber nur wenige Zentimeter. Der Abt beugte sich zu ihm hinunter.
»Ich muss ... Ihnen etwas ... sagen, Padre.« Der Mönch presste jedes Wort unter Schmerzen heraus. »Ich ... habe ... etwas gesehen. Etwas ... entdeckt. Etwas Wichtiges. Es betrifft ...«
Aviano legte den Zeigefinger auf seine Lippen. »Nicht jetzt, Fra Stephanus, nicht jetzt. Das hat Zeit. Du kannst später beichten. Jetzt müssen wir dich verarzten. Wo bleibt Lavello?«
Gerade kann der Novize durch die Tür, in der Hand einen Lederbeutel. Er kniete neben dem Bett nieder und untersuchte seinen Mitbruder. Vorsichtig tastete er den Kopf des Verletzten ab und drehte ihn zur Seite. Stephanus’ Haare waren blutverschmiert.
»Eine riesige Platzwunde«, diagnostizierte Lavello. »Als hätte er sich irgendwo gestoßen – oder eins auf den Schädel...« Er unterbrach sich. »Die Verletzung geht nicht tief. Ich glaube nicht, dass genäht werden muss. Stephanus hat Blut verloren, es sieht schlimmer aus, als es ist. Ich werde ihm einen Verband anlegen. Das müsste eigentlich reichen. Wenn Sie es wünschen, Padre, holen wir noch einen Arzt hinzu.«
»Kommt er wieder auf die Beine?«
»Ich denke schon. Er braucht jetzt nur Ruhe und Erholung. Sein Herz ist schwach, ich werde ihm ein Schmerzmittel geben.«
»Es wird eine Ewigkeit dauern, bis der Doktor bei uns ist.« Aviano nahm Stephanus’ Hand. »Fühlst du dich stark genug, das durchzustehen, oder willst du ärztliche Hilfe?«
Stephanus schüttelte den Kopf und setzte wieder an zu sprechen. »Ich ... will ... Ihnen ... sagen ...«
»Genug jetzt.« Der Abt stand auf. »Der Patient braucht Ruhe. Wir sollten für seine Genesung beten. Ich werde eine Kerze in der Kirche anzünden.« Er gab uns einen Wink. »Lassen wir ihn schlafen, Lavello wird sich weiter um ihn kümmern. Gott sei Dank ist nichts Ernsteres passiert. Wobei mir ein Rätsel ist, wie er sich die Verletzung zugezogen hat. Aber das können wir alles später klären.«
Mir fiel auf, dass die Blutstropfen am Boden eine Linie bildeten und nach draußen führten. Am Gang entdeckte ich ebenfalls feine Tropfen, bereits eingetrocknet und kaum sichtbar. Sie führten zur Treppe. Mit einem Grunzen machte ich Eleonora darauf aufmerksam.
»Abt Aviano, sehen Sie, die Blutspuren am Boden.« Die Padrona wies auf die Flecken.
Aviano blickte kurz auf die Stelle. »Ja, tatsächlich. Könnte Blut sein. Oder etwas anderes. Jemand soll es wegwischen. Ich lasse Sie jetzt allein, Signora. Meine anderen Pflichten, Sie verstehen.«
Wir blieben zurück. Lavello hatte die Tür zu Stephanus’ Zimmer geschlossen. Ich schnüffelte an den Blutstropfen. Roch frisch. Eindeutig von Stephanus. Der Geruch führte die Treppe hinunter, wo wir die Blutspritzer jetzt in größeren Abständen fanden. An einer Seitentür, die in den äußeren Garten führte, endete die Spur. Ich drückte gegen das Holz, und die Tür schwang auf. Zwei Stufen führten ins Freie, wo Wildgräser und vereinzelte Blumenstängel bis an die Mauer reichten. Die Fährte hatte sich verloren. Kein Blut mehr zu sehen oder zu riechen.
»Was jetzt?« Eleonora klang ratlos.
Ich tapste ins Gras, behutsam Huf vor Huf setzend, und erforschte den Bereich um die Treppen. Die Erde roch sauer, überlagert von der Schärfe der Kräuter. Plötzlich blieben meine Füße an einem Stein hängen. Mit dem Rüssel drückte ich die Pflanzen nieder, der Saft der Stängel drang in meine Nase. Der Stein entpuppte sich als Teil einer Figur, deren andere Stücke verstreut in der Nähe lagen. Eleonora hob die Fragmente auf und legte sie auf die Stufen.
»Die Figur des Apostel Petrus. Zu erkennen an dem Schlüsselsymbol. Einer der ersten Jünger Jesu und derjenige, der seinen Heiland später verleugnete. Die Gesichtszüge sind kaum mehr zu erkennen. Muss im Freien gestanden haben.«
Ein Fragment war verfärbt. Ich schnupperte daran – frisches Blut. Die Steinfigur war also die Ursache für Stephanus’ Kopfwunde. An dieser Stelle war er offenbar von dem Stein getroffen worden. Automatisch ging mein Blick nach oben. Auf Höhe des ersten Stocks, neben einem Fenster, sah ich eine Nische in der Außenmauer. Eleonora bemerkte sie auch.
»Dort oben wird die Figur gestanden haben. Als Schmuck. Wie an anderen Stellen des Klosters. Der Zement hat sich im Laufe der Zeit gelockert, der Sockel wird brüchig – und schon ist es passiert. Die Steinskulptur fällt hinunter und streift unglücklicherweise den armen Stephanus, der gerade vorbeigeht. Dabei hatte er noch Glück, dass er nicht voll von der Figur getroffen wurde. Sonst, bei dem Gewicht ...« Sie führte ihren Gedanken nicht zu Ende. Mir blieben Zweifel, denn es war schon ein enorm großer Zufall, von einem herunterfallenden Stein getroffen zu werden ...
»Lassen wir die Figur vorläufig liegen«, sagte Eleonora. »Wir können jetzt sowieso nichts unternehmen. Nutzen wir lieber die Zeit und gehen auf Trüffelsuche, um des allgemeinen Klosterfriedens willen. Wo steckt eigentlich Caruso?«
Wir waren bereits eine halbe Stunde bergauf marschiert, und ich hatte mittlerweile sogar meinen Groll überwunden, nun doch wie ein Dressurpferdchen Tartufi für die Klostergäste heranschaffen zu dürfen. In den Bann geschlagen von den faszinierend fremden Waldaromen Umbriens, wurde ich wie aus einer fernen Welt geholt, als sich ein vertrauter Geruch in meinen Rüssel schlich, der Duft der Düfte: Tartufi. Ganz in der Nähe musste ein Nest verborgen sein. Caruso hatte es ebenfalls bemerkt und drehte seinen Kopf, um die genaue Richtung des Dufts auszumachen. Ich war stolz, dass der Junior meine Unterrichtslektionen verinnerlicht hatte. Eleonora drehte sich zu mir. »Hast du was entdeckt, Porcellino?«
Ich grunzte zur Bestätigung. Zu Caruso sagte ich: »Jetzt zeig mal der Padrona, was du gelernt hast.«
»Darf ich?« Die Aufregung war nicht zu überhören. »Mein erster richtiger Trüffelfund. Ich probier’s allein, oder? Nur ich. Du hilfst mir nicht? Ich will es ganz allein schaffen!«
»Selbstverständlich. Nun hol dir schon die Beute.«
Caruso drängte sich nach vorn und schlug einen Weg bergaufwärts ein. Wir folgten. Nach etwa hundert Metern steuerte er links auf eine Eiche zu. Er musste sich beherrschen, nicht loszulaufen. Immer wieder drehte er sich um und kontrollierte, ob wir ihm noch folgten.
»Mal langsam, Kleiner.« Eleonora schnaufte. »Die Pilzchen warten auch noch ein paar Minuten länger auf uns.«
Zwei Meter vor dem Eichenstamm stoppte Caruso. Wir hatten unser Ziel erreicht, das Aroma stach aus der Erde, aufdringlich und herrlich. Tartufi. Meine Lieblinge. Das schönste Geschenk der Natur an die Schweine. Nur verdienen mussten wir uns das Geschenk, mussten unsere Gaben zur Trüffelsuche einsetzen. Der Lohn war mehr als Geld und Gold. Mehr als Ruhm und Anerkennung. Eine tiefe Befriedigung, die jede Faser des Körpers erfasste, das Gehirn überschwemmte wie eine Droge. Ein erotisches Erlebnis. In gewisser Weise zumindest. Mein Ururonkel Pastuno aus Venedig jedenfalls naschte einst vor seinen amourösen Abenteuern einen Pilz zur Stärkung. Was ihm einen unsterblichen Ruf einbrachte und eine Flut von Angeboten alleinstehender Sauen. Als er seine große Liebe Dulcinea zum ersten Rendezvous traf- nach einem Jahr vergeblichen Werbens und einer Leidensphase voller Depression -, schluckte er gleich fünf Trüffel. Es wurde für beide eine unvergessliche Liebesnacht. Leider erwachte Pastuno nicht mehr aus ihr. Das Herz. Sein Leichnam wurde in einer mit schwarzem Stoff verhängten Gondel aufs offene Meer hinausgerudert und dort versenkt. Später nutzte ein aufdringlicher Venezianer, Giacomo Casanova, Pastunos Tartufi-Rezept zur Stärkung. Was ihm einen gewissen Ruf einbrachte, ungerechtfertigterweise, denn meinen Uronkel erwähnte dieser undankbare Mensch niemals.
Der Genuss eines Trüffels braucht keine Verstärkung. Ein Rembrandt-Bild übermalt immerhin auch niemand mit Farbe. Wer einmal den Pilz auf der Zunge gespürt – die Aromen, fein und zart wie eine Zeichnung von Michelangelo, kräftig und betörend wie ein Gemälde von Van Gogh -, wer die Säfte in sich hat wirken lassen – eine Melange von Freuden -, der versteht die Welt, der begreift das Elixier des Lebens. Hätten sich die Alchemisten im Mittelalter auf der Suche nach dem Stein der Weisen mehr von den Schweinen leiten lassen, die Antwort auf all ihr vergebliches Tun wäre nur ein Wort gewesen: Tartufo.
Mit den Hufen scharrte Caruso eine Mulde in den Boden. Uns schien er vergessen zu haben, sein Rüssel prüfte das Erdreich.
»Du hast was gefunden, mein Guter?« Eleonora stellte ihre Tasche ab und holte ein Messer heraus, ein Erbstück ihres Schwiegervaters. »Mal sehen, was sich da verbirgt.« Sie schabte die Erde in einer leichten, schwingenden Bewegung weg, grub mit den Händen weiter. »Ha, da ist was!« Die Aufregung erfasste sie. Dieser Moment des Entdeckens ließ niemanden gleichgültig, weder Mensch noch Schwein. Es war ein Gefühl der Erhabenheit – Esus, der oberste Schweinegott, meinte es gut mit uns. Ein Zeichen, dass er, der Große Beschützer, Schweine als die auserwählte Spezies anerkannte. Eleonora führte das Messer nun wie ein Skalpell. Sie stach schräg in den Boden und vollführte aus dem Handgelenk einen Halbkreis. »Da ist er!«
Für einen Moment war ich abgelenkt. Hatte ich nicht soeben das Knacken eines Zweiges gehört? Ich drehte mich um. Nichts zu sehen, nichts zu hören außer dem Wind und dem Atem meiner Begleiter. Und doch ... meine Sensoren registrierten einen fremden Geruch. Sehr weit weg und kaum zu entdecken. In der Ferne machte ich eine Gruppe Fichtenschösslinge aus. Dort schien die Quelle des Geruchs zu stecken. Aufgrund der Entfernung konnte ich nicht unterscheiden, ob sich ein Mensch oder ein Tier dort verbarg. Oder spielte mir meine Nase einen Streich? Ich überlegte, ob ich nachschauen sollte. Aber ich konnte meine Kameraden nicht allein lassen. Außerdem wollte ich mich nicht lächerlich machen, weil ich einen Fuchs aus seinem Bau vertrieben hatte. Andererseits wurde ich das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Wenn ich darüber nachdachte, hatte ich dieses Gefühl schon länger, schon seit wir im Wald marschierten. Vermutlich nur ein Hirngespinst, wer sollte uns nachschleichen? Dazu gab es keinen Anlass, harmlose Klostergäste, die wir waren. Und doch ...
Ein Begeisterungsruf Carusos riss mich aus meinen Gedanken. »Ein Nest! Ich habe ein ganzes Nest entdeckt! Gleich beim ersten Mal! Leonardo, sieh dir das an.«
Eleonora hatte den Fund auf dem Boden ausgebreitet. Die acht Kugeln, runzelig und schwarz, manche in der Größe von Weintrauben, manche wie Mirabellen, befreite sie mit einer Bürste von den Erdklumpen. Der Duft war durchdringend und hüllte uns ein. Seliges Aroma, unschuldig tief im Boden schlummernd, unvergleichlich auf der Welt. Es weckte Erinnerungen an das Piemont, an meine Kindheit, die Spaziergänge mit meiner Mutter Penelope durch die Wälder, an den Nachtisch zu Weihnachten, Zimt, Kardamom, gereifter Käse. Der Duft war weniger intensiv als die weißen Exemplare aus meiner Heimat, die Königstrüffel aus Alba. Die waren unerreicht wie eine Verdi-Oper. Doch galten die Tartufi aus Umbrien als vorzüglich, als beste Ware – Händler exportierten die Tuber Melanosporum und andere Sorten in alle Welt und verdienten ein Vermögen damit. Ich sage dazu: Kein Vergleich mit den Exemplaren aus dem Piemont. Meine Heimat-Tartufi explodierten in tausend Nuancen auf der Zunge, die Aromen tanzten auf dem Gaumen, der Widerhall nach dem Schlucken war reines Gefühl – besser als Amore. Oder nicht? Umbrische Exemplare wirkten dagegen fast wie der zweite Aufguss.
Immerhin – im Gegensatz zu ihren Brüdern aus Alba blieben die schwarzen Trüffel länger haltbar. Sogar in Öl eingelegt behielten sie einen Teil ihres Aromas. Aber der Genuss dieser Öl-Bonbons blieb ein Kompromiss, lediglich der Schatten eines frischen Pilzes.
»Bravissimo, Schweinchen!« Eleonora strich Caruso über den Rücken. »Ein perfekter Einstand. Vielleicht finden wir noch mehr. Wenn wir schon mal da sind.«
In der Tat erwies sich die Gegend als Fundgrube für Tartufi – als hätten sie nur darauf gewartet, von uns an die Oberfläche geholt zu werden. Wir brauchten eine Stunde, bis die Tasche der Padrona mit den Leckereien gefüllt war. Unseren Anteil hatten Caruso und ich bereits an Ort und Stelle verspeist.
Zurück im Kloster, empfing uns Fra Habiatus in der Küche, mit von der Hitze des Herds rot gefärbten Backen. Oder war die Flasche Kochwein schuld, die neben ihm stand? Die hochgekrempelten Ärmel gaben den Blick frei auf zwei mächtige Unterarme, die nicht so recht zum untersetzten Körperbau und dem Kugelbauch des Mönchs passen wollten. Fra Habiatus übte das Amt des Cellerars aus. Wenn es ein Amt im Kloster gab, das wichtig war und einem Macht verlieh – Demut hin oder her -, dann war es die Aufgabe des Cellerars. Er herrschte wie ein Fürst in seinem Küchenreich, absolut und unantastbar, nicht einmal der Abt wagte, ihm dreinzureden. Diese Position unterstrich die Tatsache, dass der Cellerar zugleich über den Weinkeller regierte. Mochte Beten und Arbeiten der Weg in den Himmel sein, Essen und Trinken war der Weg zum irdischen Glück, ein festes Ritual, genauso wichtig wie die Kirchgänge im Laufe eines Tages. Und Habiatus sorgte dafür, dass dieses Ritual den würdigen Rahmen erhielt: eine Lobpreisung des Magens und des Gaumens. Eigentlich hatte der Mönch ursprünglich in einem Kloster in Orvieto gedient, doch die kargen Mahlzeiten dort trieben ihn in die Arme der Benediktinerabtei. Seit zwölf Jahren erfüllte er seine Mission bei den Schüsseln, Töpfen und Pfannen der Klosterküche. Ich war erstaunt, wie gut er sein Handwerk beherrschte, galt für mich bislang die Kochkunst meines früheren Padrone als einziger Maßstab, der zu oft unerreicht blieb. Habiatus’ Gerichte waren eine Spur einfacher als das, was ich aus meiner Heimat gewöhnt war, aber nicht ohne Raffinesse. Schlichte, frische Zutaten, geschickt kombiniert, die sich auf dem Gaumen wunderbar entfalteten.
»Ah, unsere Familie aus dem Piemont, Gott zur Ehre, Signora.« Er verbeugte sich in einer übertriebenen Geste. »Was führt Sie und Ihre Adoptivkinder, Ihre lebenden Schinken, in meine Hütte?« Er lachte uns an, sein Körper schüttelte sich und der Bauch tanzte auf und ab. Ich traute seinen Witzchen nicht, nachdem ich gesehen hatte, wie virtuos er mit Schlachtbeil und Küchenmessern umging. Und erst der Blick, mit dem er mich jedes Mal taxierte, als wollte er mich im Geiste zu Bratenstücken zerteilen und das Fleischgewicht berechnen.
Eleonora schüttete unseren Fund auf den Küchentisch. »Ich hoffe, das reicht für heute Abend.«
Ehrfürchtig nahm der Mönch die Tartufi in die Hand, drehte sie wie Diamanten im Licht, roch daran. »Dio sia lodato! Wie lange habe ich schon keine Trüffel mehr gesehen! Signora, mein Kompliment. Und natürlich Dank an die Hauptpersonen.« Er machte uns gegenüber eine spöttische Verbeugung. »Nie werde ich diese beiden Künstlerschweine zu Würsten verarbeiten, ich schwöre es!« Er lachte erneut und klatschte in die Hände. »Ein Festmahl, ein Galadiner, wie unsere feinen Gäste sagen würden. Dieser Abend ist schon jetzt unvergesslich.«