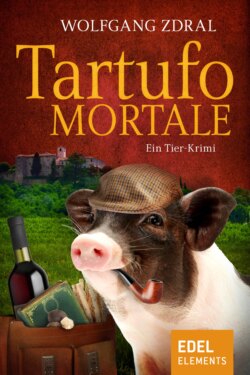Читать книгу Tartufo mortale - Wolfgang Zdral - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеDottore Plisano war ein Arzt, der seinen Ruhestand genoss und nur noch gelegentlich frühere Patienten betreute. Dazu gehörte der Abt, den er einst von einem Magengeschwür geheilt hatte. Früh am nächsten Morgen kam er im Kloster an und wurde von Aviano umgehend in Stephanus’ Zimmer geführt, gefolgt von seinen Mönchen und von uns. Wir nutzten einfach die allgemeine Prozession in den ersten Stock und überließen es dem Abt, sich für unsere Anwesenheit beim verduzten Dottore zu entschuldigen. Die Fenster standen offen, es roch nach Scheuermilch. Der Stuhl neben dem Bett war an den Tisch gestellt worden. Die Schranktür war nur angelehnt, ich war mir sicher, wir hatten sie geschlossen. Das Tablett mit dem Teller und dem Glas fehlte. Plisano setzte seine Brille auf. Er untersuchte die Kopfverletzung, die Augen des Toten, schaute in den Mund, schob das Hemd nach oben und besah sich die Haut. »Irgendwelche chronischen Krankheiten?«
»Unser Bruder hatte es am Herzen. Sein Kreislauf machte ihm Beschwerden und er konnte nicht vom Laster des Rauchens lassen«, sagte der Abt.
»Die Wunde am Schädel ist nicht so tief, als dass sie hätte mortal sein können. Ansonsten passen die Symptome«, sagte der Arzt. »Atemstillstand. Herzversagen. Ich stelle Ihnen einen Totenschein aus. Den Zeitpunkt des Ablebens schätze ich auf 22 Uhr. Euer Mitbruder machte körperlich noch einen ganz rüstigen Eindruck. Mein Beileid.«
»Danke, Dottore. Wir laden Sie gerne zu unserer Andacht ein.« Aviano führte Plisano zur Tür.
»Ich muss wieder nach Hause. Der Garten, wissen Sie.« Der Dottore wandte sich an die Mönche. »Nochmals mein Beileid für den schmerzlichen Verlust.« Er ging die Treppe hinunter. »Haben Sie übrigens gehört, in der Gegend sollen sich Landstreicher herumtreiben. Die Frau eines Bauern im Tal hat es mir erzählt.«
»Landstreicher? Was sollten die hier oben in den Bergen?« Aviano schüttelte den Kopf. »Die einzigen Fremden sind unsere Gäste.«
Im Kreuzgang hatten sich die Mönche versammelt, sie unterhielten sich mit gedämpften Stimmen.
»Was ist, liebe Fratelli? Zu viel Reden ist des Verdrusses Anfang, predigte der heilige Benedikt.« Aviano sah jeden Einzelnen an. »Die Arbeit wartet. Ans Werk.«
»Wir haben einen der Unseren verloren. Einen lieben Menschen«, sagte Gabriel. »Sollen wir da einfach zur Tagesordnung übergehen?«
»Genau, einen Mitbruder«, echote Lavello. Die Mönche nickten.
»Das weiß ich. Er lag mir genauso am Herzen wie euch«, sagte Aviano. »Selbstverständlich werden wir gebührend von Stephanus Abschied nehmen. Ich spüre Unruhe bei euch, deshalb wollen wir uns im Konvent treffen und reden.«
Der Abt ließ eine Glocke läuten, und zehn Minuten später drängten sich die Mönche in den Versammlungsraum, der sich im Kreuzgang an die Kirche anschloss. Ich wollte gerade durch die Tür schlüpfen, als Gabriel mir in den Weg trat. »Stopp. Zugang nur für Mitglieder des Konvents. Schweine haben hier drin nichts zu suchen.«
Tettamonti trat hinzu, beugte sich zu mir hinunter und tätschelte meinen Rücken. »Die Regel gilt nur für Menschen, Tiere sind davon ausgenommen. Ihr seid nicht minder Gottes Geschöpfe. Wir Menschen sollten uns nicht so überlegen fühlen, schließlich will der Allmächtige, dass alle Lebewesen gleich behandelt werden.«
»Deswegen isst unser Mitbruder auch kein Fleisch«, sagte Habiatus zu Gabriel. »Er meint es ernst. Wie die Einsiedler in der Wüste.«
»Lass das Schwein herein. Es kann eh nicht verraten, was wir besprechen. Wir haben immerhin den heiligen Antonius als einen unserer Schutzheiligen. Antonius ist zugleich der Beschützer der Schweine. Deshalb stehen wir in der Pflicht, diese Tiere ebenso zuvorkommend zu behandeln.« Tettamonti gab mir den Weg frei, und ich grunzte ihm anerkennend zu. Dieser Mönch war mir sympathisch, endlich einer, der uns den nötigen Respekt entgegenbrachte.
Ich verdrückte mich in eine Ecke. Die Fratelli nahmen auf den Bänken an den beiden gegenüberliegenden Wänden Platz, Aviano saß auf einer Art Thron in der Mitte. Ich dachte über Tettamontis Worte nach. Wieso nur verbreiteten die Menschen immer noch das Märchen von Antonius dem Großen, dem Heiligen, der den Dämonen trotzte, die Klöster erfand und die Schweine beschützte? In Wirklichkeit haben die Schweine das Mönchstum erfunden. Präzise gesagt, die Sau Helena, die im 3. Jahrhundert nach Christus in Mittelägypten am Nil lebte. Jedes Tier, jeder Frischling kennt diese Geschichte von Helena, der tugendhaften Sau, die die Menschheit auf den Weg der Meditation und der Askese brachte und doch bei dieser Spezies namenlos blieb, obwohl sie Denkmäler, ja Wallfahrtskirchen verdient hätte.
Um das Jahr 270 war es, als Helena bei ihren Streifzügen durch die Gegend auf Antonius stieß, den 20-jährigen Sohn eines reichen, christlichen Landwirts. Da sah der Jüngling Helena, mit nichts als einem ausrangierten Sackleinen zum Schutz gegen Sonnenbrand bekleidet und genügsam Gräser kauend.
»Sieh dieses Tier«, sagte Antonius zu sich. »Es braucht nur Gräser, Luft und Wasser zum Leben und ist doch glücklich. Ich will es diesem Schwein nachmachen.« Sprach’s und verkaufte all sein Hab und Gut und folgte Helena in die Wüste. Beide aßen dieselben Früchte, tranken aus denselben Brunnen. Helena machte aber zur Bedingung, dass Antonius ähnliche Kleider tragen solle wie sie und sich nach dem Vorbild der Schweine nicht die Haare schneiden durfte. Deshalb sah er bald so aus, wie ihn die Menschen von den Bildern her kennen: mit Bart und langen Haaren, das Gesicht gealtert und gegerbt durch Wind und Wetter.
Doch Antonius vertrug die Kaktusfrüchte und die Gräser nicht, obwohl ihm Helena regelmäßig den Bauch massierte und Heilkräuter aufbrühte. Er bekam Fieber, sprach im Delirium zu Helena: »Verschwinde, Dämonin, du Fratze der Unterwelt, du schwarzes Wesen der Hölle!«, und wälzte sich auf seiner Bastmatte. Am nächsten Tag rief er, das Gesicht gerötet, Helena zu sich: »Komm zu mir, holde Maid, schönste Frau Ägyptens, Stern des Himmels, komm, süße Frucht und lass dich pflücken!« Helena wusste nicht mehr, wie sie dem Kranken helfen sollte, und legte sich zu ihm. An dieser Stelle werden die historischen Berichte etwas unscharf. Jedenfalls stand Antonius am nächsten Morgen auf, gestärkt und wieder vollkommen gesund. Er marschierte mit Helena zu einer Festungsruine, wo beide einen gemeinsamen Hausstand gründeten.
Schon bald sprach sich die Kunde von dem Eremiten herum, Menschen aus der Gegend strömten zu Antonius und verlangten Rat und Hilfe. Helena hielt sich im Hintergrund, reichte nur manchmal ihren Kräutersud, der Kranke schnell wieder heilte. Die Wunder von Helenas Kräutermedizin sprachen sich herum, Antonius bekam Zulauf von anderen Eremiten, die bei ihm wohnen wollten. Da verließ Helena ihren Antonius und dachte sich: »Er kann jetzt allein auf sich aufpassen.« Antonius aber versenkte sich aus Verzweiflung in Gebete, er bat seine Glaubensbrüder, bei ihm zu leben, wohl auch, weil er jetzt niemanden mehr hatte, der ihm den Haushalt führte. So entstand der erste Orden. Spätere Generationen von Menschen konnten den Gedanken nicht ertragen, dass eine Sau die Gründerin der Männerklöster war, und schrieben die Geschichte um. Aber diese freche Fälschung gelang nicht vollständig – noch immer zeigen die Bilder und Statuen des heiligen Antonius zugleich Helena, die gute Seele und treibende Kraft.
Abt Aviano plagten in diesem Moment andere Sorgen. »Liebe Fratelli«, begann er. »Lasst uns im Stillen gedenken unseres Stephanus.« Er senkte seinen Kopf. Einige Minuten verharrten die Mönche regungslos. Der Abt hob die Hand. »Morgen wollen wir einen Gedenkgottesdienst für den Verstorbenen abhalten. Die Beerdigung wird im Anschluss daran stattfinden. Selbstverständlich arbeiten wir bis dahin normal weiter – wir haben Gäste.«
»Aber wir sind fast nur noch für die Besucher da«, wandte Tettamonti ein. »Wir treten die heiligen Vorschriften mit den Füßen.«
»Genau, die Fremden nehmen uns in Beschlag«, stimmte Gabriel ein, »die machen sich bei uns breit. Selbst unser Schlaftrakt ist nicht mehr vor ihnen sicher. Von Klausur und stiller Einkehr kann keine Rede sein.«
Habiatus hob die Stimme. »Wacht auf, liebe Mitbrüder. Wir leben nicht mehr im Mittelalter. Die Zeiten haben sich geändert. Andere Klöster beherbergen schon längst zahlende Besucher. Wir müssen unseren Glauben durch ein paar Gäste nicht erschüttern lassen.«
»Bei mir standen schon zweimal diese ... diese Gäste im Zimmer«, hob sich Gabriels Stimme über die anderen. »Ohne anzuklopfen. Ich war gerade dabei, mich anzuziehen. Wie ein Tier im Zoo kommt man sich da vor.«
»Denkt an die Regel des heiligen Benedikt, Kapitel 53«, sagte Aviano. »Da heißt es: Alle Fremden, die kommen, sollen aufgenommen werden wie Christus; denn er wird sagen: Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen.« Der Abt stand auf. »Ihr seht also, liebe Fratelli, unser Ordensstifter hat bereits die Wurzeln für den herzlichen Empfang von Gästen gelegt.«
»In aller Demut – in den Regeln steht aber auch, der Abt müsse allen Gästen die Füße waschen«, sagte Tettamonti.
Für einen Augenblick rang Aviano mit der Fassung. »Das, ähh, ist mehr symbolisch gemeint. Im 6. Jahrhundert herrschten andere Bedingungen als heute.«
»Einen Hotelbetrieb kannten die ersten Gemeinschaften aber sicher auch nicht«, sagte Gabriel. »Oder Frauen im Refektorium und bei den Andachten. Frauen!«
Aviano sah ihn an. »Eines hat sich jedenfalls über die Jahrhunderte niemals geändert. Der Abt ist für die Gemeinschaft verantwortlich. Sein Wort gilt. Oder sieht jemand das anders?«
Schweigen. »Liebe Fratelli.« Aviano tauchte seine Worte in Honig. »Ich verstehe euren Unmut. Wie oft habe ich zu Gott gebetet, er möge mir ein Zeichen senden, was ich tun soll, wie ich unsere Gemeinschaft zusammenhalten kann. Eines Nachts kam die Eingebung: Nimm Gäste auf! Ich danke dem Herrn für seinen Wink. Das ist für mich Auftrag und Bürde. Ich zähle auf euch. Nur gemeinsam, mithilfe des Allmächtigen, meistern wir unsere Schwierigkeiten und führen das Kloster zu neuem Glanz. Dem heiligen Benedikt würde es gefallen. Und was die Besucher angeht«, Aviano machte eine Pause. »Das sind verirrte Schäflein. Habt Nachsicht. Wir wollen sie auf den Pfad der Tugend und der Ehrfurcht führen, zur Herde des Herrn.«
»Amen«, tönte es aus den Reihen der Mönche.
Der Abt fuhr herum, unsicher, ob sich jemand einen Scherz erlaubt hatte. »Ich bitte euch, helft mit. Für uns alle ist die Lage ungewohnt. Aber ich verspreche euch, sobald wir die Arbeit im Griff haben, wird alles besser werden.«
Nach einem Abschlussgebet zerstreuten sich die Mönche. Ich nahm einen Seiteneingang zum Hof, der sich nach Kirche und Refektorium anschloss. Dort, zwischen Gemüse- und Kräuterbeeten, standen die Gästehäuser. Eines davon bewohnten Caruso und ich, Eleonora sei Dank, die sich mit ihren Wünschen beim Abt durchgesetzt hatte. Ich betrat meine Wohnung, ein improvisiertes Zuhause, nicht zu vergleichen mit meinem Domizil im Piemont, aber immerhin. Ich goss mir aus dem Krug einen Schluck Rotwein aus den Colli del Trasimeno in meinen Porzellanteller, Traubensorten Sangiovese und Gamay, fruchtig, jedoch ohne die Intensität des Abgangs, wie ich es vom Barolo kannte. Es bedurfte einer hitzigen Diskussion meiner Padrona mit dem Cellerar, bis er mir eine Tagesration von zwei Krügen zugestand, wenn auch bislang nur schlichte Qualitäten. Dabei roch ich es ganz genau: Habiatus hortete edlere Tropfen, sein Atem verriet es, wenn er aus dem Vorratskeller kam.
Dazu nahm ich vom anderen Porzellanteller einen Happen von den Artischocken in Thymianöl, ein wunderbarer Zweiklang aus würzig und herb. Das Ciabatta-Brot kaute ich ausgiebig, es reinigte meine Zunge und machte sie bereit für den nächsten Gang – ein Stück Ziegenkäse aus Rohmilch. Zum Abschluss knabberte ich einige Cantuccini und dankte im Stillen dem Cellerar, hatte er doch das Mandelgebäck selbst hergestellt – ich schmeckte Ei und Orangenschale heraus – und sich nicht mit Massenware aus dem Supermarkt begnügt, die mit Cantuccini genauso viel zu tun hatte wie Nikoläuse mit Ostern. Ich spürte, wie die Müdigkeit in mir hochkroch, ließ mich auf die Kissen fallen, drehte mich zweimal hin und her und beschloss, doch mein Bett im Schlafzimmer aufzusuchen. Mit Schwung sprang ich auf mein Lager, eine offene Pferdekutsche mit Lederpolstern, die Holzräder fehlten. Weiß der Himmel, wo die Mönche dieses Gefährt aufgetrieben hatten. Eine Decke aus Schafswolle verbreitete Kuschelwärme. Ich dachte an Cleopatra, meine Freundin zu Hause, an unser letztes Rendezvous auf meinem Sofa. Ihr Duft von Löwenzahn und Gänseblumen, ein Reiz, lang und intensiv. Wie sie sich an mich schmiegte, ich ihr Ohr liebkoste und Dinge hineinflüsterte, die mir später unsinnig vorkamen. Nun ja, wozu einen Frauen so bringen können. Wie wir unsere Nasen aneinanderwetzten und tastend und fühlend die Aromen des anderen einsogen, als wäre es das letzte Mal. Wie sie mir über die Flanke strich, und jede ihrer Berührungen einen Schauer in mir auslöste wie Sonnenstrahlen nach einem Bad im Fluss. Wie wir unsere Füße ineinander verhakten und den Verstand treiben ließen. Nur wir beide, alles vergessen, das Sofa und die Zeit und die Welt um uns herum. Wie unser Atem im Gleichklang ging, wir das Blut in den Adern des anderen spürten – oder war es unser eigenes? Und wie wir dann die Augen schlossen und unseren Sinnen nachgaben, zögernd erst, dann ungeduldig. Nur wir beide ...
»Hallo.« Eine Stimme. Meine Cleopatra. War ich eingeschlafen? Ich weigerte mich, die Augen zu öffnen, wollte die süße Erinnerung noch ein wenig auskosten, den Augenblick hinauszögern, in dem mich die Realität wieder einfing. Wie ein Karamellbonbon, das man im Mund behält in der Hoffnung, der Geschmack möge sich für immer festsetzen.
»Bist du wach?«
Der Duft von Lindenblüten. Nein, es war nicht Cleopatra. Es blieb mir nichts anderes übrig, ich streckte mich und gähnte. Tiffany sah mir direkt in die Augen. Hinter ihr Caruso.
»Hast du geträumt? Kein Wunder bei diesem Bett.« Sie betrachtete die Kutsche. »So eines hätte ich auch gerne. Ich muss im Stall schlafen. Auf Heu. Soll ich mal zum Probeliegen kommen?« Mit den Hufen testete sie die Decke. »Sieht kuschelig aus.«
War das ein Flirt? Ein Angebot? Ein Späßchen? Bei Frauen wusste ich nie so genau, wie sie es eigentlich meinten. Oder was sie eigentlich meinten. Oder warum sie etwas sagten. Ich will nicht leugnen, dass Tiffany ihre Reize hatte: dralle Schenkel, weiche Borsten, einen festen Rüssel. So manch ein Eber würde da schwach werden. Aber ich ... ich hatte meine Cleopatra. Der Junior erlöste mich schließlich von der Peinlichkeit, antworten zu müssen.
»Wir haben dich gesucht«, sagte er. »Erzähl uns die Neuigkeiten.«
Ich berichtete vom Arztbesuch und dem Treffen der Mönche. »Keiner außer Eleonora und mir glaubt an einen gewaltsamen Tod des Mönchs«, sagte ich. »Seine Kopfverletzung war wohl nicht so gravierend, dass sie zum Ableben führte. Aber der Geruch seines Trüffelessens hat mich nachdenklich gemacht, der war so sonderbar, so etwas habt ihr noch nicht gerochen. Meine spontane Vermutung war, dass da vielleicht jemand mit einer Substanz nachgeholfen hat. Könnte doch sein. Ein Mittelchen, das für das schwache Herz zu viel war.«
»Aber warum ...?« Caruso vollendete seinen Satz nicht.
»Genau das müssen wir herausfinden«, sagte ich.
»Ich glaube ja an Mord«, entgegnete der Junior im Brustton der Überzeugung.
»Was, was ... meinst du damit: Mord?« Tiffanys Stimme schnellte in die Höhe. »Soll ... soll das heißen, jemand aus dem Kloster könnte Stephanus umgebracht haben?«
Wir nickten.
»Und die Beweise? So nennt man das doch für gewöhnlich – Beweise.«
Damit hatte Tiffany genau die Schwachstelle getroffen. Bislang war meine Theorie nichts als ein wackeliges Gebäude aus Spekulationen.
»Mach dir keine Gedanken, Tiffany, die Beweise werden wir schon noch finden«, sagte Caruso, und ich musste über seinen schulmeisterlichen Ton schmunzeln. »Dafür haben wir unsere Spürnasen.«
»Spürnasen. Oho!« Tiffany war nicht zu beruhigen. »Und wie wollt ihr das anstellen, ihr zwei Spürnasen? Die Polizei anrufen und grunzen: Hallo, wir sind zwei Schweine im Kloster, zwei schlaue Detektive, wir glauben, ein Mönch wurde umgebracht. Kommen Sie bitte schnell und verhaften den Mörder. Wer das ist? Wissen wir nicht. So in die Richtung etwa?«
»Reg dich nicht auf«, sagte ich. »Wir stehen zwar erst ganz am Anfang unserer Ermittlungen, wissen aber immerhin bereits jetzt bedeutend mehr als die Mönche. Vergiss nicht, wir haben bereits im Piemont erfolgreich einen Täter überführt. Und zwei Morde aufgeklärt, an meinem Padrone und dessen Mutter.«
»Ich soll mich nicht aufregen, wenn du daherredest wie ein Commissario? Ermittlungen. Du solltest dich selber hören!«
»Sollten wir falschliegen und keine Beweise für unsere Indizien finden, hören wir gleich wieder auf. Versprochen«, sagte ich. »Sollten wir allerdings richtigliegen, ist es unsere Verantwortung, den Täter nicht frei herumlaufen lassen. Du musst nur einen Blick in die Geschichte werfen, um den moralischen Auftrag der Schweine zu verstehen. Wie oft ist es nicht ein Schwein gewesen, das den Kurs der Menschheit begradigte. Darüber hinaus stört es mich einfach, dass Trüffel in Verdacht geraten, ein Leben ausgelöscht zu haben. Tartufi verlängern das Leben.«
Das schien Tiffany einzuleuchten. »Macht nur schnell, damit eure Hirngespinste ein Ende haben. Lasst euch vor allem nicht erwischen. Sonst könnte eurem Sonderstatus im Kloster ein baldiges Ende drohen.«