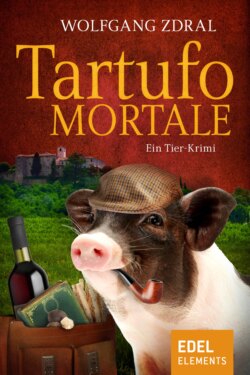Читать книгу Tartufo mortale - Wolfgang Zdral - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеEs hatte sich schnell herumgesprochen, dass heute Trüffel auf der Speisekarte standen. Bereits eine Viertelstunde vor acht drängten sich die Gäste im Speisesaal. Um diese Zeit begann das traditionelle Nachtessen der Benediktiner, das Komplet. Normalerweise aßen die Mönche schweigend. Aber seitdem die heiligen Mauern Besucher beherbergten, hatte Aviano extra Consuetudines aufgestellt. Die von den Ordensvorschriften abweichenden Regeln erlaubten den Klosterbrüdern, sich mit den Fremden zu unterhalten, und mit Genehmigung des Abtes durften sie sich sogar zu ihnen setzen.
Die Tische im Refektorium waren u-förmig angeordnet. Quer an der Stirnseite stand der Tisch für die Mönche, grob gezimmert, aus blankem Holz. Die Längsseiten des Saals wurden von zwei gleich großen Tischen eingenommen, die parallel zueinander standen. Die Ausstattung war durchweg schlicht: ungepolsterte Stühle für die Gäste, Bänke für die Mönche, Kreuze und ein Bild von Jesus mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl als einziger Schmuck für die Wände.
Die Gäste standen in kleinen Gruppen zusammen und hielten Gläser in der Hand – die meisten hatten sich bereits vom Tischwein einen Aperitif genehmigt, dem Geruch nach war es ein Trebbiano. Die Stimme Battistinis übertönte die anderen Gespräche. »Als ich letztes Jahr im ›Eden Roc‹ am Cap d’Antibes abgestiegen bin, gab’s nicht mal frische Blumen aufs Zimmer«, dröhnte es durch den Raum. »Ich musste mich auf ein Engagement in Paris vorbereiten, und dann so was. Nie wieder. Nie wieder, sage ich. Du erinnerst dich doch noch an den Schuppen, Dolores?«
Seine Frau, eingezwängt in ein Kleid aus roter Seide, nickte geistesabwesend. Neben ihr blickte eine zierliche Frau über den Rand ihrer Brille den Tenor an. Ihre Figur steckte in Jeans und Sweatshirt, das glatte braune Haar war zu einem Zopf nach hinten gebunden. Sie hatte sich bereits vor einer Woche einquartiert. Alleinstehend sei sie, munkelten die anderen, ihr Freund habe sie vor zwei Wochen verlassen. Eine Buchhändlerin aus Triest mit Namen Melissa Fini. »Signor Battistini, welche Komponisten sind denn Ihre Spezialität?«, fragte sie.
Der Sänger legte eine Hand auf ihre Schulter. »Signora, ich beherrsche viele Partien. Aber ... «, er klopfte sich auf seine Brust, »... hier drin lodert ein großes Feuer.« Er machte eine Pause. »Meine Liebe gehört Giacomo Puccini. Ein begnadeter Komponist des 19. und 20. Jahrhunderts – der Letzte der ganz Großen! Mozart wird überschätzt. Verdi sowieso. Puccini gehört die Krone. Schon sein Vater und Großvater schrieben Stücke. Puccini hatte es im Blut, denken Sie nur an ›Madama Butterfly‹, ›Turandot‹, ›Manon Lescaut‹, ›La Bohème‹ oder ›Tosca‹.« Er stimmte eine Arie an, die ersten Takte des berühmten Liedes »Nessun dorma« aus »Turandot«:
Niemand schlafe! Niemand schlafe!
Auch du, Prinzessin, in deinem kalten Zimmer
Siehst die Sterne, die heben vor Liebe und Hoffnung!
Die Anwesenden verstummten und lauschten. Nur Dolores Battistini studierte demonstrativ das Bild an der Wand.
»Bravo, Maestro, da capo!« Melissa klatschte, die anderen fielen ein. »Bitte noch ein Lied, Maestro, bitte!«
Battistini lächelte, holte ein Taschentuch aus der Tasche und tupfte sich damit die Stirn ab. »Wenn die Anwesenden es wünschen und mich eine schöne Frau darum bittet, will ich diesen Wunsch gern erfüllen.«
Er sang eine Arie aus »Madama Butterfly«. Caruso schüttelte den Kopf. »Verdi soll nichts taugen? Paah! Hör dir nur an, wie gepresst seine Stimme in den hohen Tonlagen klingt. Wie gekneteter Brotteig. Und die schlampige Modulation. Hörst du es? Genuschel. Jawohl Genuschel! Mich wundert, was die Menschen an dem finden.«
Ich gab ein unbestimmtes Grunzen von mir. Wir hatten uns in einer Ecke des Saals niedergelassen, nahe des Seiteneingangs. »Dein Gesang gefällt mir viel besser«, brummte ich.
»Wirklich? Sagst du das auch nicht nur so?« Caruso klang versöhnlicher. »Menschen haben einen furchtbaren Geschmack. Soll ich ihnen was vorgrunzen, damit sie klassische Lieder schätzen lernen?«
»Ähh, im Moment ist das keine gute Idee, glaube ich.«
»Na dann später.«
Die Mönche kamen von ihrem Kirchgang zurück, lächelten den Gästen zu und nahmen an der Tafel Platz. Aviano räusperte sich, und das Reden verstummte. Der Abt sprach ein Tischgebet, segnete das Essen. Der Mönch Gabriel trug Glaskrüge mit Wasser und noch mehr Wein herein, unterstützt von einer schwarzhaarigen Frau mit Kopftuch und Schürze. Orchidea Lucca, die Frau des Hausmeisters Salvatore. Das Ehepaar stammte aus Sizilien und hatte sich vor einigen Monaten auf eine Anzeige hin bei den Mönchen beworben. Zuvor hatten sie eine Osteria in Palermo betrieben, wegen finanzieller Schwierigkeiten aber aufgegeben. Orchidea half beim Reinigen und Bettenmachen in den Gästezimmern und ging Habiatus in der Küche zur Hand. Salvatore erledigte Einkäufe und Botenfahrten, reparierte Wasserhähne und quietschende Fensterscharniere.
Eleonora, die dem Koch bei den Vorbereitungen assistiert hatte, brachte Körbe mit frisch gebackenem Ciabatta-Brot und Schalen voller Oliven. »Wie geht es Stephanus?« Sie stellte einen Korb auf den Tisch der Mönche. Der Abt sah hoch. »Lavello hat ihm den Verband gewechselt und meint, dass sich der Mitbruder schon bald erholen wird. Stephanus hat den ganzen Nachmittag geschlafen. Ich werde mich morgen mit ihm unterhalten.« Aviano schob sich eine Olive in den Mund, hielt inne. »Wie kann ich nur so nachlässig sein! Stephanus muss ja einen Mordshunger haben. Ich werde ihm eine Portion Ihres Trüffelgerichts bringen lassen. Wenn er schon nicht an diesem Gaumenschmaus teilnehmen kann.« Aviano erhob sich und verschwand in der Küche.
Gemurmel setzte ein, aus dem Murmeln wurde Reden, und schon bald erfüllten Stimmen und Gelächter den Raum. Orchidea kam kaum mit dem Abräumen und dem Nachfüllen der Weinkrüge nach.
Nach den Regeln des heiligen Benedikt war Wein zum Essen erlaubt, hatte ich nachgelesen, wenn auch nur eine Hemina, eine Ration, die einem Viertel Liter entsprach. Der Ordensgründer kannte die Schwächen seiner Mitbrüder: Wir sollten uns wenigstens darauf einigen, nicht im Übermaß zu trinken, sondern weniger, hieß es in den Vorschriften. Denn der Wein bringt sogar die Weisen zum Teufel. Aviano hatte jedoch von seinem Recht als Abt Gebrauch gemacht und Sonderrationen genehmigt, die ganz in der Tradition der Mönche Caritas und Justizia hießen.
Überhaupt schienen einst heilige Benediktinerrituale außer Kraft gesetzt. Die Mönche durften sich jederzeit mit ihresgleichen oder den Gästen unterhalten – nicht nur beim Essen. Man soll der Schweigsamkeit zuliebe bisweilen sogar auf gute Gespräche verzichten. Umso mehr müssen wir wegen der Bestrafung der Sünde von bösen Worten lassen, so steht es geschrieben. Mag es sich also um noch so gute, heilige und aufbauende Gespräche handeln, vollkommenen Jüngern werde nur selten das Reden erlaubt wegen der Bedeutung der Schweigsamkeit. Auch die schöne Sitte des Vorlesers, der während des Essens Erbauliches aus der Bibel rezitierte, hatte der Abt offenbar ebenso gestrichen wie die Gepflogenheiten früherer Zeit, beim Essen nur sparsam aufzutragen. So bekamen Mönche einst zwischen Ostern und Pfingsten zwei Mahlzeiten täglich, vom September bis zur Fastenzeit gar nur eine, bestehend meist aus Brot, Brei, etwas Obst und Gemüse.
Eleonora setzte sich neben Dominik Hellenbart, den Geschäftsführer einer Werbemittelfirma aus München. Er war allein angereist. Jeder im Kloster war im Bilde, welchem Gewerbe Hellenbart nachging, hatte er doch bei seiner Ankunft jedem seine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Sogar im Opferstock fanden Mönche seine Karte. Er beriet Unternehmen bei Werbefragen, entwarf Reklamekonzepte, lieferte Kalender, Kugelschreiber und Aktentaschen, die sich Firmen individuell bedrucken lassen konnten. Er plante, Armbanduhren auf den Markt zu werfen, erzählte er, in fünf Sprachen programmierbar, auf Wunsch wurde der Name des Unternehmens zu jeder vollen Stunde ausgerufen. Aber anscheinend stieß er damit auf Widerstand bei seinen Mitarbeitern, »den undankbaren Angestellten, die meine Ideen und Entwürfe nicht verstehen«. Seine Frau sei momentan unpässlich, berichtete er Eleonora, sie musste zur Kur, deshalb habe er sich eine Auszeit von zu Hause genommen, hier könne er nachdenken, die Konkurrenz schlafe nicht, und er wolle den Kopf frei bekommen für neue Ideen. Eleonora war froh, als der erste Gang serviert wurde und Hellenbart – »nennen Sie mich Dominik« – mit anderem beschäftigt war. Es gab Rucolasalat mit gehobeltem Pecorinokäse, dazu am Kohlenfeuer geröstete Pinienkerne und Tomaten, eingelegt in einer Balsamico-Sauce. Ich fand die Kombination geradezu klassisch, die Kerne bildeten mit dem Essig ein süßsaures Duett, das der Zunge schmeichelte.
Teller klapperten, Gläser klirrten, Messer kratzten übers Porzellan, und vorübergehend erstarben sogar die Gespräche. Die Mönche wagten ab und zu einen Blick auf die Gäste, senkten die Köpfe aber wie ertappte Schüler, sobald einer der Gäste es bemerkte. Der zweite Gang bestand aus einer Tomatensuppe mit Mascarponecreme, bestreut mit frischem Kerbel und Basilikumblättern. Habiatus stellte uns je zwei Töpfe vor die Tür – für uns hatte er zusätzlich noch Karotten und Zwiebeln hineingeschnitten. Das fand ich entschieden zu viel des Guten, die Zwiebeln dominierten die Suppe und raubten den anderen Zutaten die Entfaltungskraft. Schade drum. Den Wein hatte er mit Wasser verdünnt, ein Frevel, so konnte sich der Geschmack der Trauben einfach nicht entwickeln. Wenn schon Wasser, dann in einem extra Gefäß. Man hörte, wie es Caruso schmeckte. Ich ermahnte ihn, nicht zu schmatzen, das gehörte sich nicht für ein Schwein. Doch zu spät. Melissa Fini sah von ihrem Teller auf, deutete auf uns und sagte: »Muss das sein?«
Die Padrona lächelte zurück, ihre Stimme kühl: »Keine Sorge, meine Tiere kommen ohne Lätzchen aus.«
Das Hauptgericht inszenierte der Koch mithilfe von Eleonora. Zuerst ging die Padrona mit einer Platte voller Tartufi von Tisch zu Tisch, von Stuhl zu Stuhl, und ließ jeden staunen und riechen. Einige nahmen einen Pilz in die Hand und hoben ihn prüfend an die Nase – ich erwartete fast, dass jemand eine Lupe hervorholte und den Edelstein untersuchte. Aber es blieb bei vielen Ahhs, Ohhs und Zungenschnalzen, und am Ende applaudierten die Gäste. Orchidea und zwei Mönche trugen Schüsseln mit dampfenden Spaghetti herein, übergossen mit einer Butter-Salbei-Soße. Als jeder eine Portion auf seinem Teller hatte, traten Eleonora und Habiatus wieder in Aktion und hobelten ordentliche Häuflein Trüffelscheiben auf jeden Teller. Nochmals Bewunderungsrufe. Der Abt wünschte eine gesegnete Mahlzeit, und die nächste halbe Stunde gehörte jedem allein. Nur Melissa Fini stocherte in den Nudeln, schob schließlich den Teller von sich. »Nichts für mich. Zu extremer Geruch. Mir hätte Parmesan gereicht.« Mich schauderte. Die Arme – sie wusste gar nicht, was ihr gerade entging.
»Darf ich?« Ohne eine Antwort abzuwarten, schaufelte sich Dominik Hellenbart ihre Trüffelscheiben auf seinen Teller. »Wäre doch schade, wenn das im Schweinekübel landen würde.« Für einen Moment war ich versucht, ihn mit einem Rempler zurechtzuweisen, beherrschte mich aber und verbuchte das unter Ignoranz – als würden Schweine aus Mülleimern essen! Schließlich war es der Eber Valerian, der am Hofe Karls des Großen die Sitte durchsetzte, das Menü in verschiedenen Gängen zu servieren und dazu Stofftücher als Unterlage zu verwenden. Später entwickelten die Menschen aus seiner Idee die Servietten. »Bedienen Sie sich ruhig«, sagte Melissa im Nachhinein. Ironie hüllte ihre Worte in Watte. »Dafür gebe ich Ihnen was von meinem Nachtisch ab«, erwiderte Dominik und versuchte, einnehmend zu lächeln.
An uns dachte offenbar niemand. Wer hatte denn für die Leckerei gesorgt? Es war immerhin Carusos erster Trüffelfund. Typisch – kaum bekamen die Menschen Wertvolles vorgesetzt, vergaßen sie alle Solidarität und mutierten zu Egoisten. Aber schließlich brachte Eleonora zwei Teller und stellte sie uns vor die Nase. »Lasst es euch schmecken, ihr habt es euch verdient!«
Den lauwarmen Mohnstrudel begleitete ein Likörwein, den Habiatus zur Feier des Tages aus den Vorräten im Keller geopfert hatte. Für meinen Geschmack war der Wein zu unausgewogen, er schmeckte zu zuckrig, die Balance mit der Säure fehlte. Teller mit Ziegenkäse kreisten, kräftig und würzig, ganz wie er sein sollte. Dolores Battistini fragte nach Schlagsahne, begnügte sich dann aber mit einem Espresso. Gabriel kam herein, blass, ohne uns zu beachten, trat schnellen Schrittes an den Tisch seiner Mitbrüder. Er beugte sich zu Aviano hinunter und flüsterte ihm etwas ins Ohr. »Was?«, rief der Abt unbeherrscht, fing sich aber wieder, sprang auf und winkte Lavello zu sich. Mit ernster Miene rauschten die beiden aus dem Refektorium.
Da stimmte etwas nicht. Ich stieß Caruso an. Mit Gesten versuchte ich Eleonora auf uns aufmerksam zu machen, was mir allerdings erst beim vierten Anlauf gelang. »Was ist los?«, fragte sie, als sie auf uns zukam.
Statt zu antworten folgte ich dem Abt. Wir sahen, wie er mit Lavello den Kreuzgang umrundete und in der Tür verschwand, die wir heute bereits einmal passiert hatten – den Eingang zu den Räumen der Mönche. Die Tür war nur angelehnt, von oben hörten wir erregte Stimmen. Als wir den Gang im ersten Stock erreichten, sahen wir Licht im Zimmer von Stephanus.
Der Abt, Lavello und Gabriel standen vor dem Bett. Das Blut am Boden war weggewaschen, Zudecke und Kissen ausgetauscht, der Raum gelüftet. Auf einem Schemel neben dem Bett ein Tablett mit einem Glas und einem halb gegessenen Teller Tartufi-Spaghetti. Stephanus lag auf dem Rücken. Sein Kopfverband strahlte weiß, der Blick war zur Decke gerichtet – das Bild eines zufriedenen Patienten. Wären da nicht der verzerrte Mund und die fahle Hautfarbe gewesen.
Der Geruch verriet es mir sofort: Stephanus war tot.
Die drei Mönche hatten die Hände gefaltet. »Come Dio vuole«, murmelten sie. Der Abt bemerkte Eleonora und sagte: »Bitte warten Sie draußen. Ein Mitbruder ist von uns gegangen. Wir wollen für ihn beten.« Einige Minuten war das Zimmer erfüllt von der Litanei der Mönche, uralte Worte, ein Fürbitten für die arme Seele. An was mochte Stephanus gestorben sein? War die Kopfverletzung schwerer gewesen als gedacht?
Genau dieselben Fragen schienen Aviano zu beschäftigen. »Lavello, deine Diagnose. Warum hat es Gott gefallen, den Bruder aus unserer Mitte zu reißen?«
Lavello untersuchte den Leichnam. »Herzstillstand. Ein Infarkt, würde ich sagen. Stephanus hat nicht leiden müssen. Er war durch den Unfall geschwächt und hatte viel Blut verloren. Jedem war bekannt, dass sein Herz angegriffen war. Dazu noch sein Alter, da ist mit einem Herzinfarkt beinahe schon zu rechnen. Trotz meiner wiederholten Warnungen wollte er mit dem Rauchen einfach nicht aufhören. Armer Stephanus.«
»Hat er das Essen nicht vertragen? Vielleicht war ein Pilz schlecht? Die Tartufi ungenießbar? War das der Auslöser?«
Ich konnte kaum glauben, was ich da hörte. Ein Trüffel soll schlecht gewesen sein? Impossibile. Natürlich konnten Trüffel verderben, so wie jedes rohe Lebensmittel. Aber das passierte nur Amateuren, die nicht wussten, dass alle Tartufi frisch am besten schmeckten. Aber selbst verdorbene Exemplare waren für Mensch und Tier harmlos. Wollte der Abt etwa behaupten, ich, Leonardo, grub giftige Pilze aus? Oder Caruso? Oder Eleonora passte nicht auf? Undenkbar. Un-denk-bar. Was immer das Ableben des Mönches verursacht hatte, unsere Tartufi waren es nicht. So einen Vorwurf, wenn auch nur so dahingesagt, konnte ich nicht auf uns sitzen lassen. Das ging gegen meine Trüffel-Ehre. Diesen Verdacht galt es aus der Welt zu räumen, und mir war klar, dass wir das selber würden machen müssen.
»Ich glaube nicht. Wie gesagt, das Herz. Aber das sollte nochmals ein Arzt genau feststellen.«
»Ich werde sofort telefonieren. Wahrscheinlich erreiche ich erst morgen einen Doktor, es ist ja schon spät. So traurig der Abschied von unserem Bruder auch ist, wir brauchen die Gäste nicht damit zu beunruhigen. So etwas kommt nun mal vor. Menschen sterben. Wir wollen die anderen zu einem kurzen Gottesdienst zusammenrufen.« Sie verließen das Zimmer, schlossen die Tür. »Signora, Sie sind natürlich herzlich zu unserer Andacht eingeladen. Ihre ... Ihre Tiere können sich anders beschäftigen.«
Normalerweise pflegten Mönche ihre Andachten, die nach genau festgelegten Stunden als Liturga horarum über den Tag verteilt waren und sogar nachts und frühmorgens abgehalten wurden, nur unter sich zu zelebrieren. Das Beten bildete den Kern der klösterlichen Gemeinschaft. Die Benediktiner kannten Vigilien oder Laudes – je nach Jahreszeit und Uhrzeit galten unterschiedliche Abläufe für das Beten und Vortragen von Psalmen oder Bibelzitaten -, ein Vorschriftenwerk, komplizierter als eine italienische Steuererklärung. Aviano hatte die strenge Regel wegen der Gäste gelockert, auf Einladung oder bei den Gottesdiensten unter Tags durften sie im hinteren Teil der Kirche der Andacht lauschen.
Gemeinsam stiegen wir die Treppe hinunter. Im Kreuzgang verabschiedeten sich der Abt und seine Begleiter von Eleonora. Nachdem die Menschen verschwunden waren, wies ich zurück zur Tür. »Was, du willst da noch mal rein? Zu Stephanus?« Ich ließ einen Bestätigungslaut hören. Eleonora hatte ihre nachdenkliche Miene aufgesetzt. »Eigentlich hat uns der Abt nicht erlaubt, das Zimmer zu betreten. Schaden kann es andererseits nicht, sich den Toten nochmals anzusehen. Denn seltsam ist das plötzliche Ableben schon. Und unser Essen war sicher nicht schuld!« Das hörte ich gern.
»Untersuchen wir nun den Tatort?« Carusos Stimme überschlug sich vor Aufregung. »Jagen wir den Mörder? Wie wir es bei unserem letzten Fall zu Hause im Piemont getan haben? Ich würde gerne wieder ermitteln. Könnte mir sogar vorstellen, den Beruf eines Privatdetektivs zu ergreifen. Das ist viel aufregender, als nur im Boden nach Trüffeln zu wühlen.«
»Nicht so voreilig, mein Kleiner«, antwortete ich. »Bei dem Job würdest du schnell verhungern. Das Sterben ist an sich ein normaler Vorgang in der Natur. Bei uns genauso wie bei Menschen. Wie du weißt, holt uns Esus, der Schweinegott, nach unserem Ableben heim in den Ewigen Bauch. Die Menschen nennen es das Paradies Gottes. Ein Lebewesen verlässt die irdische Welt, das geschieht tausendfach, jeden Tag, jede Stunde. Deswegen ist das noch lange kein Mord.«
»Und wenn Gewalt im Spiel ist?«
»Auch dann ist es nicht automatisch ein Mord. Es kann ein Unfall sein. Oder Notwehr.«
»Und warum wollen die Menschen nicht in den Ewigen Bauch sondern ins Paradies?«
Seufzend hielt ich inne und erklärte dem Junior die Zusammenhänge – schließlich oblag es mir, für seine Bildung zu sorgen. Der eigentliche Ur-Gott der Menschen war der Schweine-Gott Esus, das Christentum allenfalls eine schlechte Kopie. Esus, dessen Name »der Respektierte«, »der Herr« bedeutet, ist bereits in den frühesten Darstellungen der Spezies als Eber zu sehen. Die Kelten beteten ihn an, nordische Stämme verehrten in als Gullinbursti, als Eber mit den goldenen Borsten, samt seinem Helfer Freyr. Später übernahmen die Römer den Kult leicht abgewandelt unter dem Namen Merkur, die Israeliten verehrten ihn als Propheten Joshua. Und jeder konnte sich selbst einen Reim darauf machen, woher der Jesus des Neuen Testaments seinen Namen bekommen hat ...
Eleonora unterbrach unsere gelehrte Stunde und zeigte in Richtung Tür. »Willst du da nun hineingehen oder nicht, Leonardo? Aber bitte mit Respekt vor dem Toten.«
Caruso preschte nach vorne, aber ich erwischte ihn gerade noch an seinem Schwänzchen.
»Du nicht«, sagte ich. »Drei sind zu viel, jemand könnte uns hören. Kümmere dich lieber um Tiffany.«
Der Junior wollte zum Protest ansetzen, sah jedoch meine Miene und zottelte wortlos davon.
Der Gang im ersten Stock war menschenleer. Eleonora drückte die Klinke zu Stephanus’ Zimmer hinunter, überlegte kurz und klopfte. Niemand antwortete, wir traten ein. Alles war noch so wie vor wenigen Minuten. Oder doch nicht? Mir schien, der Stuhl mit dem Tablett hatte vorher etwas näher am Bett gestanden. Aber meine Augen konnten mich täuschen. Vielleicht hatten die Mönche beim Hinausgehen den Stuhl verrutscht. Stephanus lag zugedeckt auf dem Bett. Eleonora schlug die Decke zurück. Der Leichnam war mit einem Nachthemd bekleidet, das bis zu den Knien reichte. Offenbar hatte Lavello seinem Patienten das Habit ausgezogen.
»Die genaue Untersuchung überlassen wir dem Arzt«, sagte die Padrona. »Oberflächlich betrachtet sind keine äußeren Verletzungen zu sehen, außer am Kopf.« Sie musterte die Füße des Toten. »Was ist das?«
Auf der Oberseite beider Füße, genau in der Mitte, befand sich ein Fleck. Ich sah mir die Haut genauer an. Es waren Miniaturzeichnungen, kaum zu erkennen. Tätowierungen. Die Bilder stellten links und rechts das Gleiche dar: eine stilisierte Rose. Die Anordnung erinnerte mich an die Wundmale Christi, wie ich es von alten Gemälden der Kreuzigung kannte. Was hatten die Tätowierungen zu bedeuten? An den Händen des Verstorbenen fehlten sie. Nach der christlichen Überlieferung müssten auch dort solche Symbole zu finden sein. Wollte Stephanus seine Tätowierung vor den Mitbrüdern verbergen und wählte deshalb diese ungewöhnliche Stelle? Warum sollte er das tun? Oder war es bloß eine Laune der Jugend gewesen?
»Schauen wir uns im Zimmer um.« Eleonora öffnete den Kleiderschrank. Teile einer Ordenstracht, mehrere Hemden. Zwei Paar Schuhe. In den Fächern Unterwäsche und Strümpfe, ein Beutel mit Handcreme, Seife und Zahnbürste. Handtücher, penibel gefaltet. Eleonora tastete sie mit der Hand ab. »Hallo! Was haben wir denn da?« Sie zog ein Büchlein hervor, in Leder gebunden, blätterte es durch. »Religiöse Erbauungsliteratur, vermutlich aus dem Mittelalter. Von der Sorte gab es früher viel.« Bei einer Seite blieb sie hängen. »Da steckt ein Zettel drin. Handgeschrieben.« Eleonora versuchte, die Schrift zu entziffern. »Ich muss ... unleserlich ... danach fragen. Wie ist das in Einklang zu bringen mit ... wieder unleserlich. Damit können wir nichts anfangen.« Sie steckte das Buch zurück. »Vielleicht ist der Tisch ergiebiger.« Dort lagen ebenfalls Bücher. Eine Bibel. Die Ordensregeln des heiligen Benedetto. Einzelne Seiten hatte Stephanus markiert und mit Bleistift Bemerkungen an den Rand geschrieben, etwa ein »genau« oder ein »verdrängt«, verschiedene Wörter hatte er doppelt unterstrichen und ein Ausrufezeichen dahintergesetzt. Zwischen den Büchern lagen mehrere Briefe, offenbar von der Mutter des Mönchs, die im Altersheim lebte, wie Eleonora nach dem Studium des Absenders feststellte. Sie las aus einem Schreiben vor:
Mein Lieber,
danke für Dein letztes Schreiben. Wie immer sind mir Deine Briefe eine Freude meines Herzens. Besonders, da ich weiß, wie beschäftigt Du mit Briefeschreiben bist. Ich hoffe, der Erfolg stellt sich für Dich bald ein. Bedenke aber, Dein Weg kann andere vor den Kopf stoßen. Suche Rat und Kontakt zu aufrichtigen Menschen und lass Dich nicht irreleiten.
Eleonora öffnete einen anderen Brief. »Der hier hat eine andere Handschrift.« Sie glättete das Papier.
Sehr geehrter Bruder Stephanus!
Nach Ihrem letzten Schreiben bin ich gespannt, Näheres zu erfahren. Sie gestatten meine Neugierde, aber woher haben Sie die Informationen? Es klingt nach einer gewaltigen Aufgabe. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück und Erfolg. Wenn es meine Zeit zulässt, können wir unsere Diskussionen vertiefen.
»Die Unterschrift kann ich nicht entziffern.«
Plötzlich hörten wir, wie draußen jemand den Gang entlangkam. Eleonora bedeutete mir, still zu sein. Als ob ich das nicht auch allein gewusst hätte! Die Schritte verharrten vor der Tür. Gemeinsam hielten wir den Atem an, und eine Weile geschah nichts. Dann entfernten sich die Schritte wieder. Erst nach zehn Minuten regungslosem Warten wagten wir es wieder, uns zu bewegen. »Gehen wir«, entschied die Padrona und wandte sich zum Ausgang. Ich blieb beim Stuhl mit dem Tablett und dem Teller stehen und warf einen Blick auf die leckeren Tartufi. Warum hatte Stephanus diese Köstlichkeit nicht aufgegessen? Hatte ihn der Infarkt genau in dem Moment erwischt? Ich ließ meine Nase über den Teller kreisen, wollte noch einmal den einzigartigen Duft genießen. Seltsam. Ein Fremdkörper reizte meinen Rüssel. Ich inhalierte die Luft. So rochen keine Tartufi. Ein anderer Geruch überdeckte das Aroma, fein und für Menschen sicherlich nicht auszumachen, doch unangenehm, stechend. Es war wie der Geruch aus einem Aschenbecher. Nur war keine Zigarettenasche in dem Essen zu entdecken. Stephanus war ein starker Raucher gewesen, offenbar paffte er Selbstgedrehte mit ungewöhnlichem Tabak. Dennoch irritierte mich das beizende Aroma, es passte nicht zu den Aromen, die ich in meinem Duftgedächtnis bei Tabak abgespeichert hatte.
»Hast du was entdeckt?«
Ich grunzte bejahend. Eleonora sah sich den Teller an. »Kann vielleicht nicht schaden, eine Probe mitzunehmen.« Wunderbar, es war fast, als würden wir uns ein Gehirn teilen. Ihre Beziehung mit einem Commissario wirkte sich offensichtlich sehr positiv auf ihr kriminalistisches Denken aus. Sie griff in ihre Tasche und holte ein Taschentuch hervor, legte mit Stephanus’ Gabel einige Trüffelscheiben und ein paar Spaghetti hinein, faltete es sorgfältig zusammen und steckte es wieder in ihre Tasche. »Verschwinden wir.«
Hatte etwa jemand die Pilze präpariert? Ich konnte mir nicht anders erklären, wie dieses fremde Aroma sonst an meine Tartufi gekommen sein sollte. Zumal es sich bei dem stechenden Geruch definitiv nicht um ein Gewürz handelte, das Habiatus eventuell den Spaghetti noch beigefügt haben konnte – was auch einen Frevel sondergleichen dargestellt hätte, denn Tartufi brauchten keine extra Würze. Mein Jagdinstinkt war zumindest geweckt, und an Sonnenbaden im Klostergarten war nicht mehr zu denken. Wir waren ausgezogen, den Goldenen Trüffel zu suchen, und hatten vielleicht einen tödlichen gefunden. Kein guter Start.