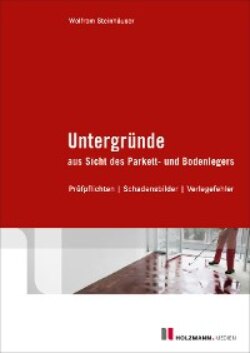Читать книгу Untergründe aus Sicht des Parkett- und Bodenlegers - Wolfram Steinhäuser - Страница 13
1.2.5 Fugenausbildung
ОглавлениеIn der Baupraxis wird die Fugenproblematik sehr stiefmütterlich behandelt, obwohl hier nicht selten eine gewisse Brisanz steckt, die besonders im Schadensfall unangenehme Folgen haben kann. Planer, Architekten und Bauleiter sind häufig der Meinung, dass die Anordnung und Ausbildung der Fugen allein Sache des Estrich-, Parkett- oder Bodenlegers ist. Dabei sind bei der Planung von Fugen Bedingungen und Einflussfaktoren in der gesamten Fußbodenkonstruktion zu beachten, die zu Bewegungen und Verformungen führen. Fugenbewegungen werden beispielsweise verursacht durch temperaturbedingte Längenänderung, Schwingungen, Vibrationen, Setzungen sowie das Quellen und Schwinden von Baustoffen. Außerdem müssen Fugen Toleranzen der Belagsstoffe ausgleichen. Handwerker können diese Bedingungen und Einflussfaktoren nur bedingt einschätzen. Deshalb heißt es im BEB-Merkblatt „Hinweise für Fugen in Estrichen, Teil 2 Fugen in Estrichen und Heizestrichen auf Trenn- und Dämmschichten nach DIN 18560 - 2 und DIN 18560 - 4“, Stand November 2015:
„Der Bauwerksplaner muss einen Fugenplan erstellen, aus dem die Anordnung und die Art der Fugen eindeutig zu entnehmen ist. Der Fugenplan ist dem Ausführenden als Bestandteil der Leistungsbeschreibung zu übergeben. Die endgültige Lage der Fugen ist vor der Ausführung durch den Planer in Abstimmung mit allen Beteiligten vor Ort festzulegen.“
Dem Parkett- und Bodenleger muss vorgegeben werden, welche Fugen kraftschlüssig zu verharzen und welche Fugen als Bewegungsfugen auszubilden sind.
In der Baupraxis sind die folgenden Faustregeln bei der Ausführung von Bewegungsfugen bekannt:
Der Planer muss „von oben nach unten“ planen. Belag und Estrich bestimmen gemeinsam die Fugenanordnung.
Beim Einsatz von elastischen und textilen Belägen sowie Parkett gibt es keine allgemeinen Festlegungen zur Feldgröße.
Das Risiko bei sehr großen Feldern ohne Fußbodenbewegungsfugen mit elastischen und textilen Belägen geht gegen null, wenn die Fläche gleichmäßig thermisch belastet wird und die Randfuge auf die maximale Ausdehnung in ihrer Breite abgestimmt ist.
Fußbodenbewegungsfugen im Heizestrich, die in den Oberbelag übernommen werden müssen, sind beispielsweise anzuordnen zwischenvom Planer festzulegenden Estrichfeldern,unterschiedlich regelbaren Heizkreisen,zwischen beheizten und unbeheizten Estrichteilflächen sowiezwischen mineralischen Untergründen und Gussasphalt.
Im Kommentar zur DIN 18356 Parkettarbeiten DIN 18367 Holzpflasterarbeiten wird vom Parkettleger gefordert, dass er bei ungenügenden Bewegungsfugen im Untergrund Bedenken geltend zu machen hat. Vom Parkettleger wird also erwartet, dass er die Anordnung, Anzahl und Ausbildung der Bewegungsfugen letztendlich kennt, plant und ausführt. Den Bauwerksplaner, aber auch den Bauherrn sollte man auf keinen Fall außen vor lassen. Gerade Bauherren möchten bereits im Vorfeld mit entscheiden, wie die Ausbildung der Bewegungsfugen in ihrem teuren Parkettboden zu erfolgen hat.
Werden Fußbodenbewegungsfugen nicht oder falsch angeordnet, nicht fachgerecht ausgebildet oder sogar kraftschlüssig geschlossen, können u. a. folgende Schäden und Mängel auftreten:
Schäden an der Fußbodenheizung
Risse und Schüsselungen im Estrich
Ablösung der Spachtelmasse und des Oberbelags
Blasen und Beulen sowie die sogenannnte Würmchenbildung im Oberbelag
Stippnähte und Stolperstellen im Oberbelag
Im Extremfall kann es zur Zerstörung der Fußbodenheizung und des Estrichs kommen. Die Folge wären der Rückbau und die Erneuerung der gesamten Fußbodenkonstruktion, verbunden mit Nutzungs- und Verdienstausfall.
Weil die Bewegungsfuge überspachtelt wurde, kam es zur Ablösung der Spachtelmasse.
Bild 1 von 2: Neuer Zementestrich auf einem Treppenpodest, an das sich ein neuer Stahlbetontreppen- lauf anschließt. Hier ist eine Bewegungsfuge anzuordnen.
Bild 2 von 2
Da keine Scheinfugen angeordnet wurden, kam es zur Rissbildung im Zementestrich.
Zu beachten sind die folgenden beiden Sonderfälle bei der Ausbildung von Bewegungsfugen. Fußbodenbewegungsfugen sind zwingend erforderlich, wenn Untergründe und Werkstoffe mit unterschiedlichen thermischen und hygrischen (feuchtigkeitsbedingten) Ausdehnungskoeffizienten mit unterschiedlicher Stabilität und unterschiedlichem Schwingungsverhalten unmittelbar aneinandergrenzen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn folgende Untergründe unmittelbar aneinandergrenzen:
Doppelböden an Hohlraumböden
Trockenestriche aus Holz oder Gips an mineralische Untergründe
Spanplatten und OSB-Platten an mineralische Untergründe
Dielung an mineralische Untergründe
Gussasphalt an mineralische Untergründe.
Der „Grenzbereich“ zwischen diesen Untergründen ist als Fußbodenbewegungsfuge auszubilden und mit geeigneten Fußbodenprofilen in den Oberbelag zu übernehmen.
Wird auf diese Bewegungsfuge verzichtet, kann es zu Aufwölbungen, Verformungen und Ablösungen im Oberbelag kommen.
Es ist Stand der Technik, dass zwischen Treppenläufen, beispielsweise aus Stahlbeton und Stahlbeton-Treppenpodesten Bewegungsfugen angeordnet werden müssen. Diese Fugen dürfen auf keinen Fall kraftschlüssig verharzt werden. Gründe sind einerseits das unterschiedliche Ausdehnungsverhalten der beiden Bauteile und andererseits das „Schwingen“ der Treppenläufe beim Begehen bzw. bei der Nutzung. Würden diese Bewegungsfugen kraftschlüssig verharzt, käme es zwangsläufig zu Abrissen im Bereich dieser Fugen, sei es im Beton als Kohäsionsabriss oder als Adhäsionsabriss zwischen dem Beton und dem Reaktionsharz. Diese Bewegungsfugen müssen mit elastoplastischen Fugenmassen geschlossen werden. Die Ausbildung dieser Fugen sollte mit dem Hersteller dieser Fugenmassen abgestimmt werden.
Scheinfugen müssen fachgerecht verharzt werden.
Kreuzprofile aus Kunststoff bzw. weich ummantelte Profile werden manchmal in Scheinfugen in den Zementestrich eingebaut, weil sie den Versatz der Risskanten beim Reißen der Sollbruchstellen verhindern und angeblich das Schüsseln des Estrichs während der Austrocknung minimieren. Das kraftschlüssige Schließen der Scheinfugen mit einem solchen Kreuzprofil ist nur bis zum waagerecht eingebetteten Schenkel des Kreuzprofils möglich. Die Erfahrungen haben immer wieder gezeigt, dass das Reaktionsharz nicht oder nur unzulänglich an den senkrechten Schenkeln des Kreuzprofiles haftet. Die Folge ist dann, dass sich die so „kraftschlüssig festgelegte“ Scheinfuge weiterhin bewegt und sich später in elastischen und textilen Belägen als sogenannte Würmchenbildung abzeichnet. Deshalb sollten diese Kreuzprofile nur dann an Scheinfugen eingebaut werden, wenn diese Fugen offen bleiben und in den Oberbelag als Bewegungsfugen übernommen werden. Um Reklamationen zu vermeiden, helfen ansonsten nur der Ausbau dieser Profile und das Verharzen dieser Bereiche einschließlich Querverdübelung mit einem Reaktionsharz. Hier hat es sehr „teure“ Reklamationen gegeben.
Randfugen sind eigentlich simple und unscheinbare Bauteile, die nicht in der Fugenplanung enthalten sein müssen. In der Baupraxis ist es allerdings bei diesem Bauteil zu Bauschäden gekommen, die sogar in die Hunderttausende Euro gingen. Das betrifft vor allem Bauschäden, deren Schadensursache auf zu früh abgeschnittene Randdämmstreifen zurückzuführen war. Besonders kostenintensiv waren die damit verbundenen Reklamationen durch Korrosion von Heizungsrohren. Randdämmstreifen sind grundsätzlich in den Randfugen bei schwimmenden Estrichen sowie Estrichen auf Trennlage einzubauen. Randdämmstreifen sind zwischen dem Estrich und allen aufgehenden und hindurchführenden Bauteilen (Wänden, Türzargen, Säulen, Pfeilern, Rohrleitungen usw.) anzuordnen. Werden Randfugen nicht durchgängig und frei von festen Verbindungen ausgeführt,
kann Trittschall in andere Bauteile eingeleitet werden,
wird das Verkürzungsbestreben in der Schwindphase behindert, mit der Folge einer Rissbildung,
wird das Längenänderungsbestreben von Heizestrichen und anderen thermisch beanspruchten Fußböden behindert, mit der Folge von Rissbildungen,
wird Schmutz, Bauschutt und Spachtelmasse zwischen die aufgehenden Bauteile und den Estrich gelangen.
Randdämmstreifen verhindern die Übertragung von Trittschall und Schwingungen in die Fußbodenkonstruktion und ermöglichen horizontale Bewegungen des Estrichs.
In der Regel sind Randdämmstreifen 5 bis 10 mm dick. Bei beheizten Fußbodenkonstruktionen sollte die Dicke des Randdämmstreifens 10 mm nicht unterschreiten. Die Dicke des Randdämmstreifens ist so zu bemessen, dass nach dem Erhärten des Estrichs eine Zusammendrückbarkeit von mindestens 5 mm in horizontaler Richtung gegenüber sämtlichen angrenzenden und die Fußbodenkonstruktion durchdringenden Bauteilen ermöglicht wird. Randfugen müssen durch geeignete Randdämmstreifen bis auf den tragenden Untergrund bzw. bis zur Unterkante der obersten Dämmschicht ausgebildet werden. Die Breite der Randfuge muss auf das Estrichmaterial abgestimmt sein. Hier ist dann wiederum der Planer bzw. der Lieferant des Estrichmaterials gefordert. Der Randdämmstreifen ist erst nach Fertigstellung des Fußbodenbelags sowie bei elastischen und textilen Belägen erst nach der Erhärtung der Spachtelmasse abzuschneiden.
Im Kommentar zur DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Stand 2010, heißt es dazu im Abschnitt „Entfernen des Überstandes von Randdämmstreifen nach Verlegen der Bodenbeläge“:
„Damit die schalldämmende Funktion und die Aufnahme der thermischen Längenänderung eines schwimmenden Estriches nicht eingeschränkt wird, dürfen Randfugen durch Verschmutzung (z. B. Mörtelreste) oder Spachtelmassen nicht überbrückt werden. Der überstehende Randstreifen darf keinesfalls vor dem Spachteln abgeschnitten werden! Ggf. muss ein neuer Randstreifen eingebaut oder ergänzt werden. Dieses wie auch das Abschneiden der Randdämmstreifen ist grundsätzlich eine extra zu vergütende Leistung.“
Der Randdämmstreifen wurde teilweise nicht fachgerecht eingebaut.
Der Parkett- und Bodenleger muss die eingebauten Randdämmstreifen und hier besonders den Überstand über die Estrichoberfläche mittels Zollstock prüfen. Bei folgenden Mängeln muss der Auftragnehmer schriftlich Bedenken anmelden:
bei fehlendem Randdämmstreifen,
wenn die Randdämmstreifen, besonders in den Ecken, nicht dicht am Estrich und den aufgehenden Bauteilen anliegen,
wenn kein ausreichender Überstand des Randdämmstreifens vorhanden ist. Der Überstand sollte ca. 10 mm betragen. Wenn der Randdämmstreifen beim Tapezieren stört, ist er so abzuschneiden, dass er noch mindestens in Belagsdicke verbleibt!
Wenn die genannten Mängel beim Einbau der Randdämmstreifen auftreten, muss wie folgt nachgearbeitet werden:
Fehlende Randdämmstreifen müssen nachträglich eingebaut werden.
Wenn die Randdämmstreifen nicht dicht an den aufgehenden Bauteilen anliegen, müssen die dadurch entstandenen Fehlstellen zwischen Estrich und Randdämmstreifen ausgefüllt werden. Zum Schließen dieser Fehlstellen werden mineralische Estriche verwendet, sehr häufig werden aber auch aus Zeit- und Verarbeitungsgründen Epoxidharzmörtel eingesetzt. Epoxidharzmörtel verfügen über eine Reihe von Vorteilen und sind deshalb eigentlich ideal zum Schließen von Fehlstellen.