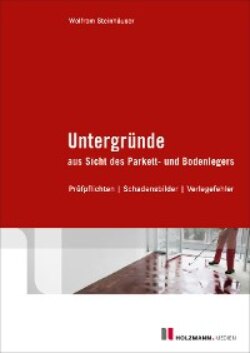Читать книгу Untergründe aus Sicht des Parkett- und Bodenlegers - Wolfram Steinhäuser - Страница 4
Vorwort
ОглавлениеDie Verlegung von Bodenbelägen und Parkett auf mineralische Estriche, Gussasphaltestriche, Holzdielen, Trockenestriche, Span- und OSB-Platten gehört zum Standardprogramm eines jeden Parkett- und Bodenlegers. Diese Untergründe sind am häufigsten auf Baustellen anzutreffen. Das Spektrum an Untergründen, die in der Baupraxis auftreten und auf die ebenfalls Bodenbeläge und Parkett verlegt werden sollen, ist jedoch wesentlich vielfältiger. Nicht selten fragt sich dann der Parkett- und Bodenleger, wie er bei diesem speziellen Untergrund vorzugehen hat, um darauf schadensfrei Belagsarbeiten ausführen zu können. Jedem Parkett- und Bodenleger muss klar sein: Egal um welchen Untergrund es sich handelt und wie der Untergrund beschaffen ist – er muss seinen Prüfpflichten nachkommen. Grundsätzlich muss jeder alte wie auch jeder neue Untergrund für die Ausführung der Bodenbelagsarbeiten gemäß DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ sowie für die Ausführung von Parkettarbeiten gemäß DIN 18356 „Parkettarbeiten“ eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, frei von Trennmitteln sowie zug- und druckfest sein. Jeder Auftraggeber (Bauherr) hat dem Auftragnehmer (Bodenleger, Parkettleger) den Untergrund so zur Verfügung zu stellen, dass der Auftragnehmer seine Werkleistung mangelfrei erbringen kann. Jeder Auftragnehmer für Parkett- und Bodenbelagsarbeiten ist andererseits verpflichtet, mit der im Verkehr üblichen Sorgfalt und unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln des Fachs sowie des Standes der Technik den Untergrund auf seine Belegereife zu überprüfen. Weist der Untergrund Mängel auf oder sind aufgrund der gewählten Fußbodenkonstruktion Schäden zu erwarten, muss der Auftragnehmer schriftlich Bedenken geltend machen.
Bauherren, Architekten, Parkett- und Bodenleger müssen sich nicht selten mit alten Untergründen auseinandersetzen.
Die richtige Planung eines Fußbodens ist für dessen Erfolg entscheidend. Die genaue und realistische Planung erfordert technisches und wirtschaftliches Wissen sowie praktische Erfahrung. Der Planer schuldet in der Regel die für die Durchführung der Bauleistungen notwendigen Pläne, Ausschreibungsunterlagen und sonstigen Beratungsleistungen als auch die Objektüberwachung. Der Planer hat wie jeder Werkunternehmer für die Entstehung eines mangelfreien und zweckgerechten Gewerkes einzustehen. Entspricht seine Leistung nicht den Anforderungen, so ist seine Leistung fehlerhaft, und zwar unabhängig davon, ob die anerkannten Regeln der Technik eingehalten worden sind oder nicht. Planungsleistungen werden in erster Linie von Architekten ausgeführt. In der Fußbodenbranche jedoch werden insbesondere Parkett- und Bodenleger als Planer in der Sanierung und Renovierung aktiv. In der Regel übernehmen sie eine Doppelrolle als Planer und Ausführender. Deshalb ist es hier besonders wichtig, dass Parkett- und Bodenleger wissen, worauf sie sich bei der Planung einlassen. Wofür müssen eigentlich Architekten einstehen, wenn sie Planungsleistungen ausführen und dabei Fehler machen? Leider sind sich viele Handwerker darüber nicht im vollen Umfang im Klaren. Die Ausführungen im BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen im Alt- und Neubau, Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Laminat, mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen, Holzfußböden und Holzpflaster, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen“, Absatz 1.2, Stand März 2014, gelten für Planer und Ausführende. Hier heißt es beispielsweise im Punkt „Besondere Hinweise für den Planer/Architekten“:
„Zur Vermeidung von Missverständnissen und zur eindeutigen Leistungsbeschreibung müssen folgende Angaben im Leistungsverzeichnis enthalten sein:
Angaben über den Gesamtaufbau einer Fußbodenkonstruktion, wie z. B.
Anforderungen hinsichtlich Nutzung und Art der Beanspruchung
Art und Aufbau des Estrichs und der verwendeten Bindemittel und Zusätze (z. B. beschleunigte Estriche)
beheizte/gekühlte Untergründe
Nenndicke des Estrichs
Anordnung, Art und Dicke der einzelnen Schichten (Estrich und ggf. Abdeckung, Dämmstoffe, Trennschichten sowie Sperrschichten gegen Wasserdampf)
Abdichtungen gegen Wasser
alte Schichten (Klebstoffe, Spachtelmassen, Unterlagen usw.)
Anordnung von Fugen (Fugenplan) etc.
Der tatsächliche Aufbau ist sowohl im Neubau als auch bei Renovierungen zu dokumentieren und dem Bodenleger rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten mitzuteilen.“
Diese Forderungen sind vollkommen berechtigt und auch zwingend notwendig, aber leider oft graue Theorie. Besonders häufig fehlen selbst bei der Planung durch einen Architekten die Angaben über die Nenndicke des Estrichs, Anordnung, Art und Dicke der einzelnen Schichten, Abdichtungen gegen Wasser und der Fugenplan.
Wenn der Parkett- und Bodenleger die Mängel in der Planung feststellt, muss er Bedenken anmelden und die fehlenden Angaben beim Bauherrn einfordern. Wenn der Parkett- und Bodenleger die Fußbodenplanung und die Ausführung allein übernimmt und keine vollständigen Angaben zu den geforderten Planungsunterlagen machen kann, muss er das dem Bauherrn mitteilen und eventuell die Gewährleistung ausschließen. Häufig gehen hier die Parkett- und Bodenleger große Risiken ein.
Die Sanierung von Gebäudebeständen nimmt nach wie vor in Deutschland wie auch in Europa einen dominanten Raum ein. Architekten, Planer, aber auch Estrichleger, Parkett- und Bodenleger müssen sich mit alten Untergründen auseinandersetzen.
Altuntergründe sind grundsätzlich keine normgerechten Untergründe gemäß BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen", Stand März 2014.
Die Art der zu sanierenden Fußböden ist ebenso vielfältig wie der Umgang von Bauherrn, Architekten, Planern und Handwerkern mit den verschiedenen Untergründen. Landläufig herrscht die Meinung vor, dass der „gute alte Estrich“, der bereits die vergangenen 50 Jahre oder länger schadlos überdauert hat, auch die nächsten Jahrzehnte überstehen wird. Leider wird dabei außer Acht gelassen, dass auch ein Fußboden Alterungsprozessen unterworfen ist, wie in der Baupraxis täglich festgestellt werden kann. Dipl.-Ing. (FH) Peter Kunert hat im Jahr 2005 einen Fachbeitrag unter dem Titel „Nutzungsdauer von Estrichen im Wohnungs- und Objektbau und von Nutzböden im Industriebau“ veröffentlicht mit dem Ziel, zu diesem Thema eine Diskussion unter den Fachleuten auszulösen. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind dazu keine Stellungnahmen bekannt. Die Vorgaben in diesem Fachbeitrag zur Nutzungsdauer und zur Abschreibung von Estrichen sind bemerkenswert.
Kunert gibt beispielsweise folgende Nutzungsdauer für schwimmende Estriche im Wohnbereich an:
Beanspruchung hoch: 20 Jahre
Beanspruchung mittel: 30 Jahre
Beanspruchung leicht: 40 Jahre
Im Objektbereich verkürzen sich diese Zeiten wie folgt:
Beanspruchung hoch: 15 Jahre
Beanspruchung mittel: 20 Jahre
Beanspruchung leicht: 25 Jahre
Solche Angaben werden von den Architekten und Planern in der Altbausanierung so gut wie nie berücksichtigt, in der Regel sogar völlig ignoriert, obwohl eine solche Nachlässigkeit erhebliche Reklamationen nach sich ziehen kann. Deshalb wird auch grundsätzlich empfohlen, unbedingt auf eine bauseitige Bestandsaufnahme zu bestehen. In dieser Problematik liegt die große Chance, jedoch auch ein nicht zu unterschätzendes Risiko für die Boden- und Parkettleger. Boden- und Parkettleger werden häufig gefragt, ob der alte Untergrund in seinem jetzigen Zustand so bleiben kann, sanierungsfähig ist oder ob es ausreicht, lediglich „kleinere“ Ausbesserungen vorzunehmen, um einen verlegereifen Untergrund zu erzielen. Machen die Handwerker dazu verbindliche Aussagen, sind die Boden- und Parkettleger in einem solchen Fall automatisch Planer. Was bedeutet das für den Handwerker? Der Parkett- und Bodenleger muss gegenüber dem Bauherrn für technische und wirtschaftliche Planungsfehler einstehen. Ist ein Planungsfehler gegeben, kann der Bauherr vom Verarbeiter Regress fordern.
Was ist ein Untergrund, und was müssen Parkett- und Bodenleger über Untergründe wissen? Eine heikle Frage, die man einfach so beantworten könnte: Eigentlich fast alles. Allerdings schützt hier die Verarbeiter die folgende Aussage im bereits zitierten BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen im Alt- und Neubau“, Stand März 2014, vor allzu forsch vorgehenden Bauherrn bei der Klärung der Schuldfrage bei Reklamationen. Hier heißt es im Punkt 1.2 „Besondere Hinweise für den Planer/Architekten“:
„Die Prüfpflicht des Bodenlegers erstreckt sich auf den Untergrund (Lastverteilschicht, z. B. Estrich) und nicht auf darunterliegende Schichten (z. B. Trennlagen/Dämmschichten und/oder Abdichtungen).“
Dieser eine Satz hat schon manchen Parkett- und Bodenleger vor größerem Schaden bewahrt, denn selbst Architekten und Bauleiter sind oft der Meinung, dass Parkett- und Bodenleger den gesamten Fußbodenaufbau überprüfen müssen. Nicht selten sind dann Planer ganz überrascht darüber, dass sie falsch geplant haben, weil sie beispielsweise auf die fachgerechte Abdichtung auf einer neu eingebauten Betondecke verzichtet haben.
Der Parkett- und Bodenleger muss auf dem Untergrund seine Leistungen ausführen. Das betrifft den Boden- und auch den Wandbereich, an dem er die Sockelleisten befestigen muss. Wie man in den folgenden Ausführungen erkennen kann, gehen die Meinungen darüber, was der Parkett- und Bodenleger über Untergründe wissen sollte und prüfen muss, häufig weit auseinander. Das zeigen auch die zahlreichen Gerichtsurteile, die ja bekanntlich besonders bauherrnfreundlich sind. Bei den Neuuntergründen dürfte diese Problematik nicht ganz so dramatisch sein. Hier kann man nur jedem Parkett- und Bodenleger empfehlen, beim Bauherrn, Architekten, Bauleiter oder am besten gleich beim Estrichleger nachzufragen, welcher Estrich tatsächlich eingebaut wurde. Die Betonung liegt hier auf den Worten „tatsächlich eingebaut“. Es gab und gibt immer wieder Baustellen, bei denen beispielsweise Zementestrich in der Ausschreibung steht und tatsächlich ein Schnellestrich eingebaut wurde. Besonders problematisch sind mineralische Sonderestriche, denn anhand von Farbe, Körnung, Textur, Ebenheit oder Fugenbild kann der Parkett- und Bodenleger unmöglich erkennen, welcher Estrich tatsächlich eingebaut wurde und was er bei der Verlegung auf diese Untergründe besonders beachten muss. Bei den Altuntergründen ist häufig die Frage, um welchen Untergrund es sich handelt und wie hier vorzugehen ist, besonders problematisch. Die Bauherrn wollen hier fast immer Planungskosten einsparen und lassen den Parkett- und Bodenleger entscheiden, wie er hier vorgehen will. Somit liegt alle Verantwortung beim Parkett- und Bodenleger.
Auf diesem kritischen und nicht tragfähigen Altuntergrund kann kein Parkett oder Bodenbelag verlegt werden.
Im Kommentar zur DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Absatz 4.2.4 Beseitigen alter Beläge und Klebstoffschichten, Stand 2010, heißt es:
„Durch evtl. auftretende chemische Wechselwirkungen zwischen Altuntergrund und Neuaufbau können teilweise sehr unangenehme Geruchsbelästigungen entstehen. Zudem kann es zu Haftungsproblemen zwischen den aufzubringenden Materialien kommen. Um den Altuntergrund richtig zu bewerten, muss deshalb bauseits eine Dokumentation der vorliegenden Schichten vorgelegt bzw. eine umfangreiche Analyse veranlasst werden. Dafür hat der Auftraggeber Sorge zu tragen. Bei geplanter Nutzungsänderung ist auch die Tragfähigkeit des zu belegenden Untergrundes durch den Auftraggeber/Planer neu zu bewerten.“
Diese Forderungen im Kommentar zur DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten sind zwar voll und ganz zu unterstützen, aber leider nur sehr theoretischer Natur. Dokumentationen der vorliegenden Schichten sowie umfangreiche Analysen bei Altuntergründen werden dem Parkett- und Bodenleger so gut wie nie vorgelegt. Weiterhin ist dringend zu empfehlen, die Tragfähigkeit des Altuntergrundes generell neu zu bewerten und nicht erst bei geplanter Nutzungsänderung. Besonders bei Parkettverlegungen auf Altuntergründen hat es diesbezüglich erhebliche Schäden gegeben.
Im bereits zitierten BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen im Alt- und Neubau“, Stand März 2014, wird darauf hingewiesen, dass alle Altuntergründe grundsätzlich keine normgerechten Untergründe darstellen. Parkett- und Bodenleger sollten deshalb immer Bedenken anmelden. Das ist sicher richtig, aber auch sehr theoretisch. Wenn ein Boden- und Parkettleger vor der Verlegung auf einen Altuntergrund Bedenken anmeldet, könnte es mit dem Auftrag und dem Bauherrn problematisch werden. Es sei denn, der Bodenleger kann seine Bedenken hinreichend begründen.
Rudolstadt, im August 2016
Wolfram Steinhäuser und
Holzmann Medien | Buchverlag