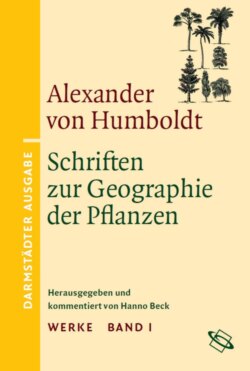Читать книгу Werke - Alexander Humboldt - Страница 11
Zusammenhänge
ОглавлениеVor allem das bedeutende Vermögen der Mutter (1741–1796) hat das Leben der Brüder Humboldt materiell gesichert – eine sehr wichtige Voraussetzung für ihren Weg, der infolge des Todes der Eltern weit eigenständiger verlaufen konnte.
Der Vater (1720–1779) galt als weltoffen und lebensbejahend, die Mutter dagegen war von kalvinistischer Sittenstrenge. Nach dem Tod der Eltern gedachte Wilhelm wenigstens noch einige Jahre hindurch des Geburtstages des Vaters, während das Bild der Mutter für beide auffallend schnell verblaßte. Die Brüder machten sie wie den Oberhofmeister Kunth für die langweilige Atmosphäre im Schloß Tegel verantwortlich.
Die Verschiedenheit, ja die Gegensätzlichkeit des Elternpaares prägte die beiden hochbegabten Söhne: Alexander glich äußerlich dem Vater, Wilhelm mehr der Mutter, und jeder Einblick in ihre intimeren Korrespondenzen enthüllt einen beträchtlichen Spannungsreichtum, der nach außen kaum hervortrat, zum Teil aber in der Gegensätzlichkeit der Eltern wurzelte.
Da der optimistische Vater früh starb, gewann die Mutter und der von ihr bevorzugte Oberhofmeister Kunth sehr an Einfluß. Der von der Mutter gewünschte solide Grundkurs eines Berufsweges ließ für Wilhelm das Studium der Rechte, für Alexander mit deutlicher Abwertung nur das Studium der Kameralistik zu. Vor allem Kunth glaubte nicht an die Begabung Alexanders, und dieser selbst hat deutlich den Zwang empfunden, der ihm durch dieses damalige Allerweltsfach zugemutet worden war, und damit all denen widersprochen, die noch nach 1959 solches nicht wahrhaben wollten.
Die Brüder Humboldt wurden von Hauslehrern vorwiegend philologisch unterrichtet, so daß sich die Begabung des zwei Jahre älteren Wilhelm besser entfalten konnte als die Alexanders. Dabei erwies sich Kunth zwar oft als eingeschränkter enger Aufklärer, ebenso aber auch als treuer Verwalter. Mit fast unerwarteter Weitherzigkeit übertraf er sich selbst, als gerade er die beiden Zöglinge in den Salon der schönen Henriette Herz, geb. de Lemos, einführte. Dabei hatte er zunächst nur an deren Mann, den naturwissenschaftlich sehr interessierten Dr. Markus Herz, gedacht, von dem beträchtliche Anregungen ausgingen; bald erwies sich allerdings die junge schöne Dame des Hauses als der noch weit stärkere Magnet. Dank dieser bezaubernden Frau haben Wilhelm und Alexander erstmals in bewußt-unbewußten Annäherungen von Liebe erfahren. Auch hinter Alexanders Tändeleien steckte mehr, als er äußerlich enthüllte, vielleicht auch mehr, als ihm damals bewußt war.
Schon nach einem Semester wurde das in Frankfurt an der Oder aufgenommene Studium (1. 10. 1787–20. 3. 1788) unterbrochen: Während Alexander, der sich nicht bewährt zu haben schien, in Berlin weiter von Hauslehrern gefördert wurde, durfte Wilhelm bereits das Studium in Göttingen fortsetzen. In dieser Zwischenzeit erlaubte man Alexander 1788 erstmals einen freien Ausgang in Berlin. Bewußt suchte er den hochbegabten jungen Botaniker Carl Ludwig Willdenow auf, der ihm in der Botanik den Zugang zu den Naturwissenschaften eröffnete. Bald hielt er einen Reishalm aus Japan in der Hand, den Willdenow seinem schwedischen Kollegen Karl Peter Thunberg verdankte, der das ferne Inselreich kennengelernt hatte. Eine neue Welt öffnete sich, und vielleicht hat er damals nicht nur im Gedankenspiel eine japanische Reise erwogen6. Bald schulten botanische Exkursionen den Blick, und das anschließende Studium in Göttingen und Hamburg erlaubte ihm auch kleinere Reisen z.B. zur reizvollen Basaltlandschaft des Meißners und zum Rhein. Während der letzteren Unternehmung lernte er im September 1789 Georg Forster in Mainz kennen, der seine frühe Vorliebe für die Tropen bestärkte. Ihm vertraute Alexander seine ersten wissenschaftlichen Pläne an, die insgesamt weit bedeutender waren als alles andere, was er vordergründig tat. Auch in seinem Briefwechsel und in gedruckten Publikationen gab er davon nie mehr als kurze Andeutungen. In dieser Beziehung war der jüngere Humboldt ein Geheimniskrämer, der das ihn eigentlich Bewegende höchstens andeutete oder in Fußnoten versteckte. Von Willdenow angeregt, hatte er in einem ersten Forschungsprogramm die „Geschichte der Pflanzen“, d.h. den Weg von Vegetabilien von einem Heimatgebiet unter Umständen über Land und Meer in ihre augenblicklichen Standorte verfolgen wollen. Aus diesem Ansatz entfalte sich bald die Geographie der Pflanzen7. Ein zweites Forschungsprogramm sollte ein geologisches Strukturgesetz darlegen8; obgleich es schließlich nicht bestätigt werden konnte, stellte es dennoch einen erheblichen Anreiz für weitere Untersuchungen dar. Ein drittes Programm diente der Profildarstellung von Ländern und geologischen Strukturen bei Anwendung einer Schriftzeichensprache (Pasigraphie). So wurden z.B. die endogenen und exogenen Prozesse, Ausdrücke, die Humboldt einführte, mit aufwärts- beziehungsweise abwärtsgerichteten Pfeilen dargestellt9.
Diese drei Forschungspläne hat Humboldt nur vertrauten Freunden kurz angedeutet, waren sie doch die geheimen „Triebräder“ (Goethe), die Bewährung nicht nur in Mitteleuropa, sondern auch auf Forschungsreisen verlangten. Ihre Motivation und bewegende Kraft wurde von der Forschung bis 1959 völlig verkannt, weil man den jungen A. v. Humboldt allein nach der Vielzahl seiner meist auffallend flüchtig hingeworfenen Publikationen bis 1799 beurteilte, die indessen niemand gründlicher studiert hatte. Da diese Veröffentlichungen außer einigen interessanten Ansätzen in verschiedenen Einzelwissenschaften kaum Genialität, sondern höchstens eine gewisse Vielseitigkeit offenbarten, meinte man schließlich gar, ihm die eigentliche wissenschaftliche Bedeutung absprechen zu können10.
Dem ihm aufgezwungenen kameralistischen Allerweltsstudium hat Humboldt zweifellos Gutes abgewonnen. Es führte ihn in Göttingen zu Lichtenberg, zu Blumenbach und zu dessen jungem Kreis werdender Forschungsreisender, nach Hamburg auf die Handelsakademie von Johann Georg Büsch und zum führenden deutschen Nordamerika-Experten Christoph Daniel Ebeling. Die Konsequenz eines solchen Weges konnte durchaus das Studium des Bergbaus in Freiberg in Sachsen sein, mit dem Alexander erstmals seine Mutter wie Kunth diplomatisch ausspielte, als er es durchsetzte. Es war neben seiner botanischen Selbsttätigkeit das erste Studium, das er von vornherein bejahte. Ein halbes Jahr reichte ihm, um – auch ohne Examen – hohe Anerkennung im preußischen Bergdienst zu finden. Er spürte besonders seinem zweiten Forschungsprogramm nach, begegnete erstmals Goethe und Schiller (1794), und eine regelrechte kleine Forschungsreise führte ihn 1795 nach Oberitalien und tief in die Schweiz hinein11.
Das, was die Mutter und Kunth an Wärme vermissen ließen, brachte der Freundschaftskult in Alexanders Dasein: Vertrautheit, Anteilnahme und gemeinsames Erleben.